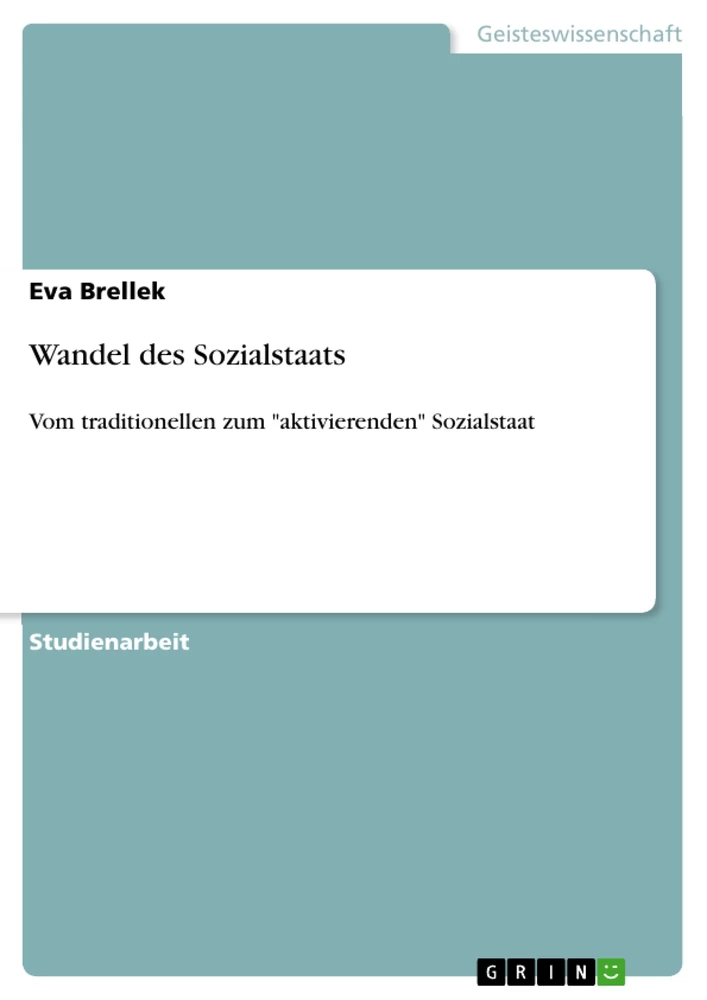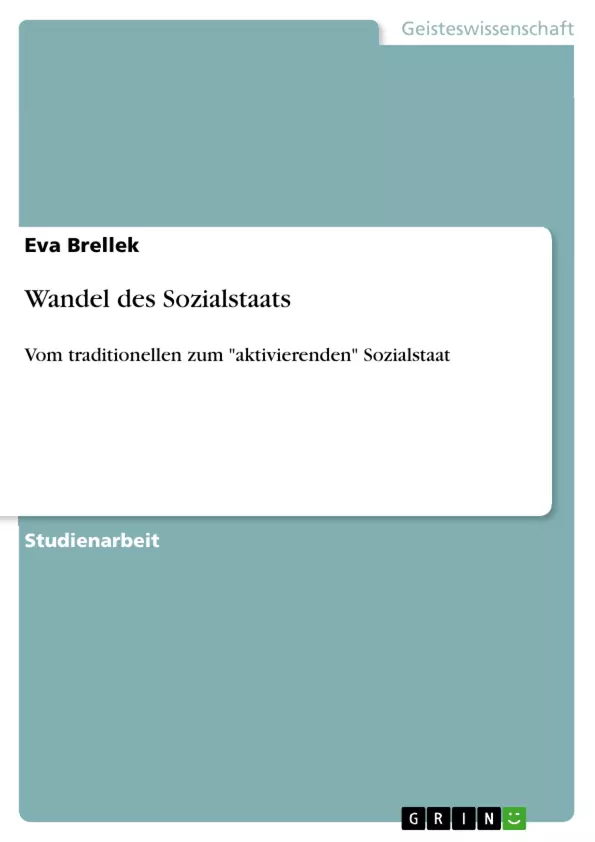Nach der Phase, die in Deutschland als Wirtschaftswunder bezeichnet wird, kam es Anfang der 70er Jahre zu einer Wende. Durch die internationale Ölkrise und den starken Anstieg der Arbeitslosigkeit nahm die Staatsverschuldung zu. Versuche die wirtschaftlichen Probleme mithilfe des Keynesianismus, wonach die gesamtwirtschaftliche Nachfrage die entscheidende Größe für Produktion und Beschäftigung ist, in den Griff zu bekommen, scheiterten. In Folge dessen kam es zu einem ersten Wandel des deutschen Staatsverständnisses und der Wirtschaftspolitik.
Nach Auffassung der führenden politischen Elite, schien der Staat an seine finanziellen Grenzen gestoßen zu sein. Dieser Umstand sollte durch entsprechende Veränderungen der staatlichen Aufgaben konterkariert werden. Im Zentrum der Überlegungen wie der Staatshaushalt zu entlasten sei, standen u. a. liberale Forderungen nach einem „schlanken Staat“, der durch die Reduzierung der Staatsaufgaben auf Kernbereiche Mittel einsparen sollte. Die Rot-Grüne Bundesregierung, die seit 1998 in Deutschland regierte, versuchte auf die Veränderungen durch eine Neuformulierung des Staatsverständnisses zu reagieren.
Kanzler Gerhard Schröder folgte dabei dem von Anthony Giddens formulierten „Dritten Weg“ . In Deutschland wurde dieser Diskurs in Form eines gemeinsamen Papiers von Schröder und dem damaligen britischen Premierminister Tony Blair bekannt. Hierzulande wurden die Inhalte des Papiers als Kurs der „Neuen Mitte“ vorgestellt...
Fokus der Arbeit steht der angesprochene Aktivierungsansatz, der am Beispiel der sogenannten „Hartz IV“-Gesetze erläutert werden soll. Darüber hinaus soll der Versuch unternommen werden, eine Bilanz nach sechs Jahren Hartz IV zu ziehen. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Die Entstehung des Sozialstaats
- Bereiche und Funktionen des Sozialstaats
- Probleme und Grenzen des traditionellen Sozialstaats
- Aktivierungsansatz - Aktivierung im SGB 11
- Sechs Jahre Hartz IV - Eine Bilanz
- Fazit und eigene Stellungnahme
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung analysiert die Entwicklung des Sozialstaates in Deutschland, insbesondere im Kontext des aktivierenden Sozialstaats und der Hartz IV-Reformen. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Funktionen des Sozialstaats sowie die Herausforderungen, denen er im 21. Jahrhundert gegenübersteht.
- Entstehung und Entwicklung des Sozialstaats
- Funktionen und Kernbereiche des Sozialstaats
- Probleme und Grenzen des traditionellen Sozialstaats
- Der aktivierende Sozialstaat als Reaktion auf die Herausforderungen
- Die Hartz IV-Reformen und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Abhandlung dar, indem sie auf die Veränderungen im deutschen Staatsverständnis und der Wirtschaftspolitik nach der Ölkrise der 1970er Jahre eingeht. Sie führt den Begriff des aktivierenden Sozialstaats ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Begriffsklärung: Dieses Kapitel definiert die wichtigsten Begriffe, die in der Abhandlung verwendet werden, insbesondere die Unterscheidung zwischen Sozialstaat und Wohlfahrtsstaat. Es erläutert die Typologie von Esping-Andersen und die verschiedenen Wohlfahrtsstaatstypen.
- Die Entstehung des Sozialstaats: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Sozialstaats in Deutschland im 19. Jahrhundert, insbesondere die Rolle von Otto von Bismarck. Es verfolgt die Entwicklung des Sozialstaats bis zur deutschen Wiedervereinigung und zeigt die wichtigsten Meilensteine der Sozialgesetzgebung auf.
- Bereiche und Funktionen des Sozialstaats: Dieses Kapitel beschreibt die Kernbereiche und Funktionen des Sozialstaats, darunter soziale Sicherungssysteme, Arbeitsrecht, Wohnungspolitik und Bildungspolitik. Es betont die Bedeutung des Sozialstaats für die Herstellung menschenwürdiger Lebensverhältnisse und die Sicherung gegen soziale Risiken.
- Probleme und Grenzen des traditionellen Sozialstaats: Dieses Kapitel geht auf die Herausforderungen ein, denen der Sozialstaat im 21. Jahrhundert gegenübersteht. Es analysiert die demographischen Herausforderungen, die Internationalisierung und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die zu einem Wandel des Sozialstaats führen.
- Aktivierungsansatz - Aktivierung im SGB 11: Dieses Kapitel erklärt das Konzept des aktivierenden Sozialstaats, das von der Rot-Grünen Bundesregierung eingeführt wurde. Es zeigt die drei Ebenen der Aktivierung (Arbeitsmarkt, öffentliche Verwaltung, Bürger) und beleuchtet die Rolle des SGB 11 im Zusammenhang mit der Hartz IV-Reform.
- Sechs Jahre Hartz IV - Eine Bilanz: Dieses Kapitel zieht eine Bilanz der Hartz IV-Reformen nach sechs Jahren. Es analysiert die Auswirkungen auf die Arbeitslosenzahlen und die verschiedenen Aspekte der Reform, wie die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, die Aktivierung von Arbeitsuchenden und die veränderten Zumutbarkeits- und Sanktionsregeln.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Sozialstaat, den aktivierenden Sozialstaat, die Hartz IV-Reformen, die Arbeitsmarktpolitik, die soziale Sicherung, die Demographie, die Internationalisierung und die Herausforderungen des Sozialstaats im 21. Jahrhundert. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Sozialstaats in Deutschland, seine Funktionen und Kernbereiche sowie die Auswirkungen der Hartz IV-Reformen auf den Arbeitsmarkt und die Aktivierung von Arbeitsuchenden.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "aktivierenden Sozialstaat"?
Dies ist ein Konzept, das unter der Rot-Grünen Bundesregierung (Schröder/Blair-Papier) eingeführt wurde. Es zielt darauf ab, Bürger durch Fordern und Fördern stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Welche Rolle spielen die Hartz IV-Gesetze in dieser Arbeit?
Die Hartz IV-Gesetze dienen als zentrales Beispiel für den Aktivierungsansatz. Die Arbeit zieht zudem eine Bilanz nach sechs Jahren ihrer Einführung.
Wer gilt als Begründer des deutschen Sozialstaats?
Die Arbeit verweist auf Otto von Bismarck, der im 19. Jahrhundert die Grundlagen für die deutsche Sozialgesetzgebung legte.
Was sind die größten Herausforderungen für den Sozialstaat im 21. Jahrhundert?
Zu den Hauptproblemen zählen der demographische Wandel, die zunehmende Internationalisierung und die damit verbundenen finanziellen Belastungen des Staatshaushalts.
Was ist der Unterschied zwischen Sozialstaat und Wohlfahrtsstaat?
Das Kapitel zur Begriffsklärung erläutert diese Unterschiede unter Rückgriff auf die Typologie von Esping-Andersen und verschiedene Wohlfahrtsstaatstypen.
Welche Funktionen erfüllt der Sozialstaat laut dieser Abhandlung?
Er dient der sozialen Sicherung, der Herstellung menschenwürdiger Lebensverhältnisse und dem Schutz gegen soziale Risiken wie Krankheit, Alter oder Arbeitslosigkeit.
- Quote paper
- Eva Brellek (Author), 2012, Wandel des Sozialstaats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212424