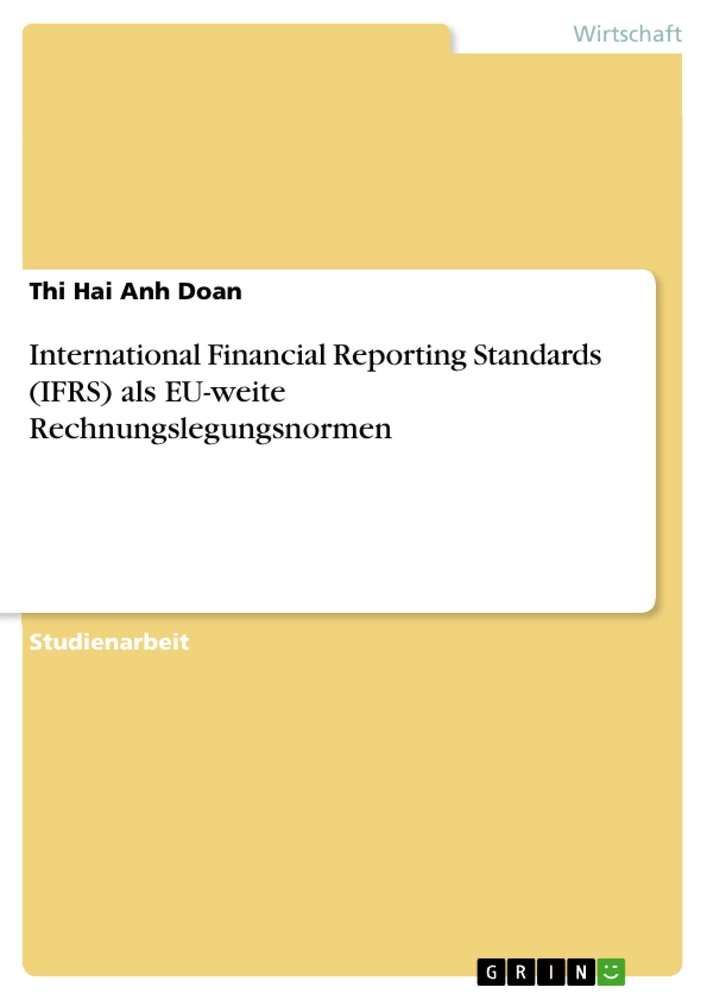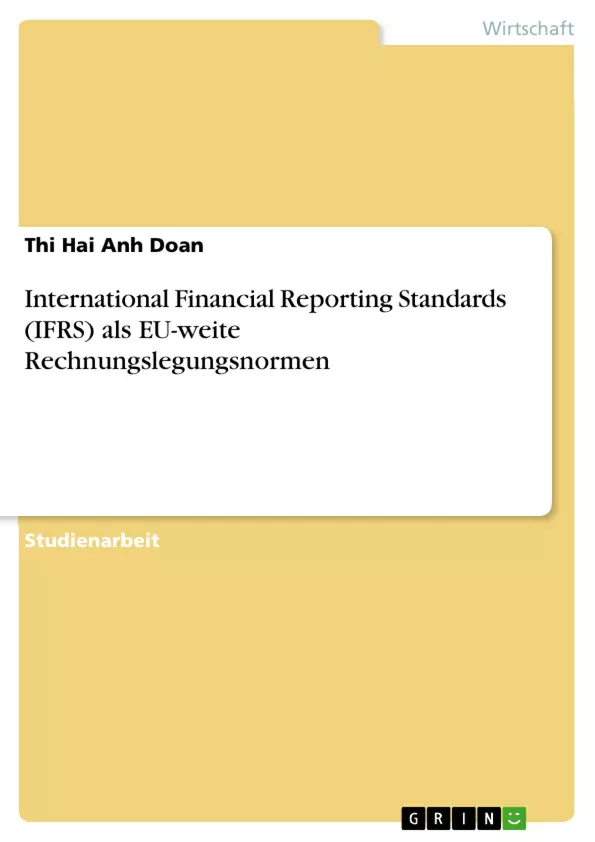Die Wurzeln der heutigen International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie die bisherigen International Accounting Standards (IAS) sind ein wesentliches Instrument der weltweiten Harmonisierung der Rechnungslegung geworden. Die Entwicklung und Einführung weltweit harmonisierter Rechnungslegungsstandards liegen am 29. Juni.1973 in London gegründeten International Accounting Standards Committee (IASC). Im Zuge der Restrukturierung wurde im März 2001 die IASC als unabhängige Dachorganisation in Delaware, USA, gegründet. Die IFRS für die Konzernabschlüsse Kapitalmarkt orientierter Unternehmen in der EU aufgrund der EG-Verordnung Nr. 1606/ 2002 grundsätzlich ab dem Jahr 2005 obligatorisch. Die IFRS ersetzen damit in weiten Teilen die Regelungen des HGB.
Die Rechnungslegung nach IFRS hat primär eine Informationsfunktion zu erfüllen. Das Ziel der IFRS-Rechnungslegung besteht gemäß Framework.12 in der Bereit-stellung von Informationen, die für die verschiedenen Abschlussadressaten bei deren spezifischen wirtschaftlichen Entscheidungen nützlich sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechnungslegungsvorschriften
- Gründe für eine internationale Rechnungslegung
- Der IASB
- Entwicklung
- Organisation
- Ziele
- IFRS als EU-weite Rechnungslegungsnormen
- IFRS — Anwendung innerhalb der EU
- Übernahme der IFRS in das EU-Recht
- Exkurs: IFRS auf dem amerikanischen Kapitalmarkt
- Anwendung der IFRS in Deutschland
- Unterschiede IFRS gegenüber HGB
- Wesentliche konzeptionelle Unterschiede
- Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede
- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Probleme der IFRS
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der internationalen Rechnungslegung nach IFRS und analysiert deren Auswirkungen auf die deutsche Bilanzierungspraxis. Dabei werden die Entwicklung und Organisation des IASB, die Implementierung der IFRS in der EU und die Unterschiede zwischen IFRS und HGB beleuchtet.
- Die Entwicklung und Organisation des International Accounting Standards Board (IASB)
- Die Einführung und Anwendung der IFRS in der EU
- Die Unterschiede zwischen IFRS und HGB in Bezug auf Bilanzierung, Bewertung und immaterielle Vermögenswerte
- Die Herausforderungen und Probleme der IFRS
- Die Auswirkungen der IFRS auf die deutsche Bilanzierungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung:
- Die Einleitung stellt die International Financial Reporting Standards (IFRS) als ein wichtiges Instrument der weltweiten Harmonisierung der Rechnungslegung vor. Sie erläutert die Entstehung der IFRS, ihre Bedeutung für die EU und ihre Zielsetzung.
- Die Einleitung diskutiert die Gründe für eine internationale Rechnungslegung, die sich aus der Internationalisierung der Kapitalmärkte, der Wirtschaft und der Unternehmensführung ergeben.
- Der IASB:
- Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des IASB, seine Organisation und seine Ziele. Es beleuchtet die verschiedenen Phasen der Entwicklung des IASB, seine wichtige Rolle in der Harmonisierung der Rechnungslegung und seine zukünftigen Herausforderungen.
- IFRS als EU-weite Rechnungslegungsnormen:
- Dieses Kapitel erläutert die Einführung der IFRS als EU-weite Rechnungslegungsnormen. Es beleuchtet die Anwendung der IFRS in der EU, die Übernahme der IFRS in das EU-Recht, die Zulassung der IFRS in den USA und die Anwendung der IFRS in Deutschland.
- Unterschiede IFRS gegenüber HGB:
- Dieses Kapitel analysiert die Unterschiede zwischen IFRS und HGB in Bezug auf die konzeptionellen Grundlagen, die Bilanzierung und Bewertung sowie die Behandlung von immateriellen Vermögenswerten. Es beleuchtet die unterschiedlichen Zielsetzungen, Prinzipien und Methoden der beiden Rechnungslegungssysteme.
- Probleme der IFRS:
- Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen und Probleme der IFRS, wie z.B. fehlende Widerspruchsfreiheit, mangelnde logische Ableitbarkeit, unklaren Erfolgmessung, mangelnde Zuverlässigkeit und Akzeptanzprobleme.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen IFRS, IASB, EU-Rechnungslegung, HGB, Bilanzierung, Bewertung, immaterielle Vermögenswerte, Harmonisierung, Internationalisierung, Kapitalmarkt, Unternehmenskommunikation, Transparenz, Offenheit, Konvergenz, Akzeptanzprobleme, und die Auswirkungen der IFRS auf die deutsche Bilanzierungspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Was sind IFRS?
IFRS steht für International Financial Reporting Standards, ein Regelwerk zur weltweit harmonisierten Rechnungslegung von Unternehmen.
Seit wann sind IFRS in der EU verpflichtend?
Seit dem Jahr 2005 sind sie für die Konzernabschlüsse kapitalmarktorientierter Unternehmen aufgrund einer EG-Verordnung obligatorisch.
Was ist der Hauptunterschied zwischen IFRS und HGB?
Während das HGB primär dem Gläubigerschutz dient, steht bei IFRS die Informationsfunktion für Investoren im Vordergrund.
Wer entwickelt die IFRS-Standards?
Die Standards werden vom International Accounting Standards Board (IASB) mit Sitz in London entwickelt.
Welche Probleme gibt es bei der Anwendung von IFRS?
Herausforderungen sind unter anderem eine mangelnde Widerspruchsfreiheit, Akzeptanzprobleme und eine teils unklare Erfolgsmessung.
- Arbeit zitieren
- Thi Hai Anh Doan (Autor:in), 2012, International Financial Reporting Standards (IFRS) als EU-weite Rechnungslegungsnormen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212438