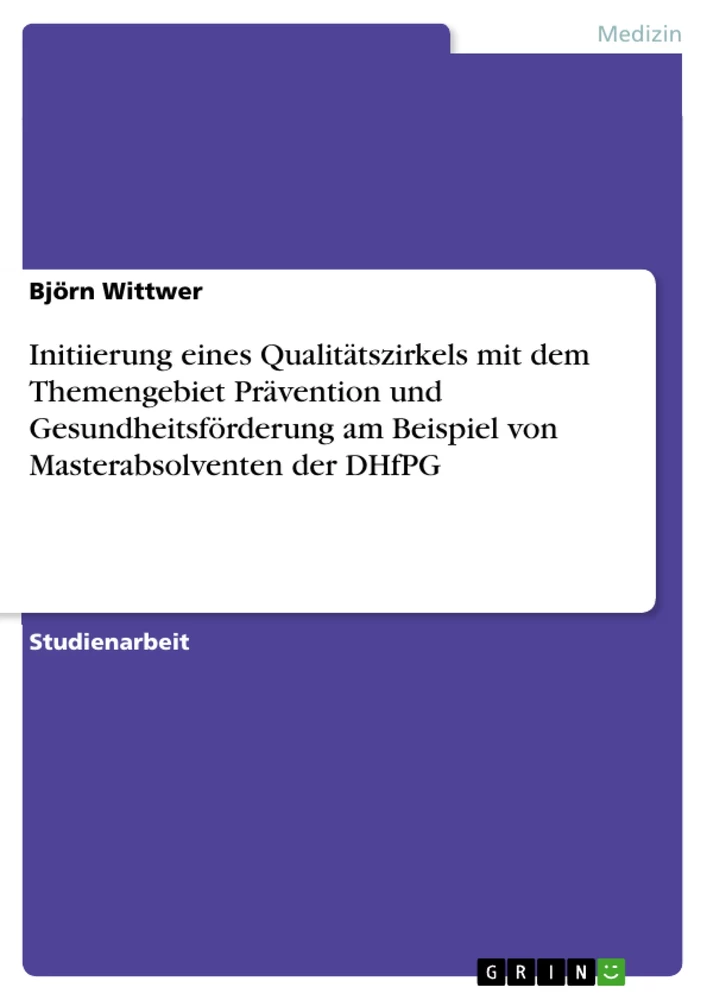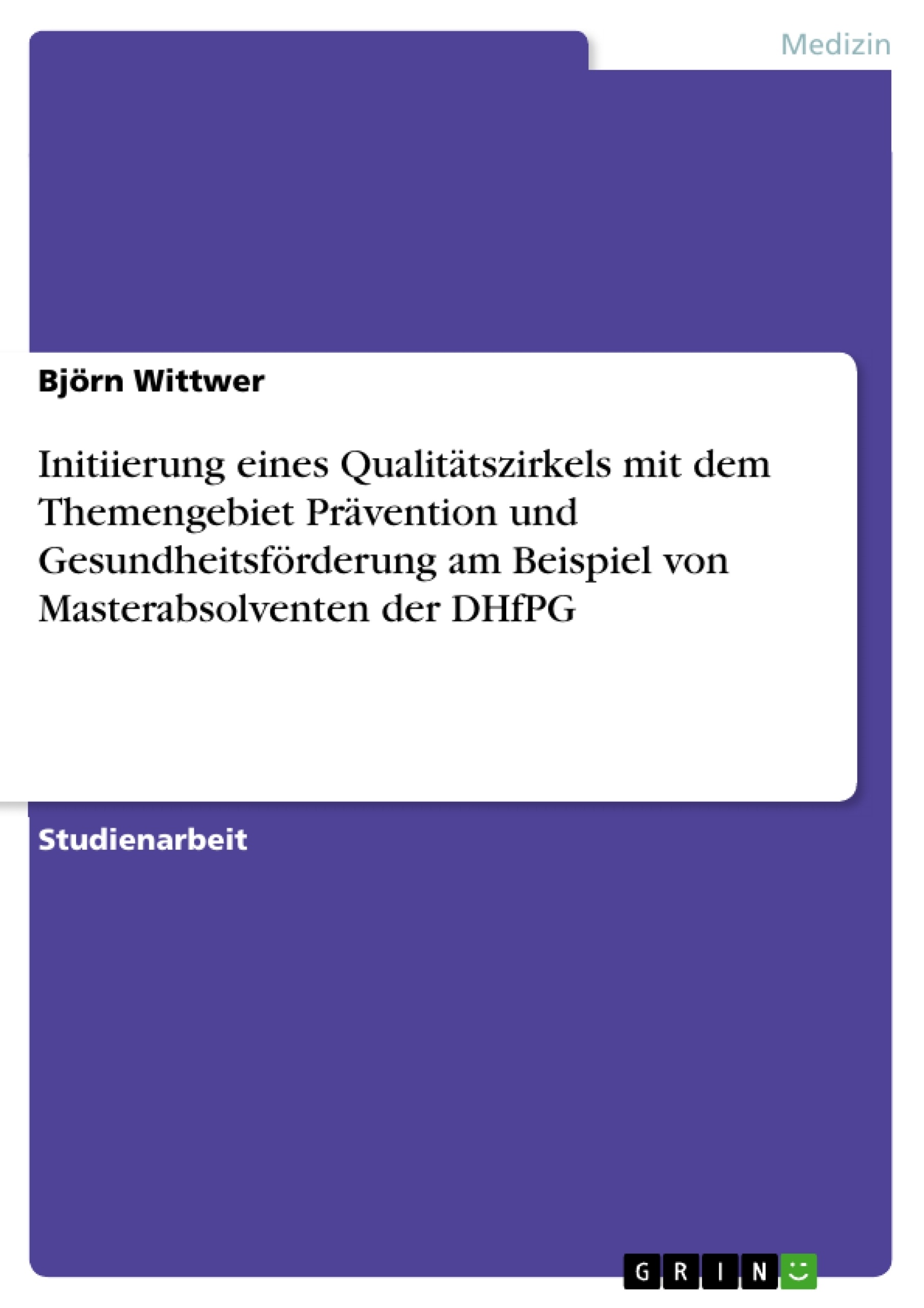Im Rahmen der vorliegenden Hausarbeit werden die Möglichkeiten zur Initiierung
eines Qualitätszirkels im Rahmen des Studiengangs Master in Präventionund
Gesundheitsmanagement unter Beteiligung von Studenten der DHfPG eruiert.
Das übergeordnete Ziel ist es, dass am Ende ein Netzwerk von Studenten
entsteht, welches auch nach Beendigung des Studiums zum Erfahrungsaustausch
hinsichtlich verschiedener Themengebiete der Prävention und Gesundheitsförderung
dient.
Inhaltsverzeichnis
1 Initiierung eines Qualitätszirkels
1.1 Herausforderungen und Ziele des Qualitätszirkels
1.2 Qualitätszirkel - Zusammensetzung und Aufgabenverteilung
1.3 Planung und Aktivierung fachorientierter Arbeitsgruppen
2 Sicherung und Steigerung der Qualität
2.1 Ist-Zustand und Chancen der Netzwerkbildung
2.2 Qualitätskreislauf
3 Evaluationskonzept „Public Health Action Cycle“
3.1 Analysephase
3.2 Planungsphase
3.3 Umsetzungsphase
3.4 Bewertungsphase
3.5 Selbstevaluation
4 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des hier beschriebenen Qualitätszirkels?
Das Ziel ist der Aufbau eines Netzwerks von Masterabsolventen der DHfPG zum kontinuierlichen Erfahrungsaustausch im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung.
Welche Aufgaben übernimmt ein solcher Qualitätszirkel?
Der Zirkel dient der Sicherung und Steigerung der Qualität, der Planung fachorientierter Arbeitsgruppen und der gemeinsamen Bearbeitung von Herausforderungen im Gesundheitsmanagement.
Was versteht man unter dem „Public Health Action Cycle“?
Dies ist ein Evaluationskonzept bestehend aus den Phasen Analyse, Planung, Umsetzung und Bewertung, das zur Steuerung des Qualitätszirkels genutzt wird.
Wie wird die Qualität innerhalb des Netzwerks gesichert?
Die Qualitätssicherung erfolgt durch einen strukturierten Qualitätskreislauf und regelmäßige Selbstevaluationen der Beteiligten.
An wen richtet sich die Initiative des Qualitätszirkels?
Die Initiative richtet sich primär an Studenten und Absolventen des Studiengangs Master in Prävention und Gesundheitsmanagement der DHfPG.
- Quote paper
- Björn Wittwer (Author), 2012, Initiierung eines Qualitätszirkels mit dem Themengebiet Prävention und Gesundheitsförderung am Beispiel von Masterabsolventen der DHfPG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212624