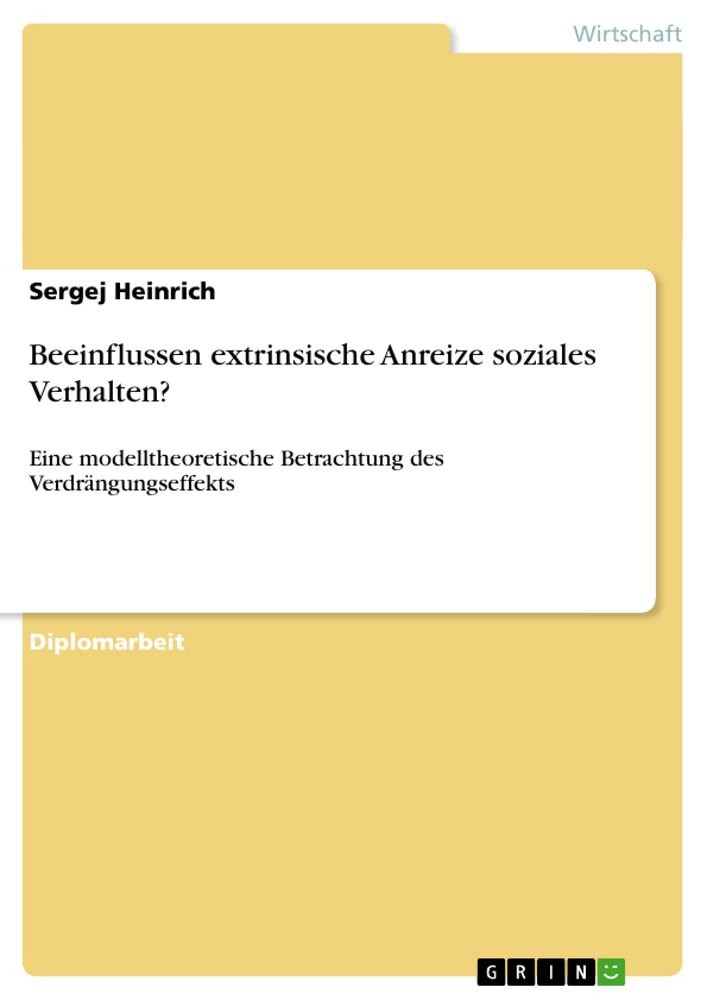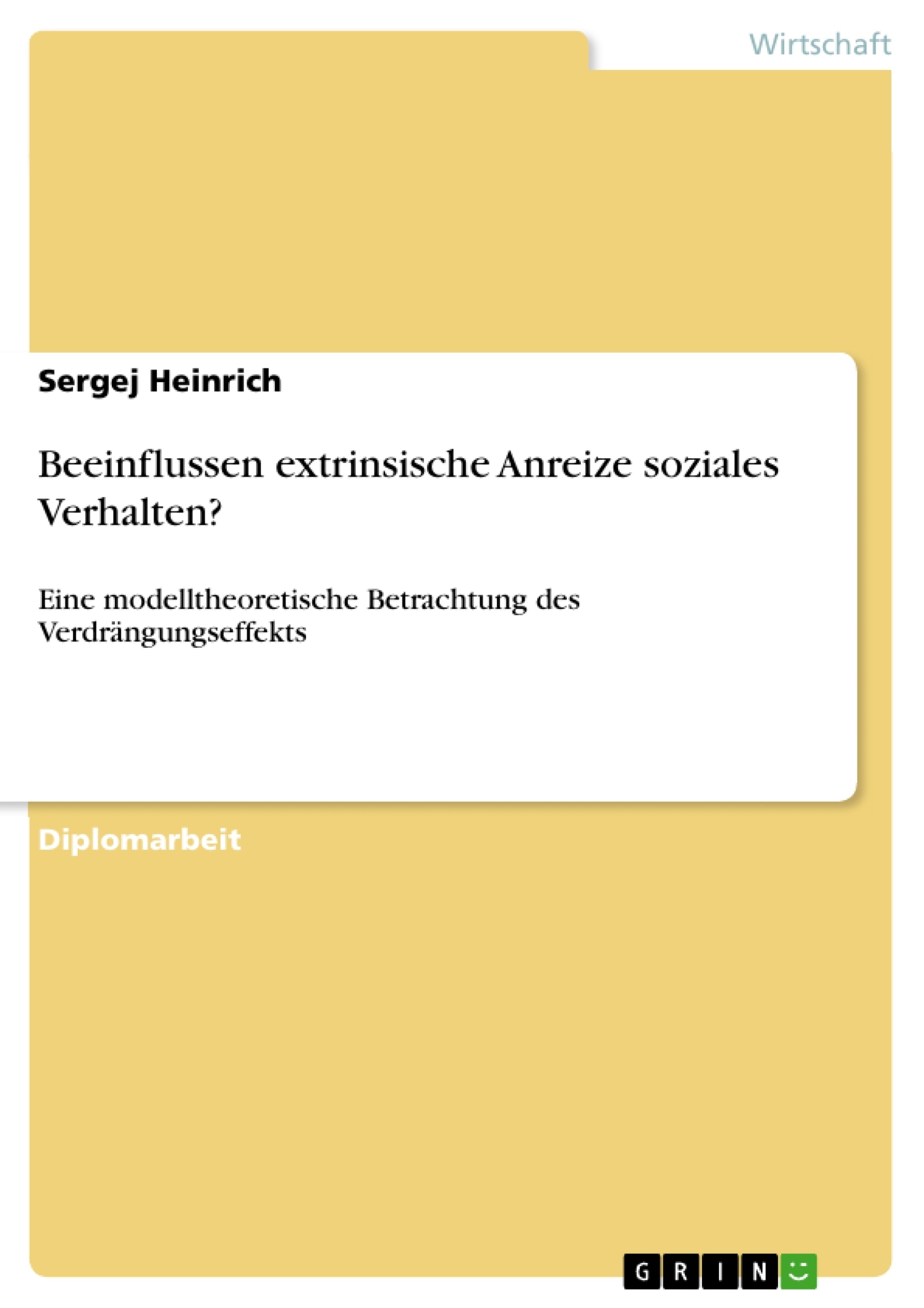„Öffentliche Beteiligung ist eine wichtige Quelle der Entwicklung der Zivilgesellschaft und unserer Gesellschaft überhaupt, aber erst das freiwillige Engagement beschreibt als Handlungsbegriff den innersten Kern der Zivilgesellschaft“ (Monitor Engagement, S. 14)
Das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist zu einem wichtigen Stützpfeiler unserer Gesellschaft geworden. Im Jahr 2009 gaben 36% der im Freiwilligensurvey Befragten an, dass sie sich regelmäßig engagieren, und damit soziale Aufgaben verbindlich und unentgeltlich übernehmen (Monitor Engagement, 2010: 16). Dieser relativ hohe Anteil an ehrenamtlich Engagierten ist aus volkswirtschaftlicher Sicht deshalb bemerkenswert, weil die Anreize zum Trittbrettfahren, d.h. der Nutzung der sozialen Angebote ohne einen eigenen, persönlichen Beitrag zu leisten, sehr hoch sind (Ariely et al., 2009: 544). Das in vielen älteren volkswirtschaftlichen Modellen postulierte Bild von einem Homo Oeconomicus, des stets rational handelnden und nur seinen persönlichen Nutzen maximierenden Egoisten, ist mit diesen und vielen weiteren täglichen Beobachtungen nicht vereinbar.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Formen der Motivation
2.1 Intrinsische und extrinsische Motivation
2.2 Image Motivation
2.3 Motivation für soziales Verhalten
3. Verhaltensänderung durch extrinsische Anreize
3.1 Verdrängung der intrinsischen Motivation
3.1.1 Die verborgenen Kosten von Belohnungen
3.1.2 Darstellung des Preis- und Verdrängungseffekts nach Frey
3.2 Verdrängung der Image Motivation
3.2.1 Reputationswirkung extrinsischer Anreize
3.2.2 Einfluss der Sichtbarkeit
3.2.3 Signalwirkung monetärer Anreize
3.2.4 Informationsökonomische Modellierung des Korrumpierungseffekts
3.2.5 Kleine Anreize – große Wirkung?
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
6. Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 – Anstrengungsniveau in Abhängigkeit eines externen (monetären) Anreizes
Abbildung 2 – Wirkung des Verdrängungseffekts
Abbildung 3 – Partizipationsentscheidung (ohne monetäre Anreize)
Abbildung 4 – Partizipationsentscheidung (mit monetären Anreizen, ohne Reputationsbedenken)
Abbildung 5 – Anstrengungsniveau in Abhängigkeit von einem monetären Anreiz, Variation von
Abbildung 6 – Durchschnittliche Spendenhöhe
Abbildung 7 – Anstrengungsniveau in Abhängigkeit von einem monetären Anreiz, Variation von
1. Einleitung
„Öffentliche Beteiligung ist eine wichtige Quelle der Entwicklung der Zivilgesellschaft und unserer Gesellschaft überhaupt, aber erst das freiwillige Engagement beschreibt als Handlungsbegriff den innersten Kern der Zivilgesellschaft“ (Monitor Engagement, S. 14)
Das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist zu einem wichtigen Stützpfeiler unserer Gesellschaft geworden. Im Jahr 2009 gaben 36% der im Freiwilligensurvey Befragten an, dass sie sich regelmäßig engagieren, und damit soziale Aufgaben verbindlich und unentgeltlich übernehmen (Monitor Engagement, 2010: 16). Dieser relativ hohe Anteil[1] an ehrenamtlich Engagierten ist aus volkswirtschaftlicher Sicht deshalb bemerkenswert, weil die Anreize zum Trittbrettfahren, d.h. der Nutzung der sozialen Angebote ohne einen eigenen, persönlichen Beitrag zu leisten, sehr hoch sind (Ariely et al., 2009: 544). Das in vielen älteren volkswirtschaftlichen Modellen postulierte Bild von einem Homo Oeconomicus, des stets rational handelnden und nur seinen persönlichen Nutzen maximierenden Egoisten, ist mit diesen und vielen weiteren täglichen Beobachtungen nicht vereinbar.
Die Motive für soziales Engagement können ebenso vielseitig sein wie die ausgeübten Tätigkeiten selbst. Der Freiwilligensurvey 2010 listet insgesamt 14 Tätigkeitsbereiche auf[2]. Es werden darin ehrenamtliche Aktivitäten erfasst, welche einen öffentlichen Charakter besitzen und zu einem bestimmten Grad organisiert sein müssen (Monitor Engagement, 2010: 14). Der Engagement -Begriff der vorliegenden Arbeit ist wesentlich breiter gefasst: Jede Anstrengung, die primär darauf ausgerichtet ist, den Nutzen anderer Personen zu steigern, wird in der Folge als prosozial betrachtet. Selbst wenn Menschen beispielsweise davon absehen, für ein Vergehen zu bestrafen, handeln sie in diesem Sinne sozial (Bénabou & Tirole 2006: 1656). Diese Verallgemeinerung erleichtert die modelltheoretische Betrachtung.
Doch welche Ursachen hat prosoziales Verhalten überhaupt? Menschen versuchen durch soziales Handeln, genauso wie durch jede andere Handlung, aus Sicht des motivationstheoretischen Ansatzes, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Innere und äußere Anreize können diese Bedürfnisse[3] aktivieren und zu einer Anstrengungsentscheidung führen (Holtbrügge, 2010: 13). Die Untersuchung der Motive für ein soziales Verhalten ist ein wichtiger Teil der vorliegenden Arbeit und findet sich in Kapitel 2.
Vielfach wird u.a. von staatlichen Institutionen der Versuch unternommen, prosoziale Handlungen in der Gesellschaft stärker zu unterstützen. Finanzielle Anreize, wie z.B. steuerliche Vorteile für eine ehrenamtliche Tätigkeit oder direkte Markteingriffe, wie die Abnahmepflicht von Strom aus regenerativen Energiequellen im Erneuerbare-Energien Gesetz (§2 EEG), sollen dazu beitragen, sozial und ökologisch erwünschtes Verhalten in der Bevölkerung zu fördern. Dabei stellt sich aus wirtschaftlicher Sicht die Frage nach der Effektivität und Effizienz dieser Maßnahmen: Führen die oben erwähnten finanziellen Anreize, wie es die klassische Volkswirtschaftslehre prognostiziert, zu einem Anstieg des Anstrengungsniveaus oder können diese externen Eingriffe gar zu einem Rückgang der intrinsischen Motivation führen, wie es von einigen Verhaltensforschern prognostiziert wird?
Diese gegensätzlichen Positionen versucht Bruno Frey (1997) in einem informellen Modell zu vereinen. Die Herleitung dieses Konstrukts im ersten Teil des dritten Kapitels dient dazu, die aus der Psychologie stammende Hypothese des Verdrängungseffekts[4] zu formalisieren.
Roland Bénabou und Jean Tirole (2006) kommen mit ihrem informationsökonomischen Modell in Bezug auf den Verdrängungseffekt zu ähnlichen Ergebnissen wie Frey. Ihr Ansatz unterscheidet sich jedoch in einigen entscheidenden Punkten von den Annahmen und Prognosen Freys. Die Analyse der wichtigsten aus dem Modell hergeleiteten Hypothesen und empirischen Ergebnisse ist der Kern dieser Arbeit.
Die Gegenüberstellung und Betrachtung der beiden Erklärungsansätze des Verdrängungseffekts ist Teil des zweiten Abschnitts des dritten Kapitels. Das vierte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder in diesem Bereich, die von wissenschaftlichem Interesse sein können.
2. Formen der Motivation
Menschen entscheiden sich für eine Handlung, wenn sie diese wertschätzen, oder wenn sie sich durch einen starken externen Zwang zu ihr genötigt fühlen (Ryan & Deci, 2000: 69). Der innere Antrieb, eine soziale Handlung vorzunehmen, kann durch äußere Umstände verstärkt oder beeinträchtigt werden. Da Motivation nicht direkt beobachtet werden kann, ist eine Analyse von Anreizen, Umweltbedingungen und der darauf folgenden Reaktionen notwendig, um auf die entsprechenden Handlungsmotive Rückschlüsse ziehen zu können. Motivation ist damit ein hypothetisches Konstrukt, welches erklärt, wie das Zusammenspiel zwischen Motiven, Wertvorstellungen und situativen, äußeren Faktoren zu einem zielorientierten Handeln führt (Holtbrügge, 2010: 13f).
Viele Beiträge in der psychologischen und sozialwissenschaftlichen Forschung beschäftigten sich in den vergangen Jahrzehnten damit, den Motivationsbegriff präzise zu definieren und zu untersuchen, wie Motivation generiert und erhalten werden kann. Die verschiedenen Beweggründe werden meist in drei Kategorien unterteilt: intrinsische, extrinsische und reputationsbasierte Motivation (Ariely et al., 2009: 544). Sie sollen in den folgenden Abschnitten näher untersucht werden und dazu dienen, die Reaktionen von Agenten auf extrinsische Anreize später modellieren zu können.
2.1 Intrinsische und extrinsische Motivation
Das im Folgenden betrachtete Konzept der intrinsischen Motivation wird häufig angewandt, um menschliches Verhalten zu erklären. Es lässt sich auf die Arbeiten von DeCharms und Deci zurückführen (Frey, 1997: 14) und wird herangezogen, um einige der interessantesten Beobachtungen aus den Versuchslaboren und dem täglichen Leben zu erklären. In weiten Teilen der psychologischen Forschung hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass Menschen durch intrinsische und extrinsische Motive in ihrem Handeln geleitet werden (Frey & Oberholzer-Gee, 1997: 743).
Als einer der ersten beobachtete Harlow in seinen Experimenten mit Rhesusaffen, dass diese sich mit einem komplexen Puzzle auch noch weiter beschäftigten als es keine erkennbaren äußeren Anreize mehr in Form von Futter gab (Harlow et al., 1950: 231). Der daraus abgeleitete innere Antrieb, ausgelöst und verstärkt durch die Verrichtung der Tätigkeit, konnte dadurch zum ersten Mal wissenschaftlich erfasst, jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht erklärt werden. Es blieb die Frage nach den konkreten Gründen für Handlungen, die scheinbar nicht durch äußere Umstände und biologische Triebe motiviert zu sein schienen. Spätere Untersuchungen schienen Harlows Beobachtungen auch bei Menschen zu bestätigten und waren die Grundlage für ein theoretisches Konstrukt, das intrinsisches Verhalten erklären sollte.
Das Verhalten einer Person wird als intrinsisch motiviert bezeichnet, wenn diese Person keine erkennbare Belohnung erhält außer derjenigen, die sie durch die Ausführung der Handlung selbst erfährt (Deci, 1971: 105). Ist die intrinsische Motivation lediglich auf die Maximierung des persönlichen Nutzens ausgerichtet, so werden die Präferenzen des Individuums als hedonistisch bezeichnet (Frey & Oberholzer-Gee, 1997: 743). Die Ausübung eines persönlichen Hobbys, wie zum Beispiel einer Sportart, dient folglich dem persönlichen Wohlbefinden des Individuums.
Sorgt sich das Individuum hingegen um das Wohlergehen anderer Personen, werden seine Präferenzen als prosozial bezeichnet. Die Motivation bzw. viel mehr die tatsächliche Handlung werden als „Ausdruck einer internalisierten sozialen Norm“ (Holtbrügge, 2010: 14) betrachtet. Das Individuum verhält sich in einer bestimmten (sozialen) Art und Weise, weil es entweder darauf hofft, dass sein Gegenüber sich gleichermaßen verhält (Reziprozität) oder weil es eine ausgeprägte altruistische Veranlagung besitzt (Holtbrügge, 2010: 14). Ein Individuum mit puren altruistischen Präferenzen versucht durch sein Engagement den Nutzen anderer Personen zu steigern, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten (Bénabou & Tirole 2006: 1657). Altruismus ist folglich eine Sonderform der intrinsischen Motivation. Frühe ökonomische Modelle berücksichtigten diese in der Psychologie und Soziologie etablierten Verhaltenstreiber zunächst nicht.
Bei extrinsisch motivierten Individuen wird angenommen, dass stets eine externe, kontrollierende Variable identifiziert werden kann, die das Handeln der Individuen steuert, und die selbst nicht Teil der Aktivität ist (Cameron & Pierce, 1994: 364). Das Individuum reagiert auf äußere Einflüsse, die sowohl materieller (Geld, Prämien, Steuern, Bußgelder etc.) als auch immaterieller Art (Lob, Anerkennung, Beleidigung) sein können. Die materiellen Anreize haben stets eine instrumentelle Funktion, da sie erlauben, (Konsum-)Bedürfnisse durch die verrichtete Tätigkeit zu befriedigen (Holtbrügge, 2010: 14). Der Prinzipal kann die extrinsische Motivation des Agenten bei der Konzipierung von Anreizsystemen nutzen, um erwünschtes Verhalten zu generieren.
Ein ökonomisches Modell, welches individuelles Verhalten prognostiziert, wie z.B. das Prinzipal-Agenten Modell, ermöglicht die Deduktion einer optimalen extrinsischen Anreizintensität. Die in der Realität häufig beobachteten Abweichungen vom hypothetisch optimalen Verhalten lassen jedoch darauf schließen, dass die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Motivationsformen einen entscheidenden Einfluss auf die individuelle Entscheidung haben. Klassische mikroökonomische Modelle unterscheiden selten zwischen den verschiedenen Motivationsformen, da Motivation lediglich als ein Ausdruck von entsprechenden Präferenzen formuliert wird. Intrinsische Motivation wird dann als eine exogen gegebene Konstante modelliert (Frey & Jegen, 2001: 591).
Doch welcher Impuls oder welche Motive sind für das Verhalten des Individuums letztlich verantwortlich? Diese Frage lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. Ein Problem ist, dass der Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation in den meisten Fällen nicht trennscharf zu bestimmen ist (Frey & Jegen, 2001: 591). Es wird vermutet, dass die beiden Motivationsformen häufig gemeinsam auf die Handlungsentscheidung des Individuums einwirken. Deshalb ist es wichtig, die Wechselwirkungen zwischen den Motivationsformen in einem theoretischen Modell zu untersuchen (Frey, 1997: 14). Selbst wenn offensichtlich kein extrinsischer Anreiz in einer betrachteten Situation festgestellt werden kann, ist es durchaus möglich, dass sich eine Person in Erwartung einer zukünftigen extrinsischen Belohnung entsprechend verhält. Demnach kann ein auf den ersten Blick intrinsisches Verhalten in Wahrheit von extrinsischen Motiven geleitet worden sein (Cameron & Pierce, 1994: 364). Jedoch ist dabei weniger die eindeutige Unterscheidung der einzelnen Motive von Bedeutung, sondern vielmehr das Verständnis der systematischen Beziehung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation (Frey, 1997: 14).
2.2 Image Motivation
Menschliches Verhalten geschieht in den meisten Fällen nicht in einem isolierten privaten Raum. Handlungen, wie z.B. Blutspenden, Verbrechen oder freiwilliges Engagement, werden häufig beobachtet und in Abhängigkeit von kulturellen und sozialen Umständen gedeutet und bewertet. Verhält sich eine Person in den Augen einer anderen gut und ist der betreffenden Person die persönliche Reputation wichtig, dann kann diese Image bzw. Signalling Motivation einen positiven Einfluss auf das Verhalten haben (Ariely et al., 2009: 544).
Informationsasymmetrien, die bei den meisten Markttransaktionen auftreten, verhindern, dass die persönlichen Einstellungen und Motive direkt sichtbar werden. Individuen können deshalb ein Interesse daran haben, durch ein bestimmtes Verhalten ihre inneren Motive nach außen zu signalisieren, um von einer besseren Reputation zu profitieren (Ariely et al., 2009: 546). Wird eine Person z.B. dabei beobachtet, wie sie ohne erkennbare äußere Einflüsse eine soziale Handlung vornimmt, so wird aus diesem Verhalten geschlossen, dass die Person die Handlung aus altruistischen Gründen durchführt (Bem, 1972: 2). Wenn eine altruistische Einstellung in der Gesellschaft positiv gewertet wird, so kann die Person von einer höheren Reputation dazu motiviert werden die Handlung auch in Zukunft auszuführen.
Für einen Agenten ist es darüber hinaus ebenso wichtig ein positives persönliches Selbstbild zu besitzen. Demnach kann nicht nur die Meinung Dritter zu einer veränderten Image Motivation führen, sondern auch die persönliche Bewertung von Handlungen.
Es ist wichtig zu erkennen, dass die drei Motivationsformen nicht isoliert voneinander analysiert werden können. Die Image Motivation ist vielmehr ein Produkt der beiden anderen Motive. Um zu verstehen, welche Gründe ein bestimmtes Verhalten hat, müssen die wechselseitigen Abhängigkeiten und Einflüsse der einzelnen Motivationsarten analysiert werden. Dies geschieht im folgenden Abschnitt.
2.3 Motivation für soziales Verhalten
Das Modell von Bénabou & Tirole (2006) fasst einige wichtige Vorstellungen und Überlegungen zu den verschiedenen Motivationsformen in einem holistischen Konstrukt zusammen, welches in diesem Abschnitt erläutert wird.
In der modelltheoretischen Ausgangssituation steht ein Agent stets vor der Entscheidung, ob er sich überhaupt sozial verhalten soll bzw. wie groß sein Einsatz sein soll. Dieses Engagement kann sowohl altruistisch motiviert sein als auch darauf abzielen, den persönlichen Konsum von privaten Gütern zu maximieren. Das Anstrengungsniveau des Agenten kann in Zeit- sowie in Geldeinheiten ausgedrückt werden und sowohl eine diskrete als auch eine kontinuierliche Form annehmen (Bénabou & Tirole 2006: 1656). Es ist intuitiv nachvollziehbar, dass jede Handlung und damit auch das soziale Engagement des Agenten mit Kosten verbunden ist. Diese Kosten sind entweder direkte Kosten, wie sie z.B. bei der Anschaffung einer speziellen Ausrüstung für den Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr anfallen, oder indirekte Opportunitätskosten entgangener Verdienstmöglichkeiten. Der Agent wählt eine Handlung unter Berücksichtigung der Kosten , um seinen Nutzen zu maximieren bzw. um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Für jede Handlung können folglich verschiedene Motive bzw. Bedürfnisse verantwortlich sein.
Die intrinsische Motivation, sich sozial zu engagieren, wird auf eine altruistische Neigung des Agentenzurückgeführt (Bénabou & Tirole, 2006: 1657). Damit ist es implizit ein Ausdruck der Wertschätzung des persönlichen sozialen Engagements durch den Agenten selbst. James Andreoni (1989) unterscheidet zwischen dem reinen und dem unreinen Altruismus.
Für einen Agenten dessen intrinsische Motivation auf eine reine altruistische Einstellung zurückzuführen ist, zählt lediglich das Gesamtangebot des öffentlichen Gutes (Andreoni, 1989: 1449), wobei für die Anzahl der Personen innerhalb einer betrachteten Gruppe steht und für den durchschnittlich geleisteten Beitrag zum öffentlichen Gut. Abhängig von seinem persönlichen Anteil an diesem öffentlichen Gut, wertschätzt der Agent seinen eigenen Beitrag mit .
Der unreine Altruismus speist sich aus dem eigennützigen Bestreben des Agenten, sich in einem guten Licht[6] präsentieren zu wollen bzw. sich selbst durch eine wohltätige Aktion besser zu fühlen (Andreoni, 1989: 1449).
Die Überlegung, dass ein eigennütziges, intrinsisches Bestreben von einem Beobachter negativ gewertet werden könnte, stellen Bénabou und Tirole nicht explizit an. Sie modellieren den unreinen Altruismus lediglich als positive Freude am Geben, die in ihrem Modell mit als exogen und fix angenommen wird (Bénabou & Tirole, 2006: 1657). Intrinsisch motiviertes Verhalten, das lediglich egoistischen Zielen dient, z.B. der Steigerung der Jobchancen durch ein freiwilliges Engagement, kann von externen Beobachtern bzw. vom Agenten selbst als ein negatives Signal interpretiert werden. In der Folge könnte die Motivation für die Handlung sinken.
In den meisten Fällen wird davon ausgegangen, dass beide Formen des Altruismus Einfluss auf die intrinsische Motivation des Agenten nehmen können (Andreoni 1989: 1449). Formal werden die beiden intrinsischen Motivationsbestandteile folgendermaßen beschrieben:
In sehr großen Gruppen, in denen jedes Individuum den gleichen Einfluss auf das öffentliche Gut hat, wird der zweite Teil der Gleichung sehr klein und (Bénabou & Tirole, 2006: 1657). Die intrinsische Motivation würde sich dann vollständig aus dem unreinen Altruismus speisen, also dem hedonistischen Bestreben des Agenten durch die wohltätige Handlung einen höheren privaten Nutzen zu erhalten.
Der Prinzipal kann dem Agenten als (Aufwands-) Entschädigung für dessen soziale Aktivität einen monetären Anreiz anbieten, mit der der Agent wiederum private Güter erwerben und konsumieren kann. Bei diesem Anreiz kann es sich um eine (finanzielle) Aufwandsentschädigung, eine Steuerersparnis, verbale Anerkennung oder um sonstige materielle oder immaterielle Güter handeln. Alternativ kann auch als eine Strafzahlung bzw. Steuer ausgelegt werden, sofern das Vorzeichen negativ ist. Damit kann der Prinzipal erreichen, dass unerwünschte, unsoziale Handlungen unterlassen werden.
Inwiefern der Agent Geld bzw. den daraus abgeleiteten Konsum privater Güter wertschätzt, wie hoch demnach seine extrinsische Motivation ist, wird mit der Variable im Modell erfasst (Bénabou & Tirole 2006: 1658).
Für welches Engagement der Agent sich entscheidet, hängt dabei von seinem individuellen Typ bzw. seinen Präferenzen und von dem extrinsischen Anreiz ab. Es wird angenommen, dass die Präferenzen in der Bevölkerung normalverteilt sind, mit der Dichte, den Erwartungswerten und, der Varianz und der Kovarianz :
Der Agent ist sich darüber im Klaren, dass sein (un-)soziales Handeln und die Werte, die damit assoziiert sind, von Außenstehenden beobachtet und beurteilt werden. Ein bestimmtes Verhalten wird demnach einem Typ Mensch zugeordnet. Wenn jemand beispielsweise Geld spendet, oder sich ehrenamtlich engagiert, wird er in der Folge als großzügig und sozial eingeschätzt; folglich als eine Person mit einer hohen intrinsischen Motivation . Diese Einschätzung durch seine Umwelt, kann für den Agenten von großer Bedeutung sein. Er erhält einen höheren Nutzen, wenn er weiß, dass seine Umwelt seine sozialen Handlungen wertschätzt (Ariely et al., 2009: 545). Ferner möchte er sich auch selbst bei der Handlung wohl fühlen.
Da davon ausgegangen wird, dass Individuen ex-post nicht genau nachvollziehen können, aus welchen intrinsischen oder extrinsischen Gründen sie eine Handlung begangen haben, dient ihnen ihre Handlung und die angebotene Vergütung als Anhaltspunkt dafür, welche Präferenzen sie tatsächlich besitzen (Bem, 1972: 2). Demnach befinden sich Agenten häufig in der gleichen Situation wie externe Beobachter: verschiedene Faktoren führen letztlich dazu, dass die beobachteten Handlungen darüber Aufschluss geben, welche Motive den Agenten geleitet haben (Bem, 1972: 8). Diese Positionen entstammen der Selbstwahrnehmungstheorie von Bem, die ebenfalls in das Modell von Bénabou und Tirole einfließen.
Das durch die soziale Handlung erzeugte Bild des Agenten kann darüber hinaus einen instrumentellen Charakter besitzen, indem z.B. die Karrierechancen oder die Chancen auf dem Partnermarkt des Agenten erhöht werden (Seabright, 2009: 9). Eine überdurchschnittlich starke Ausprägung der intrinsischen Motivation wird demnach in der Regel vom internen und externen Beobachter positiv bewertet. Umgekehrt will der Agent in den meisten Fällen nicht als geldgierig und geizig dastehen. Eine starke Orientierung an extrinsischen Anreizen , d.h. ein hoher marginaler Nutzengewinn aus einer zusätzlichen Konsumeinheit wird in vielen Kulturen negativ bewertet (Bénabou & Tirole, 2006: 1658).
Die externen und internen Bewertungen der persönlichen Präferenzen des Agenten werden mit den Parametern und wiedergegeben, wobei das Vorzeichen des letzteren meist negativ ist. Je positiver ein bestimmtes altruistisches Verhalten in der Gesellschaft bewertet wird, desto größer ist der Wert . Manche Aktivitäten, wie z.B. eine Organspende, genießen in der Gesellschaft eine höhere Bewunderung als andere, wie z.B. die Mitgliedschaft in einem Golfclub. Des Weiteren ist anzunehmen, dass insbesondere in der kurzen Frist relativ konstante gesellschaftliche und kulturelle Werte in diese Variablen einfließen (Holtbrügge, 2010: 13).
Darüber hinaus ist die Sichtbarkeit der Handlung von großer Bedeutung. Wenn das Engagement öffentlich ist bzw. wenn sich der Agent mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in Zukunft an seine Tat erinnern kann, so verstärkt sich die Wirkung der Gewichtungsfaktoren und zusätzlich. Die beschriebenen Reputationseffekte lassen sich formal folgendermaßen darstellen:
Der Prinzipal und der Agent bilden jeweils Erwartungen hinsichtlich des Agententyps, nachdem sie das endogene Anstrengungsniveau und den extrinsischen Anreiz, der dem Agenten exogen angeboten wird, betrachtet haben. Diese Annahme wird im Modell durch die bedingten Erwartungswerte dargestellt.
Diese Ansicht ist aus der oben formulierten Selbstwahrnehmungstheorie nach Bem abgeleitet. Die Einschätzung des persönlichen Typs ist für den Agenten von Bedeutung, da er bei einer positiven Bewertung seiner intrinsischen Motivation einen zusätzlichen Nutzen aus seiner Handlung in Form einer besseren Reputation (höheres ) erhält. Es gilt zu beachten, dass wenn der Prinzipal bzw. der Agent im Nachhinein nicht in der Lage sind, die soziale Handlung zu beobachten, sie die durchschnittlichen Ausprägungen der Präferenzen in der Bevölkerung als Grundlage für die Bewertung der Handlung des Agenten heranziehen.
Im Gegensatz zu früheren motivationstheoretischen Modellen werden nun nicht nur die intrinsischen und extrinsischen Anreize in der Nutzenfunktion des Agenten berücksichtigt, sondern auch der Einfluss der Reputation. Es gibt empirische Hinweise, die belegen, dass ein extrinsischer Anreiz von Seiten des Prinzipals die intrinsische Motivation des Agenten unterminieren könnte (Frey & Jegen, 2001: 596). Wie dieser Verdrängungseffekt auf die intrinsische bzw. Image Motivation wirken kann wird im Folgenden untersucht.
3. Verhaltensänderung durch extrinsische Anreize
In dem folgenden Kapitel werden zwei verschiedene Erklärungen für den sog. Verdrängungseffekt modelltheoretisch hergeleitet. Während Frey (1997) davon ausgeht, dass ein externer, monetärer Anreiz dazu führen kann, dass die intrinsische Motivation direkt reduziert wird (Gneezy & Rustichini, 2000: 802), formulieren Bénabou und Tirole (2006) ein Modell, in dem eine Verhaltensänderung auch auf einen Rückgang der Image Motivation zurückgeführt werden kann. Beide Ansätze spielen für das Verständnis des Verdrängungseffekts eine zentrale Rolle.
3.1 Verdrängung der intrinsischen Motivation
Eltern, Lehrer, Vorgesetzte, gemeinnützige Organisationen und staatliche Institutionen versuchen durch die Festlegung extrinsischer Anreize das Verhalten von Individuen (Arbeitnehmern, Kindern, etc.) in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken. Vergehen werden bestraft, kooperatives und soziales Verhalten wird in der Regel belohnt. Es wird vermutet, dass der Einsatz dieser Mittel zu einem falschen Zeitpunkt oder unter unpassenden Umständen jedoch dazu führen kann, dass die betreffenden Personen eine Belohnung bzw. eine Strafe anders als intendiert interpretieren und ihre intrinsische Motivation eine Handlung vorzunehmen bzw. zu unterlassen, untergraben wird (Frey, 1997: 7). Die Umweltbedingungen und die inneren, kognitiven Prozesse, die zu einer Verdrängung der intrinsischen Motivation durch extrinsische Anreize führen sollen, werden im Folgenden genauer analysiert. Dabei wird zunächst nicht freiwilliges oder prosoziales Verhalten im Speziellen, sondern die intrinsische Motivation im weiteren Sinne betrachtet.
Aufbauend auf frühen Überlegungen zur Selbstwahrnehmung und Laborexperimenten wurden in der psychologischen Forschung Theorien entwickelt, die sich mit den verborgenen Kosten von Belohnungen auf die intrinsische Motivation auseinandersetzten. Diese werden im folgenden Abschnitt näher untersucht und mit empirischen Ergebnissen abgeglichen. Im Anschluss wird ein Modell formuliert, welches die Vorstellungen über das Zusammenwirken von extrinsischen Anreizen und intrinsischer Motivation darstellt.
3.1.1 Die verborgenen Kosten von Belohnungen
Seit den frühen 1970er Jahren wurden zunächst von Psychologen, später auch von Ökonomen, zahlreiche Feldstudien und (Labor-)Experimente durchgeführt, um zu überprüfen, ob durch die Einführung extrinsischer Anreize die intrinsische Motivation und das Anstrengungsniveau von Menschen beeinträchtigt wird. Deci (1971) beobachtete in einem Experiment mit Psychologiestudenten, dass diejenigen Versuchspersonen, die für das Lösen eines komplexen Puzzles (sog. Soma-Puzzle) finanziell belohnt wurden, ihr zu Beginn vorhandenes intrinsisches Interesse mit der Zeit verloren (Deci, 1971: 110). Aufgrund der relativ kleinen Stichprobe (n= 24) und der fehlenden statistischen Signifikanz der Resultate wurden die Ergebnisse kritisch betrachtet (Cameron & Pierce, 1994: 365), jedoch als erste Hinweise für das Vorhandensein eines Verdrängungseffekts gedeutet. Deci führte die Ergebnisse auf eine veränderte Situationsbewertung zurück, durch die sich die Aktivität von einer unbezahlten, freiwilligen Tätigkeit zu einer vergüteten entwickelte (Deci, 1971: 114).
Seine Erkenntnisse formuliert Deci zu der sog. Cognitive Evaluation Theory. Demnach führen Situationen, in denen die vom Individuum wahrgenommene persönliche Kompetenz und Autonomie eingeschränkt werden, zu einer Verringerung der intrinsischen Motivation (Eisenberger & Cameron, 1996: 1155).
Mark R. Lepper, David Greene und Richard E. Nisbett (1973) untersuchten in einem Feldexperiment mit Kindergartenkindern, wie sich ein anfängliches, intrinsisches Interesse durch die Aussicht auf eine extrinsische Belohnung veränderte. Sie testeten explizit die aus der Selbstwahrnehmungstheorie abgeleitete Korrumpierungshypothese, nach der Individuen ihre intrinsische Motivation abwerten, sobald für ihre Handlung sichtbare extrinsische Anreize angeboten werden (Lepper et al., 1973: 130). Diese Abwertung wird damit erklärt, dass die Individuen bei einer rückblickenden Betrachtung ihrer Handlung nicht mehr genau feststellen können, welche Gründe tatsächlich für ihr Verhalten verantwortlich waren. Der Korrumpierungshypothese zu Folge kommen Menschen bei ausreichend großen, äußeren Einflüssen zu der Erkenntnis, dass sie allein durch die extrinsischen Anreize geleitet wurden (Bem, 1972: 39), obwohl ursprünglich intrinsische Motive hätten vorliegen können. Wenn der extrinsische Anreiz dann wieder entfernt werden würde, wäre der ursprüngliche Grund für die Aktivität, das intrinsische Interesse, bereits vollständig korrumpiert, d.h. untergraben worden. Nach Abschluss der rückblickenden Betrachtung entscheidet das Individuum über seine zukünftigen Handlungen. Das Anstrengungsniveau sinkt unter das ursprüngliche Niveau.
Die im Experiment von Lepper et al. (1973) analysierte Aktivität war das Malen mit speziellen bunten Stiften. Kinder, die ohne jeglichen äußeren Einfluss anfingen, mit den Stiften zu malen, wurden als Versuchsteilnehmer identifiziert. Bei ihnen wurde vermutet, dass sie über ein intrinsisches Interesse an der Handlung verfügten (Lepper et al., 1973: 132). Übertragen auf die bisherigen Überlegungen zur intrinsischen Motivation kann die Ausprägung des anfänglichen Interesses mit der Variable umschrieben werden. Es muss kritisch angemerkt werden, dass nicht die intrinsische Motivation in solchen Experimenten direkt gemessen wurde, sondern die vermutlich durch sie ausgelöste Verhaltensänderung.
Nach dieser Identifikationsphase wurden die Kinder für die folgenden Beobachtungsphasen per Zufall drei verschiedenen Versuchsgruppen zugeordnet: Kindern, die in die erste Gruppe kamen, wurde für das Malen eines Bildes eine Belohnung in Aussicht gestellt[7]. Die zweite Gruppe von Kindern erhielt unerwartet die gleiche Belohnung, während die dritte Gruppe als Kontrollgruppe genutzt wurde, der keine Anreize und Belohnungen angeboten wurden. Nach 1-2 Wochen wurde die Aktivität den Kindern wieder angeboten. Die Veränderung der intrinsischen Motivation wurde anhand der Reaktion der Kinder auf die wieder angebotenen Buntstifte gemessen. Dieser dreigliedrige Versuchsaufbau[8] wurde häufig in solchen Experimenten verwendet.
Die Autoren stellten, wie von ihnen prognostiziert, fest, dass die Kinder, die sich in der ersten Versuchsgruppe befanden, in der letzten Beobachtungsphase weniger Zeit mit Malen verbrachten. Die Kinder in der zweiten und dritten Gruppe zeigten hingegen ein unverändert hohes Interesse. Darüber hinaus stellte eine Jury fest, dass die Qualität des Gemalten in der ersten Gruppe schlechter war, während bei den anderen beiden Gruppen Quantität und Qualität des Gemalten unverändert blieben (Lepper et al., 1973: 135).
In diesen statistisch signifikanten Ergebnissen sahen die Autoren einen Hinweis für die negative Wirkung von (erwarteten) Belohnungen auf die intrinsische Motivation von Individuen (Lepper et al., 1973: 135). Sie warnten jedoch nachdrücklich vor einer Verallgemeinerung ihrer Ergebnisse: Das Experiment diente der Illustration des bis dahin lediglich vermuteten Korrumpierungseffekts. Eine generelle Aussage, dass Belohnungen stets zu einer Verringerung der intrinsischen Motivation führten, ließe sich nicht aus den Ergebnissen des Experiments ableiten (Lepper et al., 1973: 136). Der Korrumpierungseffekt als eine mögliche Ursache für den Verdrängungseffekt konnte hingegen genauer beschrieben werden.
Als Reaktion auf diese ersten Experimente beschäftigte sich eine Vielzahl von Studien mit dem Nachweis und der Messung des Verdrängungseffekts. Insbesondere die Unterschiede bei der Konzeptionierung der Experimente und bei der Messung der intrinsischen Motivation, sowie der extrinsischen Anreize, führten dazu, dass eine Prognose der Wirkungsrichtung nicht eindeutig war. Abhängig von der Belohnungsart und dem Versuchsaufbau konnten sowohl positive Effekte, z.B. bei mündlichem Lob als auch negative Auswirkungen von Anreizen beobachtet werden (Cameron & Eisenberger, 1996: 1154). Meta-Analysen, die mithilfe statistischer Methoden die Ergebnisse verschiedener Studien zusammenfassen[9], sind in ihren Interpretationen der Forschungsergebnisse ebenfalls nicht konsistent. Während Cameron und Eisenberger wenige Anhaltspunkte dafür finden, dass Belohnungen das intrinsische Interesse negativ beeinflussen (Cameron & Eisenberger, 1996: 1162), unterstützt die Mehrheit der durchgeführten Meta-Analysen die Position, dass unter bestimmten Umständen die Verwendung materieller Anreize einen negativen Einfluss auf die intrinsische Motivation von Individuen haben kann (Frey & Jegen, 2001: 597).
Es gilt zu beachten, dass der Großteil dieser Studien im Bildungs- und Erziehungsbereich durchgeführt wurden. Aus personalökonomischer Sicht ist es jedoch wichtig, zu verstehen, ob die im Berufsalltag häufig verwendeten monetären Anreizmechanismen[10] die tatsächlich intendierte Wirkung entfalten. In diesem Bereich fehlten jedoch lange Zeit beweiskräftige, empirische Hinweise für den Verdrängungseffekt (Prendergast, 1999: 18). Bei leistungsabhängigen Löhnen ist die Vergütung implizit an das Anstrengungsniveau des Agenten gebunden. Je mehr sich ein Individuum anstrengt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine Arbeitsleistung den Anforderungen des Unternehmens entspricht, und desto höher fällt seine Entlohnung aus.
Edward P. Lazear (2000) zeigte anhand eines umfangreichen Datensatzes, dass die Einführung von leistungsabhängigen (Stück-)Löhnen die Produktivität von Arbeitern im Durchschnitt um 44% steigerte (Lazear, 2000: 1353). Unter Verwendung von arbeiterspezifischen Dummy-Variablen wurde die pure Anreizwirkung variabler Vergütung , ausgelöst durch die Umstellung auf den Akkordlohn, deutlich: Um 22% stieg die Anzahl der installierten Autoscheiben (Lazear, 2000: 1353). Aus diesen statistisch signifikanten Ergebnissen schloss Lazear, dass Arbeiter, genau wie von den Standardmodellen der Volkswirtschaftslehre prognostiziert, auf Leistungsanreize mit einer Verhaltensänderung reagieren.
Monetäre Anreize erfüllen demnach ihren intendierten Zweck: Sie steigern im Durchschnitt das Anstrengungsniveau der Arbeiter. Die oben aufgeführten Verhaltenshypothesen von Deci (1971) und Lepper et al. (1973), wonach extrinsische Anreize das Anstrengungsniveau senken könnten, betrachtet Lazear damit als widerlegt (Lazear, 2000: 1347).
Frey und Jegen (2001) kritisieren Lazears Feststellung scharf. Sie argumentieren, dass Lazear in seinen Daten deshalb keinen Verdrängungseffekt feststellen konnte, weil es bei der betrachteten Tätigkeit, dem Einsetzen von Windschutzscheiben, von Anfang an keine bedeutende intrinsische Motivation gegeben hat, die durch den Einsatz extrinsischer Anreize hätte verdrängt werden können (Frey & Jegen, 2001: 596).
Es zeigt sich, dass die Ergebnisse und Theorien hinsichtlich der Auswirkung von extrinsischen Anreizen auf die intrinsische Motivation zu keinen allgemeingültigen Verhaltensprognosen führen. Daher ist nicht die Frage, ob der Verdrängungseffekt stets auftaucht von Interesse, sondern die Umstände, unter denen der Effekt auftritt, müssen näher analysiert werden (Frey, 1997: 16). Um die Verhaltensänderung besser zu verstehen, unterteilt Frey (1997) die Wirkung extrinsischer Anreize in einen Preis- und einen Verdrängungseffekt. Die Darstellung dieser beiden häufig entgegengesetzten Effekte soll im Folgenden näher analysiert werden, da sie für die Entscheidung soziales Verhalten auszuüben von Bedeutung ist.
3.1.2 Darstellung des Preis- und Verdrängungseffekts nach Frey
Frey (1997) verbindet Erkenntnisse aus der psychologischen Verhaltensforschung mit den klassischen volkswirtschaftlichen Theorien, um ein Modell des Homo Oeconomicus Maturus zu formulieren (Frey, 1997: 118). In diesem Modell werden die wechselseitigen Einflüsse der intrinsischen und extrinsischen Motivation berücksichtigt, die auf die Verhaltensentscheidung eines Individuums Einfluss nehmen (Frey & Jegen, 2001: 591). Im Gegensatz zu Bénabou und Tirole betrachtet Frey nicht die Informationsasymmetrien, die durch die eingeschränkte Beobachtung und Deutung des individuellen Verhaltens entstehen. Die bereits in Kapitel 2.3. definierte Reputationskomponente wird deshalb nicht modelliert. Um die im zweiten Kapitel herausgearbeiteten Formulierungen und Variablen weiter nutzen zu können, wird im Folgenden eine leicht abgeänderte Variante des Modells von Frey und Oberholzer-Gee (1997) verwendet. Die Nutzenfunktion eines repräsentativen Individuums lässt sich damit wie folgt formulieren:
An die Stelle der Reputationskomponente tritt eine Variable, welche die intrinsische Motivation des Individuums wiedergibt, seine Bürgerpflicht durch eine soziale Handlung zu erfüllen (Frey & Oberholzer-Gee, 1997: 747). Die intrinsische Motivation speist sich in diesem Fall vollständig aus einer internalisierten sozialen Norm. Ein Individuum maximiert seinen Nutzen durch die Wahl seines Anstrengungsniveaus unter Berücksichtigung seiner Präferenzen und den gegebenen Umweltbedingungen. Er weitet sein Anstrengungsniveau soweit aus bis die Grenzkosten des Engagements dem Grenznutzen entsprechen:
Um die Formalisierung zu erleichtern, wird eine konvexe, zweifach-differenzierbare Kostenfunktion betrachtet, die auch nachfolgend Verwendung findet. Durch diese Funktionsform ist jede marginale Leistungssteigerung mit ansteigenden Kosten für den Agenten verbunden. Daraus folgt[11] für die Wahl des optimalen Anstrengungsniveaus des Individuums:
Es wird deutlich, dass zwei Einflüsse auf das Verhalten bzw. auf die Wahl des Anstrengungsniveaus des Individuums wirken: der Preis- und der Verdrängungseffekt. Diese werden im Folgenden näher betrachtet.
In den klassischen ökonomischen Modellen wird stets davon ausgegangen, dass nur der Preiseffekt einen signifikanten Einfluss auf das Anstrengungsniveau haben kann. D.h. Preissteigerungen für ein Gut bzw. eine Dienstleistung in der Regel[12] zu einem höheren Angebot und einer niedrigeren Nachfrage führen (Mankiw & Taylor 2008: 89).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 – Anstrengungsniveau in Abhängigkeit eines externen (monetären) Anreizes. Klassisches, ökonomisches Ergebnis (vgl. Frey, 1997: 106; allerdings mit vertauschten Achsen, da das Anstrengungsniveau die abhängige Variable ist)
Übertragen auf die Anstrengungsentscheidung eines Individuums, wie in Abbildung 1 dargestellt, sollte eine höhere Vergütung eines Engagements zu einer Steigerung des Anstrengungsniveaus führen (Frey, 1997: 20)[13]. Die meisten ökonomischen Modelle, insbesondere die Prinzipal-Agenten Theorie, basieren auf diesen Vorstellungen des Preismechanismus. Eine intrinsische Motivation wird von Ökonomen zwar nicht ausgeschlossen, jedoch wird sie eher als ein additives Element betrachtet (Frey, 1997: 106). Deshalb kann die intrinsische Motivation in diesen Modellen lediglich für die vertikale Verschiebung des Geradenursprungs verantwortlich gemacht werden (vgl. Abbildung 1).
Frey geht davon aus, dass neben dem Preiseffekt auch ein Verdrängungseffekt durch einen externen Eingriff eintreten kann, der sich auf die intrinsische Motivation und damit auch auf das Anstrengungsniveau auswirkt. Die intrinsische Motivation könnte in diesem Fall durch den externen Eingriff bzw. durch die Erhöhung des monetären Anreizes sinken: . Das Problem an dieser Darstellung bzw. an dem gesamten Konstrukt von Frey (1997) ist, dass die Präferenzen nicht als fix modelliert werden (Frey & Jegen, 2001: 592). Diese Tatsache führt in der aufgezeigten Modellvariante dazu, dass die intrinsische Motivation in Abhängigkeit der subjektiven Wahrnehmung der monetären Belohnung entweder positiv, negativ oder überhaupt nicht durch den externen Eingriff verändert wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 - Wirkung des Verdrängungseffekts (vgl. Frey, 1997: 107)
In Situationen, in denen die intrinsische Motivation eine wichtige Rolle spielt oder sogar die einzige Motivationsquelle ist, kann nach Frey ein externer Eingriff, z.B. die Einführung einer monetären Vergütung, schwerwiegende negative Folgen für die Anstrengungsentscheidung des Agenten haben. Dies ist immer dann der Fall, wenn der äußere Einfluss als kontrollierend vom Agenten wahrgenommen wird (Frey, 1997: 26). Der Verdrängungseffekt führt dann dazu, dass die intrinsische Motivation komplett durch die extrinsische ersetzt wird (Frey, 1997: 107). Abbildung 2 veranschaulicht diesen Effekt: Nachdem die intrinsische Motivation verschwunden ist, wirkt nur noch der Preiseffekt auf das Verhalten ein. Um das ursprüngliche Leistungsniveau (ohne monetären Anreiz) zu erreichen, könnte nun allerdings eine beachtliche monetäre Belohnung erforderlich sein.
Frey benennt drei psychologische Prozesse, die zu einer Verdrängung der intrinsischen Motivation durch extrinsische Anreize führen können, folglich dazu, dass gilt: verminderte Selbstbestimmung, beeinträchtigtes Selbstwertgefühl und eine eigeschränkte Möglichkeit, sich auszudrücken (Frey, 1997: 16). Die Prozesse bzw. die Gründe für den Verdrängungseffekt sind schwer voneinander abzugrenzen, jedoch führen alle drei dazu, dass die intrinsische Motivation durch extrinsische Anreize ersetzt wird. Treten demnach beide Motive auf, kann es zu einer Überrechtfertigung bzw. Korrumpierung der intrinsischen Motivation kommen: Das Individuum empfindet, dass es zu viele Anreize hat, um sich zu engagieren und reduziert in der Folge die Motivation, die es selbst kontrollieren kann (Frey, 1997: 17). Dieses Ergebnis ist ebenfalls mit der Selbstwahrnehmungstheorie nach Bem vereinbar.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht stellt der Verdrängungseffekt damit eine bemerkenswerte Anomalie dar, da er die implizite Verbindung zwischen einem steigenden Preis und einem steigenden Angebot aufhebt oder sogar umkehrt (Frey & Jegen, 2001: 590).
3.2 Verdrängung der Image Motivation
Die in den empirischen Studien beobachteten Verdrängungseffekte, die bei der Einführung extrinsischer Anreize auftraten, können nicht gänzlich mit dem bisher betrachteten Modell erklärt werden. Der von Frey (1997) beschriebene exogene Eingriff, z.B. in Form einer monetären Belohnung und die entsprechende Reaktion spielen zwar auch im folgenden Abschnitt eine Rolle, jedoch werden hier die damit verbundenen kognitiven Prozesse und Mechanismen präzisier formuliert (Ariely et al, 2009: 544).
Neben der intrinsischen Motivation rückten mit der Zeit immer stärker die Beobachtbarkeit und die Bewertung von verschiedenen Verhaltensweisen in der Forschung in den Vordergrund. Diese unterstellte Image-Orientierung der Versuchspersonen spielt insbesondere bei der Analyse von sozialen Aktivitäten eine wichtige Rolle. Dabei wird angenommen, dass das durch altruistisches Verhalten generierte Ansehen, bzw. das gesteigerte Selbstwertgefühl, zu einem höheren individuellen Nutzen führen kann.
Wird ein monetärer Anreiz in einer Situation eingeführt, in der es vorher keine extrinsischen Anreize gab, ist es sowohl für den internen als auch für den externen Beobachter nicht eindeutig feststellbar aus welchen Gründen das soziale Engagement in der Folge unternommen wird. Zwar können immer noch intrinsische Motive ursächlich für die Handlung sein, jedoch wird angenommen, dass sich die Interaktion zwischen intrinsischen und extrinsischen Motiven negativ auf die Image Motivation des Individuums auswirken kann (Bénabou & Tirole, 2006: 1658). Allein die Möglichkeit der persönlichen Bereicherung durch eine vordergründig soziale Handlung verändert die Wahrnehmung des prosozialen Engagements und damit die Motivation für eine Fortführung der Handlung. Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel wird nun die Beeinflussung der Image Motivation als mögliche Ursache für den Rückgang des Anstrengungsniveaus betrachtet und nicht der Rückgang der intrinsischen Motivation. Damit können einige Phänomene besser erklärt werden als mit dem Modell von Frey.
Aufbauend auf den Überlegungen und Annahmen von Bénabou und Tirole (2006) untersuchen jüngere empirische Studien die Reaktionen sozial handelnder Individuen auf extrinsische Anreize. Dan Ariely, Anat Bracha und Stephen Meier (2009) untersuchten in ihrem „Click for Charity“ Experiment, wie stark sich die Sichtbarkeit, die Vergütung und der Zweck einer als sozial empfundenen Handlung auf das individuelle Anstrengungsniveau auswirken.
Jeffrey Carpenter und Caitlin Knowles Myers (2010) untersuchen in ihrer Studie einige Modellprognosen von Bénabou und Tirole (2006) in einem Feldexperiment unter realitätsnahen Bedingungen. Im Gegensatz zu vielen früheren Untersuchungen richten Carpenter und Myers ihren Fokus nicht auf den Bildungsbereich oder die Erziehung; das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr dient ihnen als abhängige Variable.
Die in der psychologischen Forschung vermuteten kognitiven Prozesse und die empirischen Ergebnisse werden im Folgenden eingeordnet und modelltheoretisch analysiert. Es soll letztlich herausgearbeitet werden, unter welchen Bedingungen extrinsische Anreize die intendierte Wirkung besitzen und in welchen Fällen die gegenteilige erreicht wird.
3.2.1 Reputationswirkung extrinsischer Anreize
Anhand von Variationen eines Modells nach Bénabou und Tirole (2006) wird gezeigt, welchen Einfluss die Sichtbarkeit und die für das Engagement angebotene Vergütung auf die Image Motivation des Agenten haben. Beide Einflüsse werden zunächst im Modell ignoriert und dann nacheinander wieder in die Analyse eingebunden um ihre jeweilige Wirkung zu verdeutlichen.
Als Ausgangspunkt dient eine abstrakte Situation, in der ein Individuum frei von extrinsischen Anreizen eine soziale Handlung unternimmt, die von außen nicht direkt beobachtet werden kann und an die sich das Individuum nicht erinnern kann . Der Agent weiß daher nicht, welche Motive für sein Handeln ursprünglich verantwortlich waren. Die vorgenommene Handlung lässt keine Rückschlüsse auf den Typ des Agenten bzw. auf dessen individuelle Präferenzen hinsichtlich des privaten Konsums und der altruistischen Präferenzen zu.
Zur Veranschaulichung kann folgende Überlegung dienen: Unter der Annahme, dass ein Beobachter lediglich das Endprodukt einer Gruppenarbeit, jedoch nicht die individuelle Leistung betrachten kann, leitet er die Anerkennung, die er dem Individuum für dessen persönliche Leistung entgegen bringt, aus den bisher beobachteten Ausprägungen intrinsischer und extrinsischer Motivation ab (Bénabou & Tirole, 2006: 1656). Die bereits formulierte Reputationskomponente der individuellen Nutzenfunktion verändert sich demnach für wie folgt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es kommt zu einem sog. Pooling aller Agenten in der betrachteten Gruppe. Aufgrund von Informationsasymmetrien ist eine Bewertung der einzelnen Agenten durch die Beobachtung der Leistungssignale nicht möglich. Dies führt dazu, dass diejenigen Agenten, die unterdurchschnittlich intrinsisch motiviert sind, , durch die Durchschnittsbetrachtung profitieren. Agenten mit einer überdurchschnittlichen intrinsischen Motivation verlieren hingegen im Vergleich zur individuellen Bewertung an Ansehen (Stiglitz, 1975: 275). Der betrachtete Agent löst demnach folgendes Maximierungsproblem:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Da er keine Möglichkeit besitzt, sich durch seine Handlung als überdurchschnittlich sozial darzustellen[14], fällt der letzte Term bei seiner Optimierungsüberlegung weg. Daraus folgt: . Die Grenzkosten entsprechen im Optimum wiederum dem Grenznutzen des Agenten bei der Wahl einer bestimmten Anstrengung. Die intrinsische Motivation ist die einzige Ursache für die Aktivität des Agenten, während die tatsächliche Einstellung gegenüber extrinsischen Motiven verborgen bleibt und ebenso wie die Reputationsbedenken keinen Einfluss auf die Partizipationsentscheidung des Individuums besitzt. Dieses erste Modellergebnis unterstützt die von Carpenter und Myers aufgestellte Hypothese, nach der Agenten mit einer hohen intrinsischen Motivation sich stärker sozial engagieren (Carpenter & Myers, 2010: 913).
3.2.2 Einfluss der Sichtbarkeit
Wie verändern sich die Modellergebnisse, wenn die Handlung des Agenten für Externe sichtbar wird bzw. wenn der Agent sich an seine Handlung erinnern kann und ihm die soziale und persönliche Anerkennung wichtig sind? In ihrem Click for Charity Experiment stellen Ariely et. al (2009) fest, dass sich die Versuchspersonen deutlich mehr für ein positiv assoziiertes Projekt anstrengen, wenn ihre Leistung, das schnelle Tippen zweier Tasten, öffentlich ist[15]. Dadurch sehen sie ihre Image Motivation Hypothesis, nach der eine höhere Sichtbarkeit zu einem höheren prosozialen Engagement führt, bestätigt. Diese Steigerung der Reputation beruht auf der Annahme, dass soziales Verhalten in der Bevölkerung grundsätzlich positiv gewertet wird[16]. Je höher die beobachtete Anstrengung ist, desto größer ist auch die Reputation der Handlung, sodass in der Konsequenz das Anstrengungsniveau ansteigt (Ariely et al., 2009: 546). Diese Hypothese soll im Folgenden modelltheoretisch untersucht werden.
Es wird angenommen, dass weiterhin keine extrinsischen Anreize für die soziale Handlung existieren und deshalb jedes Anstrengungsniveau auf die intrinsische Motivation sowie auf deren Anerkennung zurückgeführt werden kann. Die Reputationskomponente hängt im Modell nun von der Beobachtbarkeit und dem Anstrengungsniveau ab:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die anderen Faktoren werden als gegeben betrachtet. Der zuvor verwendete Term kann aus Gründen der Übersichtlichkeit ignoriert werden, da er, wie oben gezeigt wurde, keinen Einfluss auf die optimale Entscheidung des Agenten hat.
Ausgehend von dem beobachteten Anstrengungsniveau bildet der interne, bzw. externe Betrachter Erwartungen hinsichtlich der intrinsischen und extrinsischen Einstellung des Agenten. Da keine extrinsische Motivationsquelle existiert, kann das Handeln des Individuums nicht auf externe Anreize zurückgeführt werden. Der Agent besitzt zwar weiterhin Präferenzen für den Konsum privater Güter , jedoch können diese nicht aus seiner sozialen Handlung abgeleitet werden. Folglich werden auch hier durchschnittliche Ausprägungen angenommen, die sich z.B. aus früheren Beobachtungen ergeben könnten: .
Der Beobachter weiß mit Sicherheit, dass unter der Annahme homogener Reputationsansichten eine Handlung aus intrinsischen Gründen durchgeführt wird. Die intrinsische Motivation leitet sich aus denselben Faktoren wie im vorherigen Fall ohne Beobachtung ab. Da keine weiteren Einflussfaktoren existieren, ist der bedingte Erwartungswert der intrinsischen Motivation gleich der optimalen Wahl des Anstrengungsniveaus:
Wenn ein Individuum sich z.B. unentgeltlich und ohne realistische Aussicht auf eine zukünftige extrinsische Belohnung in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, dann weiß sowohl das Individuum als auch ein externer Beobachter, dass dieses Engagement rein intrinsischen Motiven zuzuschreiben ist, da alle Individuen diese Anstrengung in gleicher Weise[17] wertschätzen . Das bedeutet, dass jedes Individuum die identische Wertschätzung bzw. Verachtung hinsichtlich einer bestimmten Aktivität besitzt. Es lässt sich demnach direkt aus der Beobachtung des sozialen Engagements auf die intrinsische Motivation schließen. Die extrinsischen Präferenzen bleiben weiterhin verborgen. Die Nutzenfunktion setzt sich aus der direkten[18] und der indirekten[19], reputationsbasierten Nutzenkomponente zusammen und lautet:
Daraus wird ersichtlich, dass der betrachtete Agent einen höheren Nutzen erhält, wenn er eine hohe intrinsische Motivation besitzt und seine Handlung gut sichtbar und in der Gesellschaft anerkannt ist[20]. Will der Agent seinen persönlichen Nutzen maximieren, kann er das durch eine Variation seines Anstrengungsniveaus erreichen. Im Optimum lautet die Anstrengung: . Nach einer Umformung lässt sich für die getroffenen Annahmen zeigen, welches Mindestniveau an intrinsischer Motivation ein Individuum besitzen muss, damit es sich sozial engagiert. Für kontinuierliche Entscheidungsprobleme lässt sich die intrinsische Motivation eindeutig feststellen (Bénabou & Tirole, 2006: 1659).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 – Partizipationsentscheidung (ohne monetäre Anreize), vgl. Bénabou und Tirole, 2006: 1659
In Abbildung 3 ist erkennbar, dass eine höhere Sichtbarkeit im Modell dazu führt, dass die Grenze, ab der sich Individuen für eine Teilnahme an der sozialen Aktivität entscheiden, nach links verschoben wird. Selbst Menschen mit einer geringen intrinsischen Motivation nehmen dann an der sozialen Handlung teil, da sie sich dadurch eine Steigerung ihrer Reputation erhoffen (Image Rewards). Eine erste Handlungsempfehlung könnte demnach lauten: In einer sozial homogenen, altruistisch veranlagten Gesellschaft (hohes ) sollte die öffentliche Anerkennung sozialer Leistungen dazu genutzt werden, soziales Engagement zu fördern. Wird die Annahme der homogenen Handlungs-Bewertungen fallen gelassen, kann gezeigt werden, dass eine starke Image-Orientierung eines Individuums und folglich sein Streben nach sozialer Anerkennung, durchaus negativ gewertet werden kann (vgl. Bénabou & Tirole, 2006: 1665).
3.2.3 Signalwirkung monetärer Anreize
Gemeinnützige Organisationen, Vereine sowie staatliche Institutionen können monetäre Anreize, wie z.B. Steuervergünstigungen, Aufwandsentschädigungen oder leistungsabhängige Zahlungen einsetzen, um soziales Verhalten zu fördern. Neben dem direkten Nutzen, den der Agent aus dem Konsum zusätzlich erreichbarer, privater Güter generieren kann, haben diese Anreize, wie oben angedeutet, eine wichtige Signalfunktion: führt ein Agent eine soziale Tätigkeit aus, für die er in einer beliebigen Form entlohnt wird, kann sich das negativ auf dessen Reputation auswirken (Bénabou & Tirole, 2006: 1656). Die Reputationsbedenken haben Einfluss auf die Bewertung der intrinsischen Grundeinstellung des Agenten und in der Folge auch auf dessen Partizipationsentscheidung in einer prosozialen Aktivität.
Zur Vereinfachung wird im Folgenden angenommen, dass im Hinblick auf die Reputationsbedenken nur zwei Typen von Individuen existieren: Individuen mit bzw. ohne Reputationssorgen (Carpenter & Myers, 2010: 912). Agenten, die sich nicht um ihr Ansehen sorgen, besitzen die Nutzenfunktion und wählen das optimale Anstrengungsniveau. Es wird deutlich, dass neben den persönlichen Präferenzen nun ebenfalls eine höhere Vergütung positiv auf das optimale Engagement einwirkt. Eine solche Situation ohne Reputationsbedenken ist in der Realität vorstellbar, wenn der Agent anonym handelt und wenn, bezogen auf die Selbsteinschätzung, das Individuum keine Zweifel an seinen persönlichen Präferenzen besitzt.
Es zeigt sich, dass unter diesen restriktiven Annahmen monetäre Anreize eine eindeutig positive Motivationswirkung entfalten und das Ergebnis damit im Einklang mit den klassischen ökonomischen Modellen ist: Ein höherer Preis führt demnach zu einem höheren (Leistungs-) Angebot. Der Preiseffekt ist unter den angenommenen Umständen, ähnlich wie in dem Modell von Frey (1997), die einzige Ursache für eine Verhaltensänderung. Die intrinsische Motivation bleibt dabei unverändert.
Die Partizipationsquote verändert sich ebenfalls positiv. Durch die Einführung des monetären Anreizes nehmen auch die Agenten an der sozialen Aktivität teil, deren intrinsische Motivation allein nicht ausgereicht hätte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 – Partizipationsentscheidung (mit monetären Anreizen, ohne Reputationsbedenken); vgl. Bénabou und Tirole, 2006: 1659
Abbildung 4 verdeutlicht, wie sich die Partizipationsentscheidung in der Population verändert. Die Einführung der extrinsischen Anreize führt dazu, dass sich die Grenze zwischen den Personen, die sich an einer prosozialen Handlung beteiligen und den Verweigerern, verändert. Während im ersten Fall, ohne extrinsische Anreize, lediglich die Agenten sich sozial engagierten, die über ein bestimmtes Mindestmaß an altruistischen Präferenzen verfügten, können nun durch den extrinsischen Anreiz auch die Agenten für die soziale Tätigkeit motiviert werden, die über eine geringere intrinsische, jedoch über eine hohe extrinsische Motivation verfügen. Die Gruppe der Teilnehmer wird nun im Durchschnitt als geiziger eingeschätzt (Bénabou & Tirole 2006: 1659), jedoch wirkt sich diese Tatsache auf den Personentyp ohne Reputationsbedenken nicht negativ aus.
Ist die Reputation für das Individuum hingegen von Bedeutung, fließt die Höhe des monetären Anreizes in die Einschätzung der altruistischen Veranlagung des Agenten mit ein. Der extrinsische Anreiz dient neben dem Anstrengungsniveau als Signal und wirkt sich folglich auf die Image Motivation des Agenten aus. Diese Reputationsbedenken tauchen lediglich in dem Modell von Bénabou und Tirole auf; Frey hatte diese noch nicht erkannt. Dass die Handlung und der extrinsische Anreiz auch Aufschluss über die Präferenzen bzgl. des privaten Konsums geben kann, wird zunächst nicht betrachtet. Diese Annahme ist für die spätere Analyse kleiner monetärer Anreize von Bedeutung (Bénabou & Tirole, 2006: 1658).
Es wird untersucht, wie sich materielle Anreize auf das soziale Image des Agenten auswirken und wie sich als Reaktion darauf das Anstrengungsniveau verändert. Extrinsische Anreize können das positive Signal, welches durch die prosoziale Handlung entsteht, abschwächen oder sogar umkehren (Ariely et al, 2009: 545). Die Image Motivation leitet sich aus der Reputationskomponente der individuellen Nutzenfunktion ab. Je höher die Wertschätzung einer bestimmten Handlung, desto eher ist der Agent auch in Zukunft bereit, diese Handlung auszuführen. Die Reputation wird für den gegebenen Fall folgendermaßen modelliert:
Neben der Sichtbarkeit und der für alle Agenten als identisch angenommenen Bewertung der prosozialen Einstellung ist insbesondere die Einschätzung der altruistischen Veranlagung unter Berücksichtigung des Anstrengungsniveaus und der Höhe der finanziellen Belohnung von großer Bedeutung für die Image Motivation und damit für die zukünftige Anstrengungsentscheidung des Agenten.
In der obigen Modellvariation wurde gezeigt, dass ohne extrinsische Anreize eine perfekte Vorhersage der intrinsischen Motivation aus der Beobachtung des Anstrengungsniveaus heraus möglich ist. Die Ausprägung der extrinsischen Motivation blieb hingegen unerkannt. Durch die Einführung einer Belohnung kommt es nun zu einem Signaldeutungsproblem (Bénabou & Tirole 2006: 1660): Wird ein Individuum bei der Ausführung einer sozialen Tätigkeit, die vergütet wird, beobachtet, ist es nicht eindeutig feststellbar, ob diese Tätigkeit aus rein altruistischen Gründen oder aufgrund des extrinsischen Anreizes durchgeführt wurde. Eine Formulierung des bedingten Erwartungswertes der intrinsischen Motivation ist daher notwendig[21]. Unter der bereits getroffenen Annahme, dass die beiden Präferenzarten normalverteilt sind, ergibt sich für den Erwartungswert der altruistischen Einstellung:
Die intrinsische Motivation des Agenten kann in diesem Fall zwar nicht mehr direkt beobachtet werden, aber aus den sichtbaren Einflüssen und dem Wissen um die gemeinsame Verteilung der individuellen Präferenzen abgeleitet werden (Carpenter & Myers, 2010: 912). Es wird deutlich, dass die (bekannte) durchschnittliche soziale Neigung in der Bevölkerung als Ausgangspunkt für die Einschätzung der individuellen sozialen Präferenzen dient. Abhängig von dem sozialen Gewichtungsfaktor kann sich die Reputation und damit die Image Motivation im Vergleich zur Ausgangssituation ohne extrinsische Anreize verändern. Eine Anpassung der individuellen Anstrengungsentscheidung kann die Folge sein. Wie es letztlich zu dem gesuchten Verdrängungseffekt kommen kann und welchen Einfluss dabei der Gewichtungsfaktor hat, wird im Folgenden untersucht.
3.2.4 Informationsökonomische Modellierung des Korrumpierungseffekts
Bénabou und Tirole (2006) formalisieren die aus der Psychologie stammende Vorstellung des Korrumpierungseffekts in einem informationsökonomischen Modell. Damit sollen die kognitiven Prozesse der Entscheidungsfindung modelliert werden, die bei Frey (1997) lediglich vermutet wurden. Frey beschreibt zwar eine mögliche, durch einen extrinsischen Anreiz[22] ausgelöste Veränderung des Anstrengungsniveaus, kann diese aber nicht modelltheoretisch erklären.
Die Anerkennung, die ein Individuum aus einem ursprünglich unbezahlten Engagement erhält, wird durch die Einführung einer extrinsischen Belohnung beeinträchtigt. Es entstehen (Selbst-) Zweifel hinsichtlich der intrinsischen Motivation des Agenten (Bénabou & Tirole, 2006: 1654). Die Einführung monetärer Anreize kann demnach unerwünschte (Neben-)Effekte verursachen, die das soziale Engagement am Ende beeinträchtigen. Die bloße Vermutung, dass eine soziale Handlung aufgrund von extrinsischen Motiven durchgeführt wurde, schürt Zweifel an der inneren Motivation, sowohl beim Individuum als auch beim externen Beobachter. Dabei stehen die bereits im zweiten Kapitel identifizierten verhaltensbeeinflussenden Faktoren bei der folgenden Modellierung des Verdrängungseffekts im Fokus.
Ein repräsentativer Agent maximiert weiterhin seinen Nutzen über die Wahl seines Anstrengungsniveaus für eine prosoziale Tätigkeit. Durch die Berücksichtigung der bisherigen Überlegungen hinsichtlich der Reputations- und Kostenkomponente[23], nimmt die Nutzenfunktion folgende Form an:
Carpenter & Myers (2010) benutzen ein vereinfachtes Modell, welches auf dem Konstrukt von Bénabou und Tirole aufbaut. Sie versuchen einzelne Verhaltenseinflüsse in ihrer Studie gezielt zu identifizieren und zu modellieren.
Mit Hilfe eines Fragebogens untersuchen sie die Ausprägung von den sechs Motiven, die einen Einfluss auf die Entscheidung, sich sozial zu engagieren, besitzen. Zwei dieser Motive, Altruismus und Image-Bedenken, sind direkte Bestandteile der oben aufgestellten Nutzenfunktion.
Die Autoren versuchten die altruistische Einstellung anhand eines Diktator-Spiels zu erfassen. Die Teilnehmer der Studie[24] wurden gefragt, welchen Anteil eines ihnen zur Verfügung gestellten Betrags in Höhe von 100$ sie an eine selbstgewählte, wohltätige Einrichtung spenden würden. Ein Spendenbetrag von 80$ beispielsweise implizierte, dass die Teilnehmer die restlichen 20$ für sich selbst behalten dürften. 10% der Allokationsentscheidungen wurden am Ende zufällig ausgewählt und tatsächlich ausgeführt. Die Spendenhöhe diente Carpenter und Myers als Näherungsvariable für die altruistische Einstellung (Carpenter & Myers, 2010: 912).
Das Interesse an der persönlichen Reputation, an dem Ansehen der Versuchsteilnehmer, ist die zweite untersuchte Motivationsquelle, die ebenfalls Bestandteil der betrachteten Nutzenfunktion ist (Carpenter & Myers, 2010: 913). Es wurde in der Studie angenommen, dass Teilnehmer, die sich um ihr Image sorgen, eher dazu neigen, ein spezielles Autokennzeichen, welches sie als Mitglied einer (wohltätigen) Organisation identifiziert, bei der Registrierung eines Fahrzeuges zu erwerben.
Damit die Wirkung der einzelnen Motivationsfaktoren auf das individuelle Verhalten im Modell untersucht werden kann, wird zunächst die Nutzenfunktion nach dem Anstrengungsniveau des Agenten differenziert[25]:
Der Ausdruck ist für eine innere Lösung des Maximierungsproblems gleich null und entfällt (Bénabou & Tirole 2006: 1674). Der Agent wählt demnach folgendes Anstrengungsniveau:
Wenn alle Individuen identische Ansichten hinsichtlich der Bewertung intrinsischer Motive besitzen, existiert ein einziges Gleichgewicht, in dem die Individuen in Abhängigkeit von ihren persönlichen Typen und einem extrinsischen Anreiz, die Anstrengung aufbringen (Bénabou & Tirole, 2006: 1661).
Da der direkte Einfluss der extrinsischen Motivation , der sich im sog. Preiseffekt ausdrückt, bereits oben modelliert wurde, rückt nun die Reputationskomponente, bzw. der auf sie einwirkende Verdrängungseffekt in den Vordergrund. Es soll damit untersucht werden, wie das hergeleitete, optimale Anstrengungsniveau auf Veränderungen des extrinsischen Anreizes reagiert bzw. weshalb es in manchen Fällen zu einer Verringerung der Image Motivation und damit zu einem Rückgang des sozialen Engagements kommen kann.
Die Auswirkungen einer Veränderung des monetären Anreizes auf die Image Motivation, bzw. die Reputation des Individuums lassen sich anhand der Veränderung des sozialen Gewichts aus der Reputationskomponente ablesen:
Es wird zunächst angenommen, dass die Kovarianz zwischen den beiden Variablen und gleich null ist, sodass beide stochastisch unabhängig voneinander sind. Dadurch vereinfacht sich die Formel für den sozialen Gewichtungsfaktor[26] zu
Dieses Gewicht gibt in der individuellen Nutzenfunktion an, wie stark interne bzw. externe Beobachter das über den Durchschnitt hinaus gehende Engagement eines Agenten wertschätzen. Eingesetzt in die Angebotsfunktion der sozialen Arbeit, zeigt sich, dass das Anstrengungsniveau durch eine Variation des monetären Anreizes verändert wird. Differenziert[27] nach dieser Variable ergibt sich:
Mit diesem Modellergebnis lässt sich eine ambivalente Wirkung extrinsischer Anreize nachvollziehen. Wird der monetäre Anreiz erhöht, so wirkt sich eine starke Konsumorientierung des Agenten positiv auf seine Partizipationsentscheidung bzw. sein Anstrengungsniveau aus. Dieses erste Ergebnis steht im Einklang mit den klassischen ökonomischen Modellprognosen. Auf der anderen Seite, sinkt die Image-Motivation, da . Eine gute Sichtbarkeit des Engagements und eine hohe gesellschaftliche Wertschätzung altruistischer Präferenzen verstärken den Rückgang der Reputation zusätzlich. Wie lässt sich diese nichtintendierte Wirkung der finanziellen Anreize im Modell erklären?
Die Unsicherheit bezüglich der extrinsischen Motivation wird durch eine Erhöhung der monetären Vergütung verstärkt[28]. Wenn die Unsicherheit, basierend auf früheren Beobachtungen, groß ist, d.h. die individuellen Einstellungen bzgl. des privaten Konsums bei den bisher betrachteten Handlungen eines Agenten[29] sehr stark schwankten, dann führen extrinsische Anreize dazu, dass sich diese Unsicherheit weiter verstärkt. Das prosoziale Arbeitsangebot wird dann immer weniger, sowohl durch Außenstehende als auch durch den Agenten persönlich, der intrinsischen, bzw. altruistischen Motivation zugeschrieben. Jede zusätzliche Erhöhung der Vergütung schadet dem Ansehen bzw. dem Selbstbild des Agenten (Bénabou & Tirole, 2006: 1661).
Der betrachtete Agent reduziert sein Arbeitsangebot folglich, wenn gilt:
Welche Schlüsse lassen sich aus diesem Modellergebnis ziehen? Zunächst fällt auf, dass die Kurve, welche die Funktion des sozialen Gewichtes beschreibt, einen konkaven Verlauf besitzt[30]. Der direkte Effekt der monetären Belohnung, der sog. Preiseffekt, übersteigt deshalb ab einem gewissen Punkt wieder die Image-Sorgen und führt zu einer höheren Anstrengung: .
Folglich existiert ein Bereich, in dem das Anstrengungsniveau mit einer marginalen Erhöhung des monetären Anreizes nicht ansteigt, sondern sogar sinkt (Bénabou & Tirole, 2006: 1661). Wenn dieser Bereich allerdings überschritten wird, steigt das Engagement wieder durch eine marginale Erhöhung des Anreizes an. Dies wird in der folgenden Graphik[31] veranschaulicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5 - Anstrengungsniveau in Abhängigkeit von einem monetären Anreiz, Variation von (vgl. Bénabou & Tirole 2006: 1662)
Von welchen Faktoren hängt die Größe dieses Bereiches ab? Die Variation der gesellschaftlichen Reputationsansichten und der Sichtbarkeit der Handlung (beides ausgedrückt in ) sind für die verschiedenen Funktionskurven in Abbildung 5 verantwortlich. Die unterste Gerade beschreibt die Reaktion eines Individuums auf einen monetären Anreiz, wenn in der betrachteten Gruppe soziales Engagement nicht wertgeschätzt wird . Ein altruistisches Verhalten muss demnach mit einem Mindestmaß an Reputation in der Gesellschaft verbunden sein, damit es zu einer Reduktion des Anstrengungsniveaus durch Anreize kommen kann (Bénabou & Tirole, 2006: 1661).
Ist z.B. das Umweltbewusstsein in einem bestimmten Kulturkreis nicht stark ausgeprägt, dann führt ein staatlich subventionierter Kauf eines verbrauchsarmen Fahrzeugs lediglich zu einem sehr geringen Reputationsverlust bei der betroffenen Person. Die durch den finanziellen Anreiz ausgelösten Zweifel an der eigenen intrinsischen Motivation können zwar vorhanden sein, sind aber nicht stark genug um auf die abschließende Handlungsentscheidung Einfluss zu nehmen. Es überwiegen in diesem Fall die finanziellen Motive für den Kauf des Wagens. Parallel zum Modell von Frey kann festgehalten werden, dass der Preiseffekt in diesem Fall den Verdrängungseffekt dominiert. Im Gegensatz zu Freys Überlegungen wird jedoch im Modell von Bénabou und Tirole nicht ausgeschlossen, dass weiterhin intrinsische Präferenzen beim Individuum vorhanden sein können. Die Annahme fester Präferenzen ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Erklärungsansätzen (Frey & Jegen, 2001: 592).
Darüber hinaus lässt sich aus Abbildung 5 ablesen, dass je wichtiger die vorherrschenden Ansichten bzgl. einer sozialen Einstellung sind, je höher folglich ist, desto höher ist das Ursprungsniveau der Anstrengung . In einer solchen Gesellschaft könnte angenommen werden, dass entsprechende soziale Normen für ein hohes intrinsisches Anstrengungsniveau sorgen. Menschen fühlen sich demzufolge verpflichtet, z.B. Müll richtig zu entsorgen, weil die mutwillige und sichtbare Umweltverschmutzung dem persönlichen Ansehen schadet.
Der marginale Rückgang des Engagement, ausgelöst durch den externen Eingriff, ist im Modell dann umso stärker: so muss in dem betrachteten Fall eine stark reputationsorientierte Person , mit einem relativ hohen extrinsischen Anreiz entlohnt werden, damit das ursprüngliche, nicht vergütete Anstrengungsniveau wieder erreicht wird (siehe Abbildung 5).
Dieses theoretische Modellergebnis stimmt mit den Beobachtungen von Gneezy und Rustichini (2000) überein. Die Autoren stellen in einem Feldexperiment mit Jugendlichen fest, dass diejenigen, die für das Sammeln von Spenden lediglich eine sehr geringe Entlohnung erhielten, weniger Spenden einsammelten als die Personen, die entweder gar nicht entlohnt wurden oder eine relativ hohe Belohnung bekamen. Die Höhe der eingesammelten Spenden wird in Abbildung 6 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6 - Durchschnittliche Spendenhöhe in NIS (vgl. Tabelle IV, Gneezy & Rustichini, 2000: 800)
Gneezy und Rusitichini sehen dieses Ergebnis als einen Hinweis dafür, dass unter Umständen eine Diskontinuität im Punkt null existieren kann (Gneezy & Rustichini, 2000: 802). Zwar vermutet auch Frey, dass sich schon durch die Einführung eines minimalen Anreizes die Wahrnehmung der gesamten Tätigkeit verändert (Frey & Jegen, 2001: 594), jedoch führt in seinem Modell ein kleiner extrinsischer Anreiz nur zu einer geringen Reduktion des Anreizes.
Gneezy und Rustichini stellen in ihren Experimenten fest, dass die Diskontinuität einen erheblich stärkeren Einfluss hat als von Frey vermutet (Gneezy & Rustichini, 2000: 803). Im Folgenden soll mit dem Modell von Bénabou und Tirole dieser strittige Punkt untersucht werden.
3.2.5 Kleine Anreize – große Wirkung?
Im oberen Abschnitt konnte gezeigt werden, dass extrinsische Anreize dazu führen können, dass interne und externe Beobachter an der intrinsischen Motivation eines Agenten zweifeln. Die monetären Belohnungen können demnach dazu führen, dass die altruistische Einstellung nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden kann. Diese Ungewissheit dient als Begründung für die Reaktion des Agenten, d.h. sie erklärt den Rückgang des sozialen Anstrengungsniveaus. Zu dem gleichen Ergebnis, allerdings mit Hilfe eines informellen Modellkonstrukts, kommt auch Frey.
Es fehlt jedoch eine Erklärung dafür, weshalb insbesondere relativ kleine Anreize zu einem überproportional starken Rückgang des Engagements führen können (Gneezy & Rustichini, 2000: 803). Dabei steht nicht die Höhe des monetären Anreizes im Fokus, sondern die Tatsache, dass überhaupt ein finanzieller Anreiz durch den Prinzipal eingesetzt wird (Bénabou & Tirole 2006: 1662). Um dieses Phänomen zu untersuchen, wird im Folgenden berücksichtigt, dass Menschen in der Regel nicht als geizig betrachtet werden wollen (Bénabou & Tirole, 2006: 1658). Die in der Gesamtbevölkerung auftretenden Ansichten dazu werden mit der Variable beschrieben. Unter Berücksichtigung dieser Variable nimmt das optimale Anstrengungsniveau folgende Form[32] an:
Die Reputationskomponente enthält nun eine weitere Dimension, die insbesondere bei der Analyse kleiner Anreize eine wichtige Rolle spielen kann. In einer Ausgangssituation, in der es zunächst keine monetären Anreize gibt , führt eine marginale Erhöhung der Belohnung zu folgender Verhaltensreaktion:
Das Anstrengungsniveau ist negativ für den Fall, dass bzw.
Werden nun für und die entsprechenden Ableitungen[34] eingesetzt, ergibt sich
Unter der Annahme, dass die Kovarianz ist, wird deutlich, dass eine in Relation relativ hohe Unsicherheit bezüglich der extrinsischen Einstellung, in Relation zur intrinsischen Motivation, zu einem stärkeren Rückgang des Engagements führt (Bénabou & Tirole 2006: 1663).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7 - Anstrengungsniveau in Abhängigkeit von einem monetären Anreiz, Variation von (vgl. Bénabou & Tirole 2006: 1662)
In Abbildung 7 wird diese Tatsache sichtbar[35]. Nimmt einen hohen Wert an (unterste Kurve,), so ist der Ausschlag und damit die Reaktion selbst auf eine geringe Belohnung ebenfalls sehr stark. In Situationen, in denen eine hohe Unsicherheit hinsichtlich der extrinsischen Motivation eines Individuums existiert, kann durch die Beobachtung einer Handlung ein Informationsgewinn erreicht werden: Die Standardabweichung kann in der Folge sinken (Bénabou & Tirole 2006: 1663).
In der Realität ist eine Situation vorstellbar, in der ein Individuum in eine bestehende (Arbeits-)Gruppe aufgenommen wird. Die bisherigen Mitglieder kennen sich bereits untereinander, d.h. die Erwartungen hinsichtlich der individuellen Einstellungen sind relativ präzise. Für das neue Gruppenmitglied gilt dies nicht: Für diesen müssen zunächst noch unter Berücksichtigung der Umwelteinflüsse, z.B. der Sichtbarkeit seiner Handlungen und den Anreizen, Einschätzungen hinsichtlich der Persönlichkeit gebildet werden. Selbst ein kleiner Anreiz und die darauf erfolgende Reaktion , können bereits dazu führen, dass das neue Gruppenmitglied seine Konsumpräferenzen offenbart und von den anderen Gruppenmitgliedern als geizig eingeschätzt wird (). Um diesen Eindruck zu vermeiden, beteiligt sich dieses Individuum per se nicht einmal an geringfügig vergüteten Handlungen. Das Anstrengungsniveau sinkt.
Mit Hilfe von Variationen des Modells von Bénabou und Tirole (2006) wurde gezeigt, dass der Verdrängungseffekt, der durch extrinsische Anreize ausgelöst wird, nicht nur auf die Wahrnehmung der intrinsischen Motivation Einfluss nimmt, sondern auch dazu führen kann, dass ein Agent als geizig und konsumorientiert identifiziert werden könnte. Diese Reputationssorgen können den Rückgang eines sozialen Engagements durch die Einführung extrinsischer Anreize erklären.
4. Fazit
Viele Markttransaktionen erfolgen in unserem Wirtschaftssystem vollkommen unentgeltlich und auf freiwilliger Basis. Einige Menschen nehmen sogar Kosten in Kauf, um eine Handlung vorzunehmen, die auf den ersten Blick keinen persönlichen, konsumbasierten Nutzen stiftet. Eine Erklärung dieses Verhaltens liefert die aus der Psychologie stammende Vorstellung der intrinsischen Motivation. Die Einbindung dieser Motivation in ein ökonomisches Modellkonstrukt diente als Grundlage für die darauf aufbauende Analyse des Verdrängungseffekts extrinsischer Anreize.
Ein intuitives Verständnis der Funktionsweise von Märkten ist in unserem westlichen Kulturkreis weit verbreitet. Unbewusst gehen die meisten Menschen davon aus, dass eine monetäre Vergütung mit einer Steigerung des Anstrengungsniveaus verbunden ist und handeln entsprechend.
Diese Intuition kann jedoch falsch sein und dazu führen, dass eine Person, die als Prinzipal auftritt, in zweifacher Hinsicht einen Verlust erleidet: Zum einen reduziert die direkte Zahlung sein Einkommen, zum anderen kann die Zahlung dazu führen, dass die Agenten ein niedrigeres Anstrengungsniveau leisten als in dem Fall ohne monetären Anreiz (Gneezy & Rustichini, 2000: 801).
Dieser Effekt tritt besonders stark bei relativ kleinen extrinsischen Anreizen auf. Die Entgegennahme selbst kleiner monetärer Belohnungen lieferte in dem Modell von Bénabou und Tirole (2006) das entscheidende Signal für die Aufdeckung der individuellen, extrinsischen Motivation. Um diese Offenlegung zu vermeiden, reduzierten die modellierten Agenten unter bestimmten Bedingungen vollständig ihr Anstrengungsniveau und stellten die soziale Handlung ein.
Letztendlich konnte anhand der Erklärungsansätze von Frey und Bénabou und Tirole die Ausgangsfrage, ob extrinsische Anreize soziales Verhalten beeinflussen, eindeutig beantwortet werden: Der Verdrängungseffekt wirkt sich unter bestimmten, in der vorliegenden Arbeit identifizierten Bedingungen auf die Anstrengungsentscheidung eines Individuums negativ aus. Die hergeleiteten Modellprognosen finden in jüngeren empirischen Studien Unterstützung.
Offen bleibt die Frage, wie sich das individuelle Verhalten über einen längeren Zeitraum hinweg entwickelt. Während aus modelltheoretischer Sicht eine spieltheoretische Herangehensweise sinnvoll erscheint, sollte in der empirischen Verhaltensforschung auf Panelstudien zurückgegriffen werden. Mittels Längsschnittanalysen könnte insbesondere untersucht werden, wie sich das individuelle Verhalten verändert, nachdem die persönlichen Präferenzen offenbart wurden.
5. Literaturverzeichnis
Andreoni, J. (1989): Giving with Impure Altruism: Applications to Charity and Ricardian Equivalence. In: Journal of Political Economy, 97:6, 1447-1458.
Ariely, D., Bracha, A. und Meier, S. (2009): Doing Good or Doing Well? Image Motivation and Monetary Incentives in Behaving Prosocially. In: American Economic Review, 99:1, 544-555.
Bem, D. (1972): Advances in Experimental Social Psychology - Self-Perception Theory. New York and London: Academic Press, Inc.
Bénabou, R. und Tirole, J. (2006): Incentives and Prosocial Behavior. In: American Economic Review, 96:5, 1652-1678.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMSFJ): Monitor Engagement (Ausgabe Nr. 2). Kurzbericht des 3. Freiwilligensurveys. Publikationsversand der Bundesregierung, Berlin.
Cameron, J. und Pierce, W. (1994): Reinforcement, Reward, and Intrinsic Motivation: A Meta-Analysis. In: Review of Educational Research, 64:3, 363-423.
Carpenter, J. und Myers, C. (2010): Why volunteer? Evidence on the role of altruism, image, and incentives. In: Journal of Public Economics, 94, 911-920.
Deci, E. (1971): Effects of Externally Mediated Rewards on Intrinsic Motivation. In: Journal of Personality and Social Psychology, 18:1, 105-115.
Deci, E., Koestner, R. und Ryan, R. (1999): A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. In: Psychological Bulletin, 126:6, 627-668.
Eisenberger, R. und Cameron, Judy (1996): Detrimental Effects of Rewards – Reality or Myth? In: American Psychologist, 51:11, 1153-1166.
Frey, B. (1997): Not Just For The Money. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Frey, B., und Jegen, R. (2001): Motivation Crowding Theory. In: Journal of Economic Surveys, 15:5, 589-611.
Frey, B. und Oberholzer-Gee, F. (1997): The Cost of Price Incentives: An Empirical Analysis of Motivation Crowding-Out. In: American Economic Review, 87:4, 746-755.
Gneezy, U. und Rustichini, A. (2000): Pay Enough or Don’t Pay at All. In: The Quarterly Journal of Economics, 791-810.
Harlow, H.F., Harlow, M.K. und Meyer, D.R. (1950): Learning motivated by a manipulative drive. In: Journal of Experimental Psychology, 40, 228-234.
Holtbrügge, D. (2010): Personalmanagement. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
Lazear, E. (2000): Performance Pay and Productivity. In: American Economic Review, 90:5, 1346-1361.
Lepper, M., Greene, D. und Nisbett, R. (1973): Undermining Children’s Interest with Extrinsic Reward: A Test of the “Overjustification” Hypothesis. In: Journal of Personality and Social Psychology, 28:1, 129-137.
Mankiw, G., Taylor, M. (2008): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag
Prendergast, C. (2008): Intrinsic Motivation and Incentives. In: American Economic Review, 98:2, 201-205.
Ryan, R. und Deci, E. (2000): Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. In: American Psychologist, 55:1, 68-78.
Seabright, P. (2009): Continuous Preferences and Discontinuous Choices: How Altruists Respond to Incentives. In: The B.E. Journal of Theoretical Economics, 9:1, 1-26.
Stiglitz, J. (1974): The Theory of Screening Education and the Distribution of Income. In: American Economic Review, 65, 283-300.
6. Anhang
A1 – Herleitung des bedingten Erwartungswertes
Das bedeutet, dass durch die Beobachtung des Anstrengungsniveaus und der Vergütung , auf die Motive und indirekt geschlossen werden kann, da die Verteilung der Präferenzen in der Bevölkerung bekannt ist:
Das Anstrengungsniveau bildet sich durch das Zusammenspiel der Anreize und der Motive. Der Erwartungswert der intrinsischen Motivation entspricht dem durchschnittlich in der Bevölkerung vorhandenen Niveau dieser Ausprägung:
Daraus folgt für .
Aus der Berechnung des optimalen Anstrengungsniveaus ist bekannt, dass
Die Grenzkosten entsprechen folglich dem Grenznutzen einer zusätzlichen Anstrengungseinheit. Es gilt aus Gründen der Übersicht im Folgenden
Eingesetzt in die Berechnung des bedingten Erwartungswertes ergibt sich:
Der bedingte Erwartungswert kann nun in die Reputationskomponente der Nutzenfunktion eingesetzt werden.
A2 – Herleitung
Der soziale Gewichtungsfaktor lautet per Annahme:
Eine Ableitung nach dem Faktor liefert:
Im Punkt gilt:
Gleiches Vorgehen für die Berechnung von
[...]
[1] Abhängig von der verwendeten Definition des ehrenamtlichen Engagements, schwanken die Schätzungen zwischen 18% und 52% (Monitor Engagement, 2010: 16).
[2] Beispielsweise Sport und Bewegung, Sozialer Bereich, Religion und Kirche, Natur- und Umweltschutz (Monitor Engagement, 2010: 13).
[3] Im Folgenden werden die Begriffe Bedürfnis und Motiv, genau wie in der Literatur, synonym verwendet (Holtbrügge, 2010: 13).
[4] Engl.: „Crowding Out“.
[5] Wenn jeder Agent den gleichen Beitrag leistet, ist .
[6] Engl.: „warm glow“.
[7] Die Kinder erhielten einen „Good Player Award“ (Lepper et al., 1973: 133), ein Blatt Papier mit goldenen Buchstaben bedruckt, welches als Auszeichnung diente.
[8] Identifikation, Einführung des Anreizes, und Beobachtung des Verhaltens nach Entfernung des Anreizes.
[9] So untersuchten Deci, Koestner und Ryan (1999) für den Zeitraum von 1971 bis 1991 128 Studien mit Hilfe einer Meta-Analyse.
[10] In Form von Boni, Stücklöhnen, etc.
[11]
[12] In Abhängigkeit von den angenommenen Elastizitäten.
[13] Das Anstrengungsniveau steigt durch den monetären Eingriff, wenn
[14] Die Reputationskomponente ist nicht vom Anstrengungsniveau abhängig.
[15] Im Durchschnitt steigt die Leistung um 50% (Ariely et al., 2009: 548).
[16].
[17] Im Folgenden wird zur Vereinfachung angenommen, dass die Bewertung des intrinsischen und extrinsischen Engagements für alle Individuen konstant ist: .
[18] Direkte Nutzenkomponente (hängt allein von der Anstrengungsentscheidung ab): .
[19] Indirekte, da von der Bewertung anderer abhängige, Reputationskomponente .
[20] Die partiellen Ableitungen zeigen: ; ;
[21] Detaillierte Herleitung in Anhang A1.
[22] Siehe Abbildung 2.
[23] Zur Erinnerung: Kostenkomponente: ; Reputationskomponente: .
[24] Drei Gruppen: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, sonstige, in Vereinen Engagierte und Personen, die sich nicht in einer Organisation engagierten.
[25] Aus Gründen der Übersichtlichkeit gilt fortan: .
[26] Wenn die beiden Motivationsgründe nicht mehr unabhängig voneinander sind, wird deutlich, dass eine positive Kovarianz den negativen Effekt monetärer Anreize auf die Image Motivation verstärkt (Bénabou & Tirole, 2006: 1661).
[27] Zu beachten:
[28] Aus Gründen der Übersichtlichkeit gilt im Folgenden:
[29] Es ist auch denkbar, dass ein Beobachter seine Erfahrungen aus der Beobachtung anderer Agenten erhalten hat.
[30] Formal:
[31] Kurven entstehen durch Variation von . Anstrengungsniveau in Abhängigkeit des monetären Anreizes . Weitere angenommene Werte:
[32]
[33] Das Modell führt zum gleichen Ergebnis, wenn Opportunitätskosten berücksichtigt werden. Der Ausgangszustand wäre dann (Bénabou & Tirole 2006: 1663).
[34] Eine ausführlichere mathematische Herleitung findet sich in Anhang A2.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Motive für soziales Engagement und die Auswirkungen extrinsischer Anreize auf prosoziales Verhalten. Insbesondere wird der sogenannte Verdrängungseffekt (Crowding Out) analysiert, bei dem finanzielle Anreize die intrinsische Motivation untergraben können.
Welche Motivationsformen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet drei Hauptformen der Motivation: intrinsische Motivation (innerer Antrieb), extrinsische Motivation (äußere Belohnungen oder Strafen) und Image-Motivation (Reputationseffekte).
Was ist intrinsische Motivation?
Intrinsische Motivation entsteht aus dem inneren Antrieb, eine Tätigkeit um ihrer selbst willen auszuführen. Es gibt keine erkennbare Belohnung außer der Freude an der Tätigkeit selbst.
Was ist extrinsische Motivation?
Extrinsische Motivation entsteht durch äußere Anreize wie Geld, Prämien, Lob oder Strafen. Die Handlung wird ausgeführt, um eine Belohnung zu erhalten oder eine Strafe zu vermeiden.
Was ist Image-Motivation?
Image-Motivation entsteht durch den Wunsch, ein positives Bild von sich selbst zu vermitteln oder eine gute Reputation zu erlangen. Soziales Verhalten kann durch den Wunsch nach Anerkennung oder sozialer Akzeptanz motiviert sein.
Was ist der Verdrängungseffekt (Crowding Out)?
Der Verdrängungseffekt beschreibt das Phänomen, bei dem die Einführung extrinsischer Anreize zu einer Verringerung der intrinsischen Motivation führt. Menschen engagieren sich weniger, wenn sie für ihr Engagement bezahlt werden.
Welche Erklärungsansätze für den Verdrängungseffekt werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zwei Hauptansätze zur Erklärung des Verdrängungseffekts: den Ansatz von Bruno Frey (1997), der von einer direkten Reduzierung der intrinsischen Motivation ausgeht, und den informationsökonomischen Ansatz von Roland Bénabou und Jean Tirole (2006), der den Rückgang der Image-Motivation in den Fokus stellt.
Was ist der Kern des Modells von Bruno Frey?
Frey unterscheidet zwischen dem Preis- und dem Verdrängungseffekt. Der Preiseffekt besagt, dass höhere Anreize zu höherem Engagement führen. Der Verdrängungseffekt besagt, dass externe Eingriffe die intrinsische Motivation reduzieren können.
Was ist der Kern des Modells von Bénabou und Tirole?
Bénabou und Tirole betonen die Rolle von Informationsasymmetrien und Reputationseffekten. Die Einführung extrinsischer Anreize erschwert es, die wahren Motive hinter sozialem Verhalten zu erkennen, was zu einem Rückgang der Image-Motivation führen kann.
Welchen Einfluss hat die Sichtbarkeit von Handlungen?
Die Sichtbarkeit von Handlungen spielt eine wichtige Rolle bei der Image-Motivation. Öffentliches Engagement kann zu höherer Anerkennung und Reputation führen, während anonymes Engagement weniger Image-Effekte hat.
Welchen Einfluss haben kleine Anreize?
Kleine Anreize können eine besonders starke negative Wirkung haben, da sie das Signal aussenden, dass die Handlung nicht aus altruistischen Gründen, sondern wegen des Geldes erfolgt. Dies kann zu einem deutlichen Rückgang des Engagements führen.
Welche empirischen Studien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt empirische Studien von Deci (1971), Lepper et al. (1973), Lazear (2000), Gneezy und Rustichini (2000), Ariely et al. (2009) und Carpenter und Myers (2010), um die verschiedenen Modellprognosen zu überprüfen.
Was ist die Schlussfolgerung der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass extrinsische Anreize soziales Verhalten sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können. Der Verdrängungseffekt tritt unter bestimmten Bedingungen auf, insbesondere bei kleinen Anreizen und in Kontexten, in denen Image-Motivation eine wichtige Rolle spielt. Die Arbeit liefert Implikationen für die Gestaltung von Anreizsystemen, die darauf abzielen, soziales Engagement zu fördern.
- Arbeit zitieren
- Sergej Heinrich (Autor:in), 2012, Beeinflussen extrinsische Anreize soziales Verhalten?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212686