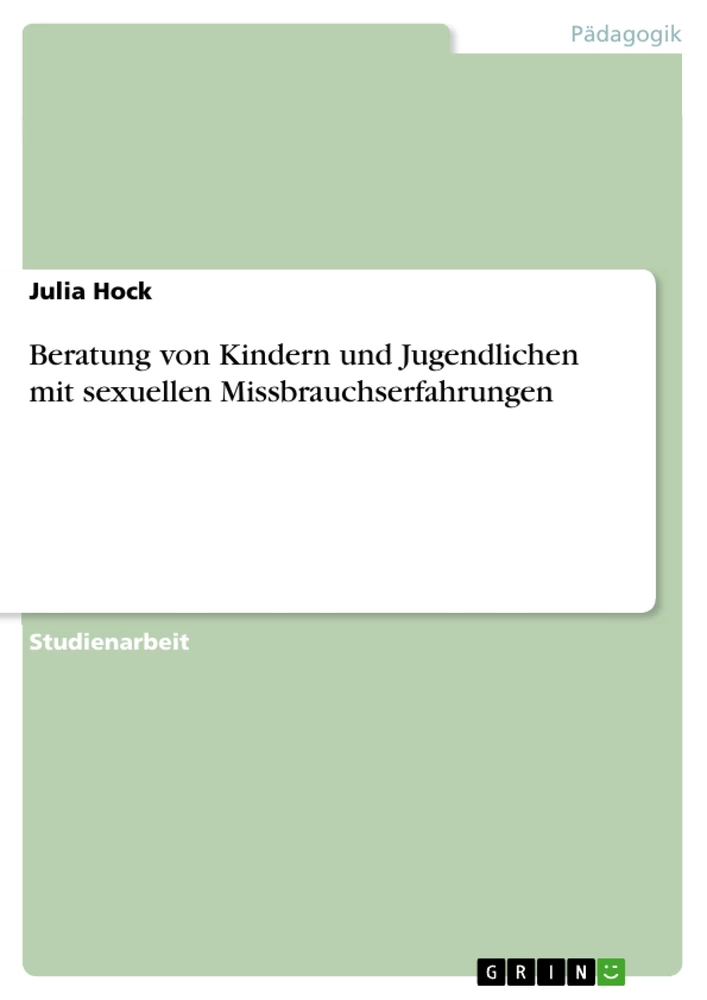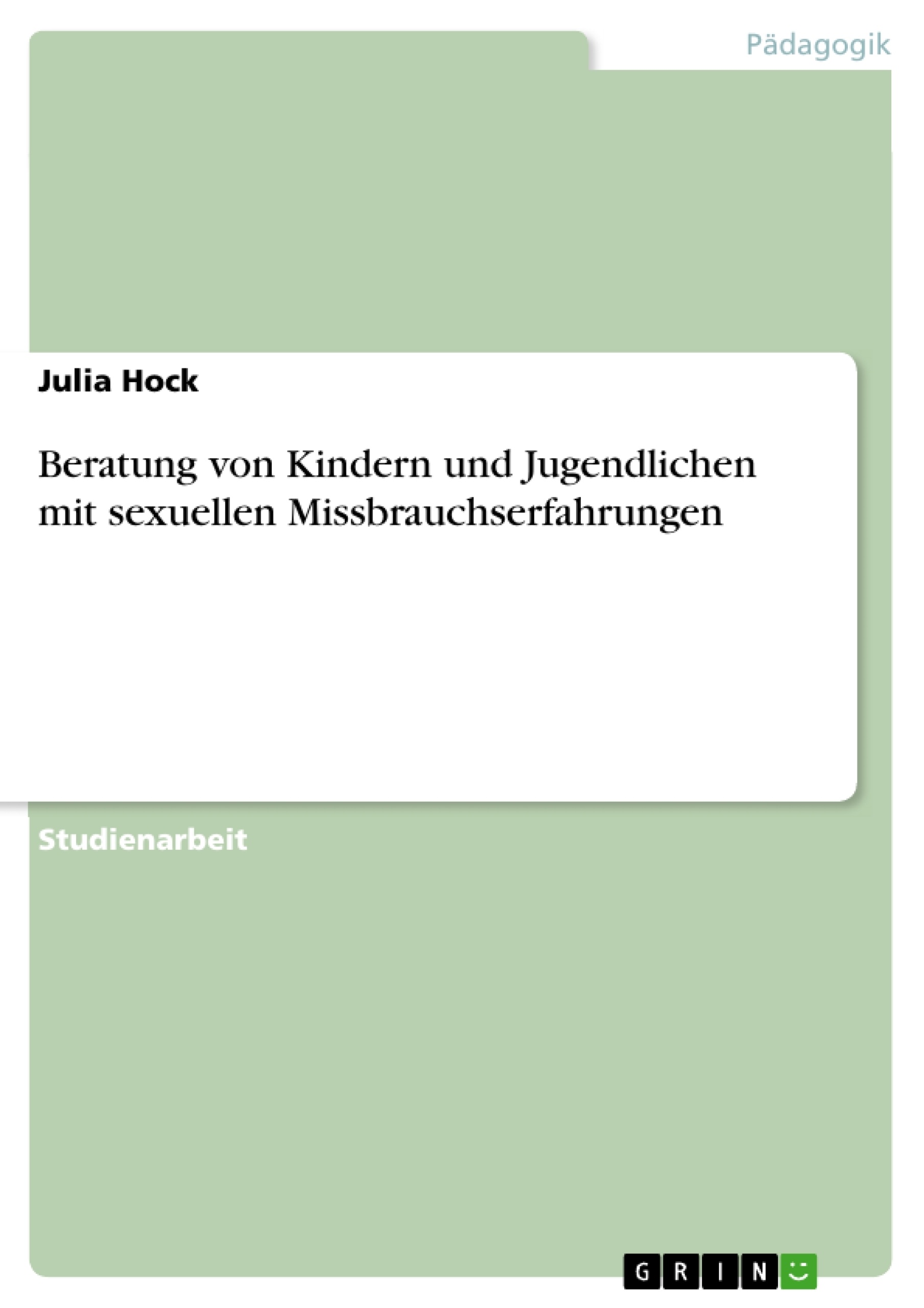Scheidungen, Altersarmut, Unsicherheit in der Wirtschaft, auf dem Arbeitsmarkt und in der Politik, Umweltverschmutzung, internationale Konflikte – dies ist nur ein Teil der gesellschaftlichen Diskrepanzen, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Besonders Kinder und Jugendliche, die in dieser Welt voll von Problemen und Missständen aufwachsen, bekommen die Auswirkungen davon zu spüren. Die allgegenwärtige Unsicherheit und Unzufriedenheit beeinflusst unweigerlich auch ihre Denk- und Verhaltensweise, ob durch unbewusste Übernahme der elterlichen Einstellungen oder direkte Beeinflussung durch diverse Medien. Wen wundert es da, dass Minderjährige eine ständige wachsende Gruppe in Beratungsstellen und Therapiezentren bilden? Kinder brauchen eine vertrauensvolle Betreuung mit sicherem Rahmen, deswegen ist es unbedingt notwendig, Beratende explizit auf die besonderen Bedürfnisse dieser Zielgruppe zu schulen. Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich deshalb allgemein mit der Beratung bei Kindern und Jugendlichen und deren Besonderheiten.
Der zweite Teil beschreibt die beratende Tätigkeit bei sexuellem Missbrauch, einem Phänomen, das täglich vorkommt und dennoch noch immer viel zu wenig Beachtung findet. Kinder sind diesen traumatischen Ereignissen vollkommen hilflos ausgeliefert und leiden meist noch Jahre nach der Tat an den tiefgehenden Spuren. BeraterInnen, die auf diesem Gebiet arbeiten, benötigen einen großen Umfang an „Handwerkszeug“ um mit der Problematik adäquat umgehen zu können. Auch wenn innerhalb dieser Ausarbeitung nicht alles beschrieben werden kann, sollen doch zumindest die Grundlagen der beratenden Arbeit nach sexuellen Gewalterfahrungen dargelegt werden.
Inhaltverzeichnis
Einleitung
Hauptteil
1. Beratung bei Kindern und Jugendlichen
1.1 Besonderheiten bei der Beratung von Kindern und Jugendlichen
1.2 Prinzipien und Grundsätze bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
1.3 Spezielle Methoden der Beratung
1.3.1 Spieltherapie
1.3.2 Gruppentherapie
2. Beratung bei sexuellem Missbrauch
2.1 Folgen von sexuellem Missbrauch
2.2 Spezielle Maßnahmen der Beratung
2.2.1 Gespräche mit kleinen Mädchen (3 – 6 Jahre)
2.2.2 Gespräche mit Mädchen (7 – 10 Jahre)
2.2.3 Gespräche mit jugendlichen Mädchen
2.2.4 Gespräche mit Frauen
2.2.5 Exkurs: Sexueller Missbrauch an Jungen
Schluss
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Besonderheiten bei der Beratung von Kindern und Jugendlichen?
Kinder benötigen einen besonders sicheren, vertrauensvollen Rahmen und Berater, die auf ihre spezifischen entwicklungsbedingten Bedürfnisse geschult sind.
Welche Methoden kommen in der Beratung zum Einsatz?
Die Arbeit nennt unter anderem die Spieltherapie und Gruppentherapie als effektive Mittel, um sich der Erlebniswelt von Kindern anzunähern.
Wie unterscheidet sich die Beratung nach Alter bei sexuellem Missbrauch?
Es gibt spezifische Ansätze für kleine Mädchen (3-6 Jahre), Kinder (7-10 Jahre), Jugendliche und erwachsene Frauen, um dem jeweiligen Entwicklungsstand gerecht zu werden.
Werden auch Jungen als Opfer von sexuellem Missbrauch berücksichtigt?
Ja, die Arbeit enthält einen Exkurs zum Thema sexueller Missbrauch an Jungen, um auch deren spezifische Problematik zu beleuchten.
Welche langfristigen Folgen hat sexueller Missbrauch für Kinder?
Kinder sind traumatischen Ereignissen oft hilflos ausgeliefert und leiden meist noch Jahre nach der Tat an tiefgehenden Spuren, was eine spezialisierte therapeutische Begleitung notwendig macht.
- Arbeit zitieren
- Julia Hock (Autor:in), 2012, Beratung von Kindern und Jugendlichen mit sexuellen Missbrauchserfahrungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212812