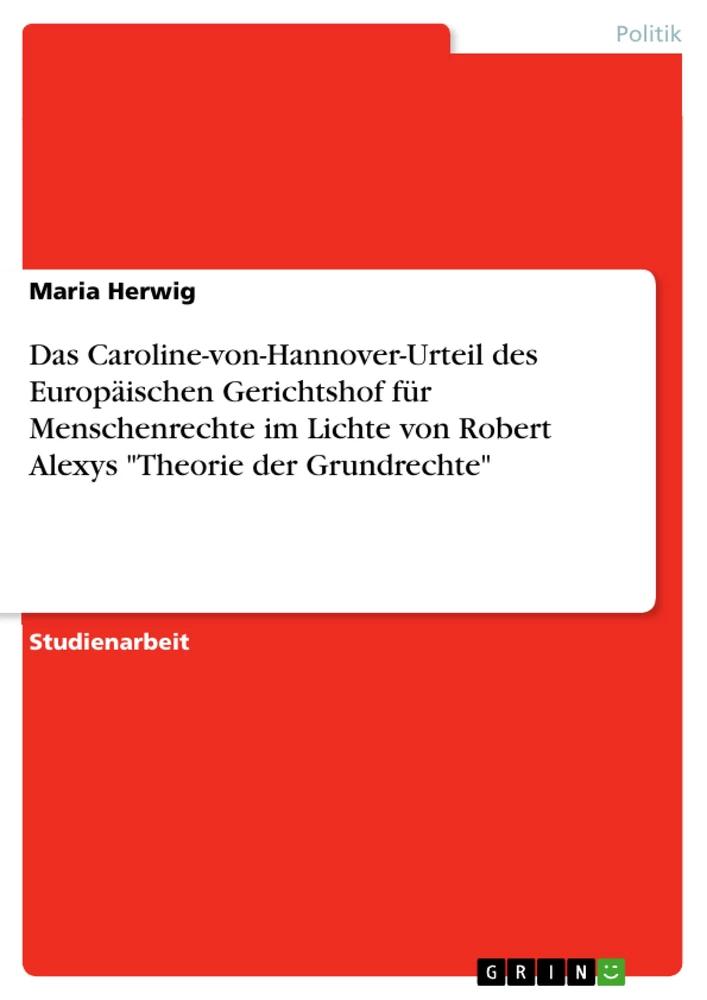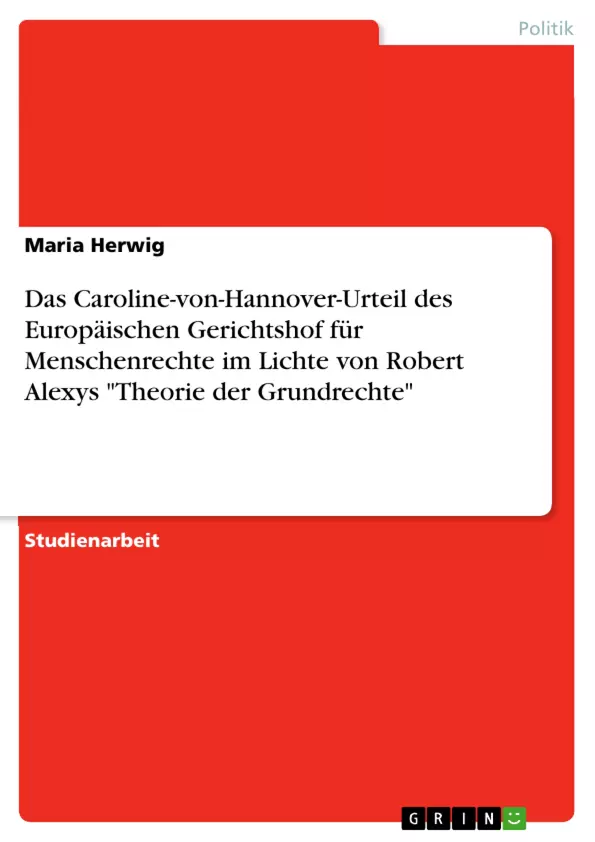Die vorliegende Seminararbeit gliedert sich in drei Abschnitte. Sie untersucht in einem ersten Schritt das Caroline-Urteil des EGMR, indem sie den Sachverhalt und die Prozessgeschichte vor den deutschen Gerichten näher beleuchtet sowie den darauf folgenden Gang vor den Straßburger Gerichtshof. In einem zweiten Schritt wird, losgelöst vom Caroline-Urteil, ein Weg zur Auflösung des Spannungsverhältnisses im Falle von Prinzipienkollisionen untersucht, entwickelt von Robert Alexy in seinem Werk Theorie der Grundrechte. Schließlich wird in einem dritten Schritt eine Synthese hergestellt zwischen dem Caroline-Urteil des EGMR und dem Kollisionsgesetz nach Robert Alexy. Die vorliegende Arbeit untersucht, ob und inwieweit der Straßburger Gerichtshof im Sinne Alexys das Spannungsverhältnis der beiden kollidierenden Prinzipien auflöst. Die folgenden Schlussbetrachtungen beschäftigen sich mit Kritik am Caroline-Urteil und an der Methodik des EGMR.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Caroline-von-Hannover-Urteil des EGMR
- 2.1 Hintergrund
- 2.2 Sachverhalt und Prozessgeschichte vor den deutschen Gerichten
- 2.3 Die Entscheidung des EGMR am 24. Juni 2004
- 3. Die Prinzipienkollision nach Robert Alexy
- 3.1 Dualismus von Prinzip und Regel
- 3.2 Kritik am Dualismus der Prinzipientheorie
- 3.3 Das Kollisionsgesetz nach Alexy, illustriert am Lebach-Urteil vom 5. Juni 1973 des BVerfG
- 4. Anwendung der Prinzipientheorie von Robert Alexy auf das Caroline-Urteil des EGMR
- 4.1 Der Schutzbereich des Art. 10 Abs. 1 EMRK
- 4.2 Der Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 EMRK
- 4.3 Herleitung des Urteils unter Anwendung der allgemeinen Grundsätze durch den Gerichtshof im Lichte der Prinzipientheorie
- 5. Schlussbetrachtungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht das Caroline-von-Hannover-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im Lichte der Theorie der Grundrechte von Robert Alexy. Die Arbeit analysiert die Kollision der Prinzipien Privatsphäre und Pressefreiheit im konkreten Fall und untersucht, ob und inwieweit der EGMR im Sinne Alexys das Spannungsverhältnis zwischen diesen Prinzipien auflöst.
- Das Caroline-von-Hannover-Urteil und seine Bedeutung für die Kollision von Privatsphäre und Pressefreiheit
- Die Prinzipientheorie von Robert Alexy und ihre Anwendung auf die Auflösung von Prinzipienkollisionen
- Die Abwägung der Prinzipien Privatsphäre und Pressefreiheit im Caroline-Urteil
- Die Methodik des EGMR im Vergleich zu Alexys Theorie der Grundrechte
- Kritik am Caroline-Urteil und an der Methodik des EGMR
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Caroline-von-Hannover-Urteil des EGMR vor und skizziert die Problematik der Kollision von Privatsphäre und Pressefreiheit. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Reaktionen auf das Urteil in der deutschen Presse und gibt einen Überblick über die Gliederung der Arbeit.
Kapitel 2 beleuchtet den Hintergrund des Caroline-von-Hannover-Urteils, indem es Caroline von Hannover als Person vorstellt und ihre Auseinandersetzung mit der Presse in den neunziger Jahren schildert. Anschließend wird der Sachverhalt des Falls dargestellt, wobei die Prozessgeschichte vor den deutschen Gerichten detailliert nachvollzogen wird. Schließlich wird die Entscheidung des EGMR vom 24. Juni 2004 zusammengefasst.
Kapitel 3 widmet sich der Theorie der Grundrechte von Robert Alexy. Es wird zunächst die Unterscheidung zwischen Prinzipien und Regeln erläutert, wobei die Kritik an Alexys Dualismus zwischen diesen beiden Normgattungen beleuchtet wird. Anschließend wird das Kollisionsgesetz nach Alexy vorgestellt und anhand des Lebach-Urteils des BVerfG illustriert.
Kapitel 4 wendet die Prinzipientheorie von Robert Alexy auf das Caroline-von-Hannover-Urteil an. Zunächst werden die Schutzbereiche der in Art. 10 Abs. 1 EMRK und Art. 8 Abs. 1 EMRK garantierten Rechte auf freie Meinungsäußerung und Achtung des Privatlebens detailliert dargestellt. Anschließend wird die Herleitung des EGMR-Urteils unter Betrachtung der allgemeinen Grundsätze des Gerichtshofs im Lichte der Prinzipientheorie untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Caroline-von-Hannover-Urteil, die Prinzipienkollision, die Theorie der Grundrechte von Robert Alexy, das Abwägungsgesetz, das Kollisionsgesetz, der Schutz der Privatsphäre, die Pressefreiheit, die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), die deutsche Rechtsprechung, die deutsche Verfassung, das Kunsturhebergesetz (KUG), das allgemeine Persönlichkeitsrecht, die Person der Zeitgeschichte, die Resozialisierung, die Meinungsfreiheit, die Informationsfreiheit, die Medienberichterstattung, die Bildveröffentlichung, die Schutzpflichten des Staates, die Abwägungsentscheidung, die Rechtsprechung des EGMR, die Kritik am Caroline-Urteil.
Häufig gestellte Fragen
Worum ging es im Caroline-von-Hannover-Urteil?
Es handelte von der Kollision zwischen dem Schutz der Privatsphäre einer prominenten Person und der Pressefreiheit bei der Veröffentlichung von Fotos.
Was besagt Robert Alexys "Theorie der Grundrechte"?
Alexy unterscheidet zwischen Regeln und Prinzipien, wobei Prinzipien als "Optimierungsgebote" in Kollisionsfällen gegeneinander abgewogen werden müssen.
Wie löst der EGMR Prinzipienkollisionen auf?
Der Gerichtshof nutzt Abwägungskriterien, um festzustellen, welches Recht (Art. 8 EMRK Privatleben oder Art. 10 EMRK Meinungsfreiheit) im Einzelfall Vorrang hat.
Was ist der Unterschied zwischen Regeln und Prinzipien?
Regeln sind Normen, die entweder erfüllt sind oder nicht, während Prinzipien in unterschiedlichem Maße realisiert werden können.
Welche Kritik gibt es am Caroline-Urteil?
Kritiker bemängeln oft eine zu starke Einschränkung der Pressefreiheit bei Personen der Zeitgeschichte oder eine mangelnde methodische Klarheit des EGMR.
- Arbeit zitieren
- Maria Herwig (Autor:in), 2011, Das Caroline-von-Hannover-Urteil des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Lichte von Robert Alexys "Theorie der Grundrechte", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212872