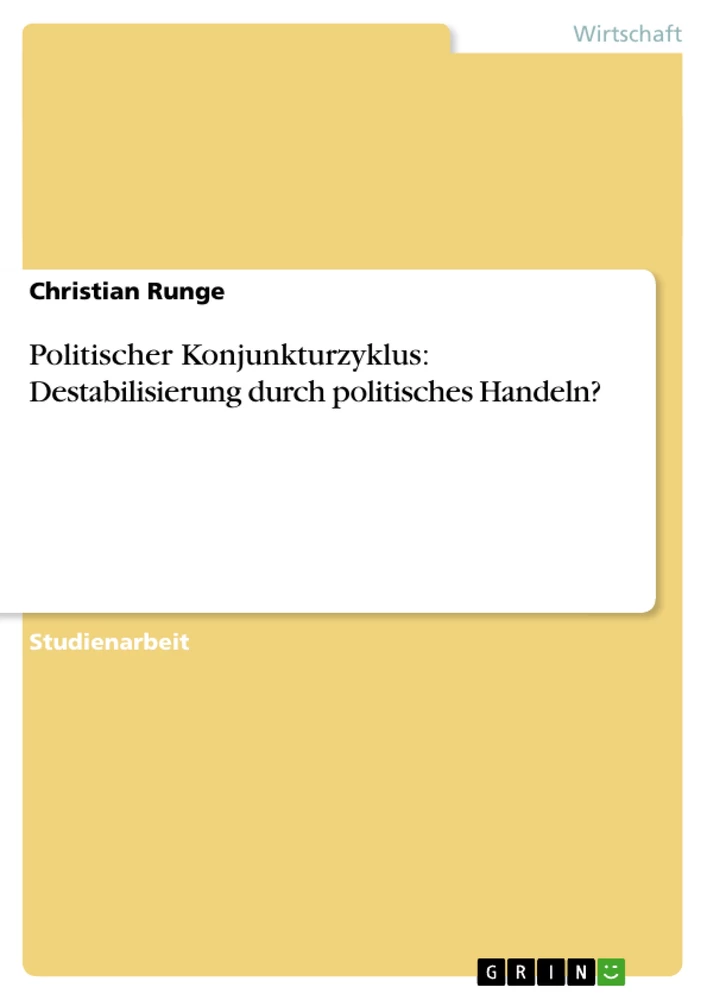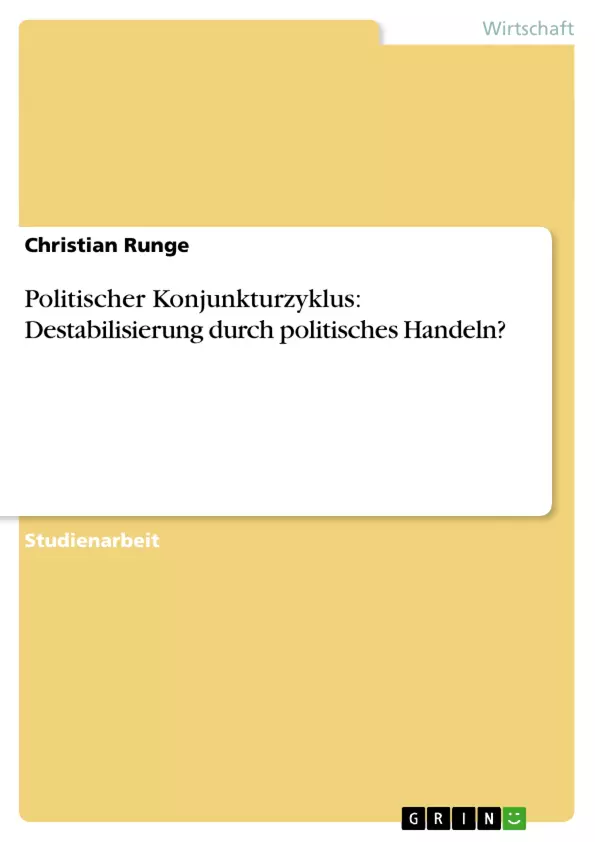Die traditionelle Volkswirtschaftslehre sieht den Staat als „wohlwollenden Diktator“, unterstellt den privaten Haushalten und Unternehmen Nutzenmaximierung. Die Anhänger der „Neuen Politischen Ökonomie“ stellen diese Annahmen aber in Frage. Vielmehr unterstellen sie dem Staat anstelle der allgemeinen Wohlfahrt selbst auch Nutzenmaximierung. Sie gehen deshalb davon aus, dass für Politiker die Wiederwahl im Vordergrund steht. Denn nur die Wiederwahl sichert den Machterhalt und damit Privilegien wie Einkommen und Prestige. Die Theorie des politischen Konjunkturzyklus geht noch weiter und besagt, dass Regierungen durch Wiederwahlinteressen grundsätzlich konjunkturelle Schwankungen auslösen können. Oder können Politiker durch ihre Wiederwahlinteressen sogar destabilisierend auf die Wirtschaft einwirken? Diese Fragestellung soll in dieser Arbeit kritisch untersucht werden.
Um einen geeigneten Einstieg in die Thematik zu ermöglichen, werden zu Beginn die wichtigen Begrifflichkeiten und Inhalte der (politischen) Konjunkturtheorie dargestellt. Im Hauptteil dieser Arbeit gehen wir auf die unterschiedlichen theoretischen Ansätze der politischen Konjunkturzyklen ein. Hierbei werden die drei Ansätze vorgestellt: Der Nordhaus-Ansatz, der das Wiederwahlinteresse der Regierung in den Vordergrund stellt, um politische Konjunkturzyklen zu erzeugen. Ein weiterer Grund, einen politischen Konjunkturzyklus zu erzeugen, besteht aus ideologischen Gründen. Bei der Partisan-Theorie und der Rationalen Partisan-Theorie stellt dieser Grund den zentralen Aspekt dar.
Die Schlussbetrachtung reflektiert die gewonnenen Erkenntnisse und setzt diese in Bezug auf die historische wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei werden vor allem wegen der Unterscheidung in den ideologischen Theorien die zwei Koalitionen aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegenübergestellt.
Abschließend werden die Theorien auch im Hinblick auf aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen kritisch gewürdigt und es erfolgt eine eindeutige Stellungnahme zur Theorie des politischen Konjunkturzyklus. Es werden zudem Möglichkeiten vorgestellt, politische Konjunkturzyklen zu verhindern, sofern sie bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konjunkturzyklen
- Definition „Konjunkturzyklus“
- Phasen des Konjunkturzyklus
- Konjunkturindikatoren und Ursachen
- Strategien und Instrumentarien
- Politische Konjunkturzyklen
- Definition „Politischer Konjunkturzyklus“
- Ursachen politischer Konjunkturzyklen
- Wiederwahlinteressen
- Die Opportunistische Theorie
- Der Nordhaus-Ansatz
- Kritik an der Nordhaus-Theorie
- Ideologieorientierung
- Die Partisan-Theorie (PT)
- Kritik an der Partisan-Theorie
- Die Rationale Partisan-Theorie (RPT)
- Kritik an der Rationalen Partisan-Theorie
- Wiederwahlinteressen
- Politische Konjunkturzyklen anhand empirischer Daten
- Kritische Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch, ob und inwiefern Politiker durch ihr Wiederwahlinteresse destabilisierend auf die Wirtschaft und damit auf Konjunkturzyklen einwirken können. Die traditionelle Annahme eines wohlwollenden Staates wird hinterfragt und durch den Ansatz der Neuen Politischen Ökonomie ersetzt, der die Nutzenmaximierung von Politikern in den Vordergrund stellt.
- Definition und Phasen des Konjunkturzyklus
- Theorien zu politischen Konjunkturzyklen (Nordhaus-Ansatz, Partisan-Theorie, Rationale Partisan-Theorie)
- Analyse der Wiederwahlinteressen von Politikern als Ursache für Konjunkturzyklen
- Einfluss von Ideologie auf politische Konjunkturzyklen
- Empirische Überprüfung der Theorien anhand von Daten.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem destabilisierenden Einfluss von Politikern auf die Wirtschaft durch Wiederwahlinteressen vor. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der in der Darstellung der Konjunkturtheorie, der Vorstellung verschiedener theoretischer Ansätze zu politischen Konjunkturzyklen und schließlich in einer kritischen Schlussbetrachtung gipfelt, welche die Erkenntnisse auf die deutsche Wirtschaftsgeschichte bezieht und aktuelle Entwicklungen einbezieht.
Konjunkturzyklen: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Konjunkturzyklus und beschreibt dessen Phasen (Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung, Krise/Rezession). Es betont die Regelmäßigkeit dieser Zyklen, die sich historisch mit der Industrialisierung herausbildeten und im Zusammenhang mit der Koordinierung arbeitsteiliger Produktionsverbände über Märkte stehen. Die Beschreibung der einzelnen Phasen beinhaltet Angaben zur Kapazitätsauslastung, Arbeitslosigkeit und Investitionsbereitschaft.
Politische Konjunkturzyklen: Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Theorien, die den Einfluss politischen Handelns auf Konjunkturzyklen erklären. Es werden der Nordhaus-Ansatz, der das Wiederwahlinteresse als zentralen Faktor hervorhebt, und die Partisan-Theorie und die Rationale Partisan-Theorie, die den Einfluss von Ideologie betonen, detailliert vorgestellt und kritisch beleuchtet. Die verschiedenen Ansätze werden verglichen und ihre Stärken und Schwächen diskutiert.
Schlüsselwörter
Politischer Konjunkturzyklus, Konjunkturtheorie, Wiederwahlinteresse, Opportunistische Theorie, Nordhaus-Ansatz, Partisan-Theorie, Rationale Partisan-Theorie, Ideologieorientierung, Wirtschaftspolitik, Empirische Daten, Bundesrepublik Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse Politischer Konjunkturzyklen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht kritisch den Einfluss von Politikern auf Konjunkturzyklen, insbesondere die Frage, ob und inwieweit das Wiederwahlinteresse von Politikern zu einer Destabilisierung der Wirtschaft führt. Sie hinterfragt die Annahme eines wohlwollenden Staates und nutzt den Ansatz der Neuen Politischen Ökonomie, der die Nutzenmaximierung von Politikern in den Mittelpunkt stellt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Phasen von Konjunkturzyklen, verschiedene Theorien zu politischen Konjunkturzyklen (Nordhaus-Ansatz, Partisan-Theorie, Rationale Partisan-Theorie), die Analyse von Wiederwahlinteressen als Ursache für Konjunkturzyklen, den Einfluss von Ideologie auf politische Konjunkturzyklen und eine empirische Überprüfung der Theorien anhand von Daten. Die Arbeit gipfelt in einer kritischen Schlussbetrachtung, die die Erkenntnisse auf die deutsche Wirtschaftsgeschichte bezieht und aktuelle Entwicklungen einbezieht.
Welche Theorien zu politischen Konjunkturzyklen werden vorgestellt und analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert den Nordhaus-Ansatz, der das Wiederwahlinteresse als zentralen Faktor für politische Konjunkturzyklen hervorhebt, sowie die Partisan-Theorie und die Rationale Partisan-Theorie, welche den Einfluss von Ideologie betonen. Die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze werden verglichen und diskutiert. Im Kontext des Nordhaus-Ansatzes werden die Opportunistische Theorie und Kritik an der Nordhaus-Theorie behandelt. Die Partisan-Theorie und die Rationale Partisan-Theorie werden jeweils kritisch beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Konjunkturzyklen (Definition, Phasen, Indikatoren), ein Kapitel zu politischen Konjunkturzyklen (verschiedene Theorien), ein Kapitel zur empirischen Überprüfung der Theorien anhand von Daten und eine kritische Schlussbetrachtung. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Das Kapitel zu Konjunkturzyklen beschreibt die Regelmäßigkeit dieser Zyklen und den Zusammenhang mit der Koordinierung arbeitsteiliger Produktionsverbände über Märkte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Politischer Konjunkturzyklus, Konjunkturtheorie, Wiederwahlinteresse, Opportunistische Theorie, Nordhaus-Ansatz, Partisan-Theorie, Rationale Partisan-Theorie, Ideologieorientierung, Wirtschaftspolitik, Empirische Daten, Bundesrepublik Deutschland.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit erwähnt die Verwendung empirischer Daten zur Überprüfung der vorgestellten Theorien. Die spezifischen Datenquellen und die Art der empirischen Analyse werden jedoch nicht im Überblick detailliert beschrieben.
- Arbeit zitieren
- Christian Runge (Autor:in), 2003, Politischer Konjunkturzyklus: Destabilisierung durch politisches Handeln?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21288