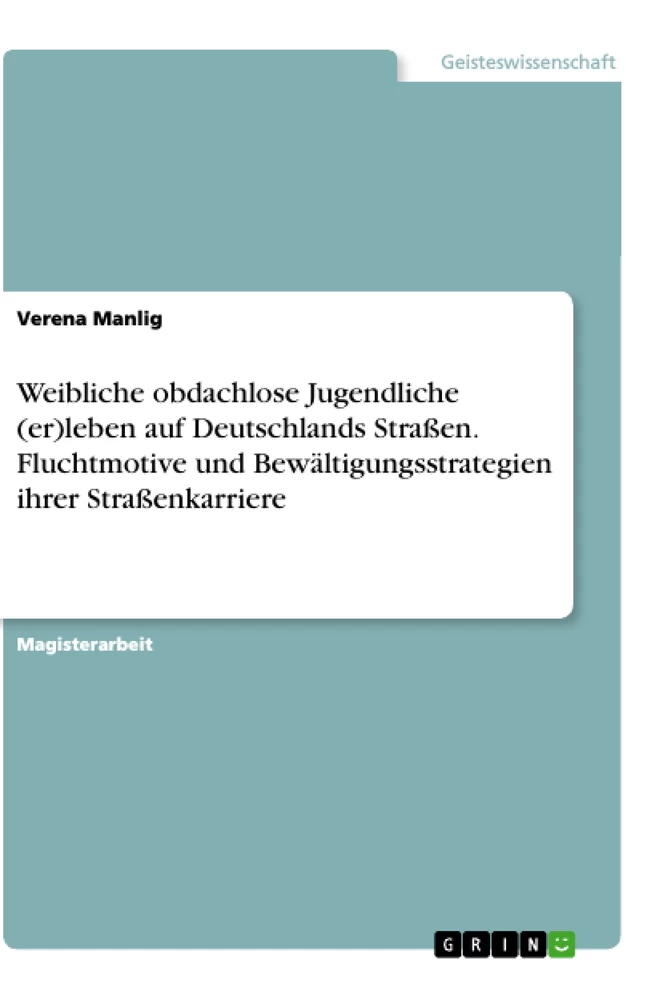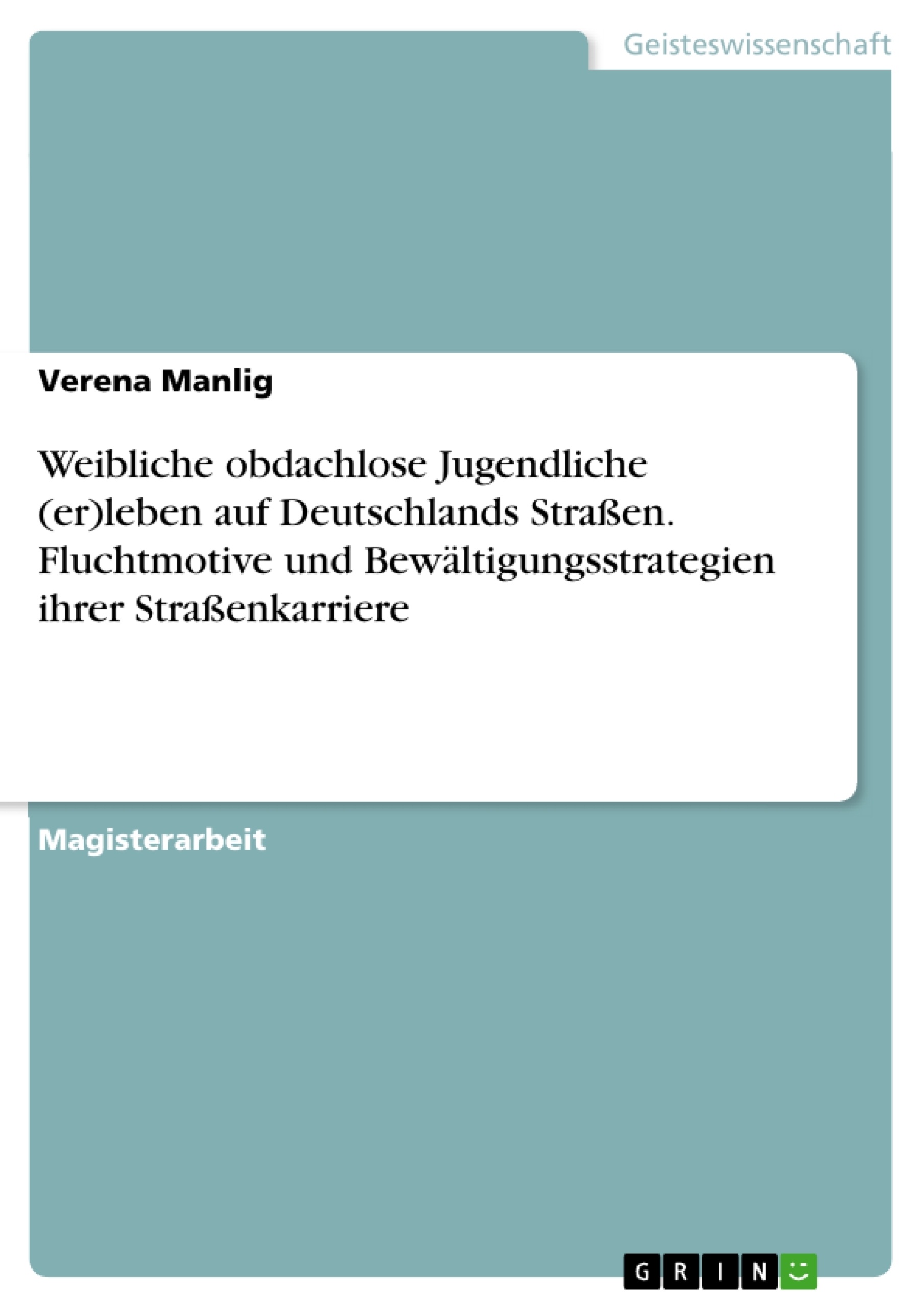Wie sieht die aktuelle Situation in Deutschland aus und unter welchen Lebensumständen verbringen deutsche Kinder und Jugendliche ihren Alltag? Was treibt sie dazu von zu Hause wegzugehen und sich für ein Leben auf der Straße zu entscheiden? Die Heterogenität des Phänomens schlägt sich auch in einer Vielfalt der Rahmenbedingungen nieder, die in dieser Arbeit genauer dargelegt werden. Das daraus entstandene Zusammenspiel familiärer, schulischer und gesellschaftlicher Faktoren verdeutlicht die Komplexität dieser Problematik, denen sich Jugendliche zwangsläufig stellen müssen.
Um das Thema der Straßenkinderproblematik inhaltlich und strukturell einzugrenzen, liegt der Fokus in dieser schriftlichen Arbeit ausschließlich auf den Problemlagen von weiblichen Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Im empirischen Teil liegt der Fokus auf den qualitativen Interviews mit drei weiblichen Straßenjugendlichen aus Berlin. Die Erzählungen und Erfahrungsberichte der Mädchen geben einen tiefgehenden Einblick über das Straßenleben, wie es sich in Wirklichkeit darstellt. Dadurch wird diese Arbeit in ihrer Glaubwürdigkeit und in ihrem Wesenskern nachhaltig gestärkt.
Als Einstieg in das Thema wird der Begriff „Straßenkind“ definiert. Anschließend werden anhand der Definition aktuelle Statistiken über Wohnungslose in Deutschland ausgewertet. Des Weiteren wird der Forschungsstand von weiblicher Sozialisation dargelegt, der den Entwicklungsprozess von weiblichen Jugendlichen maßgeblich beeinflusst. In Folge dessen tragen diese Risikofaktoren entscheidend dazu bei, dass weibliche Jugendliche schlussendlich beschließen ihre Familie zu verlassen und auf der Straße zu leben. Mittels der qualitativen Interviews werden neue Erkenntnisse gewonnen, erläutert und anschließend anhand herausgearbeiteter Charaktermerkmale dargelegt. Die Aussagekraft der typischen Verhaltensweisen wird dadurch untermauert, da sie in Bezug auf die klassischen Theorien belegt werden, worauf in Kapitel 6.5 näher eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Straßenkinderproblematik in Deutschland
- 2.1 Begriffserläuterungen
- 2.1.1 Definition von Wohnungslosigkeit
- 2.1.2 Definition des Begriffs „Straßenkind“
- 2.2 Zahlenmaterial & Statistiken über deutsche Obdachlose
- 2.1 Begriffserläuterungen
- 3. Forschungsgegenstand weiblicher Sozialisation im Hinblick auf die Straßenflucht
- 3.1 Weibliche Entwicklungstendenzen im Zuge eines fortschreitenden Individualisierungsprozesses
- 3.1.1 Weibliche Sozialisation in der Adoleszenz
- 3.1.2 Einfluss von Peer-Groups
- 3.1.3 Problematik der Frauenrolle
- 3.2 Wege in die Wohnungslosigkeit
- 3.2.1 Forschungsgegenstand von Fluchtmotiven weiblicher Straßenjugendlicher
- 3.2.2 Familiäre Risikofaktoren
- 3.1 Weibliche Entwicklungstendenzen im Zuge eines fortschreitenden Individualisierungsprozesses
- 4. Theoretischer Hintergrund
- 4.1 Einbettung in sozialstrukturellen Kontext
- 4.2 Klassische Kriminalitätstheorien
- 4.2.1 Ätiologische Kriminalsoziologie basierend auf der Anomietheorie von Merton
- 4.2.2 Labeling approach
- 5. Qualitative Sozialforschung
- 5.1 Planungsphase und Darstellung meiner Forschung
- 5.1.1 Untersuchungsmethode mittels eines qualitativen Interviews
- 5.1.2 Erstellung des Leitfadens
- 5.2 Durchführungsphase
- 5.2.1 Methodisches Vorgehen in der Praxis: Die Kontaktaufnahme
- 5.2.2 Datenerhebung mittels der durchgeführten Interviews
- 5.2.3 Auswertung der Interviews
- 5.1 Planungsphase und Darstellung meiner Forschung
- 6. Ergebnisse charakterisierender Merkmale weiblicher Straßenjugendlicher anhand der Interviews
- 6.1 Interview mit „M.“ (15 Jahre alt)
- 6.1.1 Darstellung von „M.“ Lebenserfahrungen in der Familie
- 6.1.2 Wichtige Stationen während ihres Straßenlebens
- 6.2 Interview mit „E.“ (17 Jahre alt)
- 6.2.1 Biographische Auszüge aus ihrer familiären Lebenssituation
- 6.2.2 „E.“ Straßenkarriere
- 6.3 Interview mit „S.“ (20 Jahre alt)
- 6.3.1 „S.“ Leben vor ihrer Straßenflucht
- 6.3.2 „S.“ Erfahrungen im Straßenalltag
- 6.4 Vergleichende Darstellung hinsichtlich ihrer Merkmalsausprägungen
- 6.4.1 Gewalt in der Familie
- 6.4.2 Bezug zur Schule
- 6.4.3 Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung
- 6.4.4 Fremd- und Selbstbild
- 6.4.5 Bewältigungsstrategien im Straßenalltag
- 6.4.6 Beziehungs- und Sexualverhalten
- 6.4.7 Suchtverhalten hinsichtlich des Alkohol- und Drogenkonsums
- 6.4.7.1 Alkoholsucht
- 6.4.7.2 Drogensucht
- 6.4.8 Strafauffälligkeit
- 6.4.9 Subkulturelle Beziehungen und Szenestrukturen
- 6.4.10 Einfluss von Peer Groups
- 6.4.11 Erfahrungen mit öffentlichen Beratungsstellen
- 6.4.12 Wünsche und Zukunftsperspektiven
- 6.5 Theoretische Einbindungen
- 6.5.1 Struktureller Zusammenhang
- 6.5.2 Überprüfung der herausgearbeiteten Merkmale im Hinblick auf die Anomietheorie von Merton
- 6.5.3 Empirische Untersuchung des Datenmaterials hinsichtlich des Labeling approach Ansatzes
- 6.1 Interview mit „M.“ (15 Jahre alt)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Lebensrealität weiblicher obdachloser Jugendlicher in Deutschland. Ziel ist es, Fluchtmotive und Bewältigungsstrategien dieser jungen Frauen zu analysieren und in einen sozialstrukturellen Kontext einzuordnen. Die Arbeit basiert auf qualitativen Interviews.
- Fluchtmotive aus familiären Kontexten
- Bewältigungsstrategien im Straßenalltag
- Einfluss von Peer-Groups und sozialen Netzwerken
- Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung
- Anwendung kriminologischer Theorien (Anomietheorie, Labeling Approach)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der weiblichen Straßenjugend ein und beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit. Es skizziert die Bedeutung der Untersuchung und benennt die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen. Die Einleitung stellt den Rahmen für die gesamte Arbeit dar und begründet die Relevanz der Thematik im Kontext der deutschen Sozialstruktur.
2. Straßenkinderproblematik in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die allgemeine Problematik von Straßenkindern in Deutschland. Es definiert die zentralen Begriffe „Wohnungslosigkeit“ und „Straßenkind“ und präsentiert relevante Zahlen und Statistiken zur Ausbreitung von Obdachlosigkeit. Der Fokus liegt auf der Darstellung des sozialen Problems und der Herausforderungen, die damit verbunden sind.
3. Forschungsgegenstand weiblicher Sozialisation im Hinblick auf die Straßenflucht: Dieses Kapitel untersucht die spezifischen Aspekte der weiblichen Sozialisation, die zur Straßenflucht beitragen können. Es analysiert Entwicklungstendenzen im Kontext von Individualisierung, den Einfluss von Peer-Groups, die Problematik der Frauenrolle sowie die Wege, die zu Wohnungslosigkeit führen. Es stellt den Zusammenhang zwischen sozialer Entwicklung und der Wahl der Straße als Lebensraum her.
4. Theoretischer Hintergrund: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit erläutert. Es werden klassische Kriminalitätstheorien, insbesondere die Anomietheorie von Merton und der Labeling Approach, vorgestellt und auf die Lebenssituation der befragten Jugendlichen angewendet. Die theoretischen Konzepte dienen als Analyseinstrument für die Interpretation der empirischen Daten.
5. Qualitative Sozialforschung: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Studie. Es erläutert die Planung und Durchführung der qualitativen Interviews, inklusive der Erstellung des Leitfadens und der Datenerhebung. Die Auswertungsmethodik wird detailliert dargestellt und begründet. Der Fokus liegt auf der Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses.
6. Ergebnisse charakterisierender Merkmale weiblicher Straßenjugendlicher anhand der Interviews: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit drei jungen Frauen. Die einzelnen Interviews werden detailliert analysiert und die Ergebnisse werden vergleichend dargestellt. Dabei werden verschiedene Merkmale der befragten Jugendlichen im Hinblick auf ihre familiäre Situation, ihre Erfahrungen auf der Straße, ihr Sozialverhalten, ihre Suchtproblematik, und ihre Zukunftsperspektiven untersucht. Die Ergebnisse werden in den theoretischen Kontext der vorherigen Kapitel eingebunden.
Schlüsselwörter
Wohnungslosigkeit, Straßenkinder, weibliche Jugend, Sozialisation, Fluchtmotive, Bewältigungsstrategien, Peer-Groups, Anomietheorie, Labeling Approach, qualitative Sozialforschung, Familienkonflikte, Sucht, Kriminalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Weibliche Straßenjugendliche in Deutschland
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Lebensrealität weiblicher obdachloser Jugendlicher in Deutschland. Der Fokus liegt auf der Analyse der Fluchtmotive und Bewältigungsstrategien dieser jungen Frauen und deren Einordnung in einen sozialstrukturellen Kontext. Die Studie basiert auf qualitativen Interviews.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht u.a. die Fluchtmotive aus familiären Kontexten, Bewältigungsstrategien im Straßenalltag, den Einfluss von Peer-Groups und sozialen Netzwerken, die Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen Jugendlichen sowie die Anwendung kriminologischer Theorien (Anomietheorie, Labeling Approach) auf ihre Lebensumstände.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet qualitative Sozialforschung, konkret qualitative Interviews mit drei jungen Frauen. Die Planungsphase umfasste die Erstellung eines Leitfadens. Die Durchführung umfasste die Kontaktaufnahme, die Datenerhebung mittels der Interviews und die anschließende Auswertung der Interviewdaten. Die Methodik wird detailliert in der Arbeit dargestellt.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf klassische Kriminalitätstheorien, insbesondere die Anomietheorie von Merton und den Labeling Approach. Diese Theorien dienen als Analyseinstrument zur Interpretation der empirischen Daten aus den Interviews.
Wer sind die Interviewpartnerinnen?
Die Studie beinhaltet Interviews mit drei jungen Frauen („M.“ (15 Jahre), „E.“ (17 Jahre) und „S.“ (20 Jahre)), die Erfahrungen mit Wohnungslosigkeit gemacht haben. Die Interviews beleuchten ihre individuellen Lebensgeschichten, ihre familiären Hintergründe, ihre Erfahrungen auf der Straße und ihre Bewältigungsstrategien.
Welche Aspekte der Lebensrealität weiblicher Straßenjugendlicher werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Merkmale der befragten Jugendlichen, inklusive Gewalt in der Familie, Schulbezug, Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung, Selbst- und Fremdbild, Bewältigungsstrategien, Beziehungs- und Sexualverhalten, Suchtverhalten (Alkohol und Drogen), Strafauffälligkeit, subkulturelle Beziehungen, Erfahrungen mit Beratungsstellen und Zukunftsperspektiven.
Wie werden die Ergebnisse der Interviews dargestellt und analysiert?
Die Ergebnisse der einzelnen Interviews werden detailliert analysiert und anschließend vergleichend dargestellt. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die angewandten Theorien (Anomietheorie und Labeling Approach) interpretiert und in einen strukturellen Zusammenhang eingeordnet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Straßenkinderproblematik in Deutschland, Forschungsgegenstand weiblicher Sozialisation, Theoretischer Hintergrund, Qualitative Sozialforschung und Ergebnisse der Interviews. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Wohnungslosigkeit, Straßenkinder, weibliche Jugend, Sozialisation, Fluchtmotive, Bewältigungsstrategien, Peer-Groups, Anomietheorie, Labeling Approach, qualitative Sozialforschung, Familienkonflikte, Sucht, Kriminalität.
Welche Zielsetzung verfolgt die Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit zielt darauf ab, die Lebensrealität weiblicher obdachloser Jugendlicher zu verstehen, ihre Fluchtmotive und Bewältigungsstrategien zu analysieren und diese in einen sozialstrukturellen Kontext einzuordnen. Die Ergebnisse sollen einen Beitrag zum Verständnis dieser komplexen Thematik leisten.
- Citation du texte
- Verena Manlig (Auteur), 2011, Weibliche obdachlose Jugendliche (er)leben auf Deutschlands Straßen. Fluchtmotive und Bewältigungsstrategien ihrer Straßenkarriere, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212906