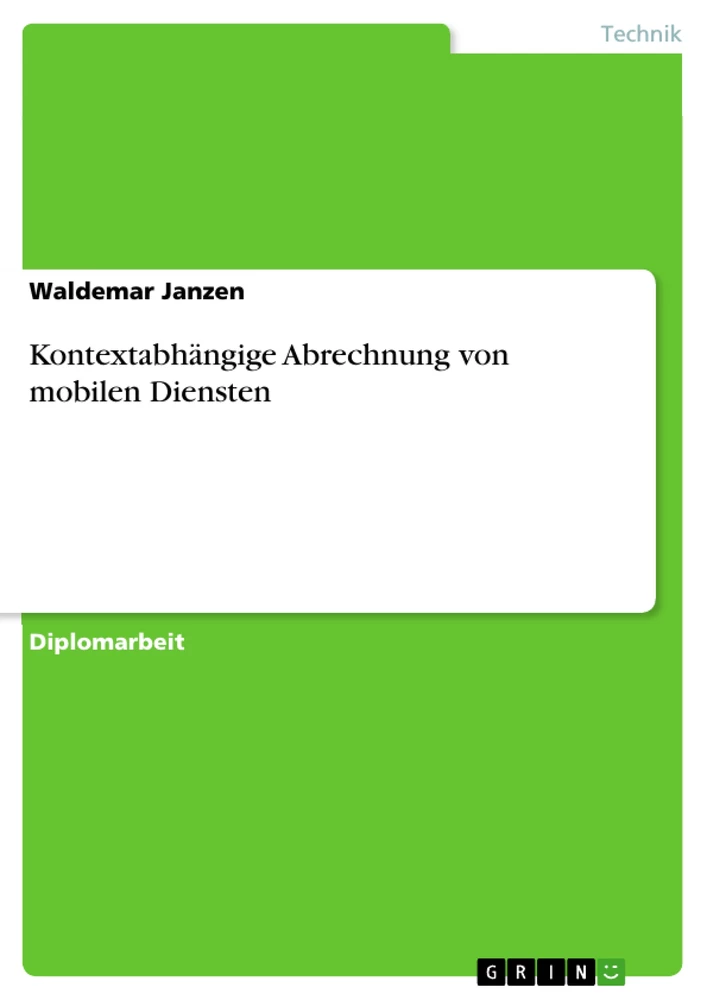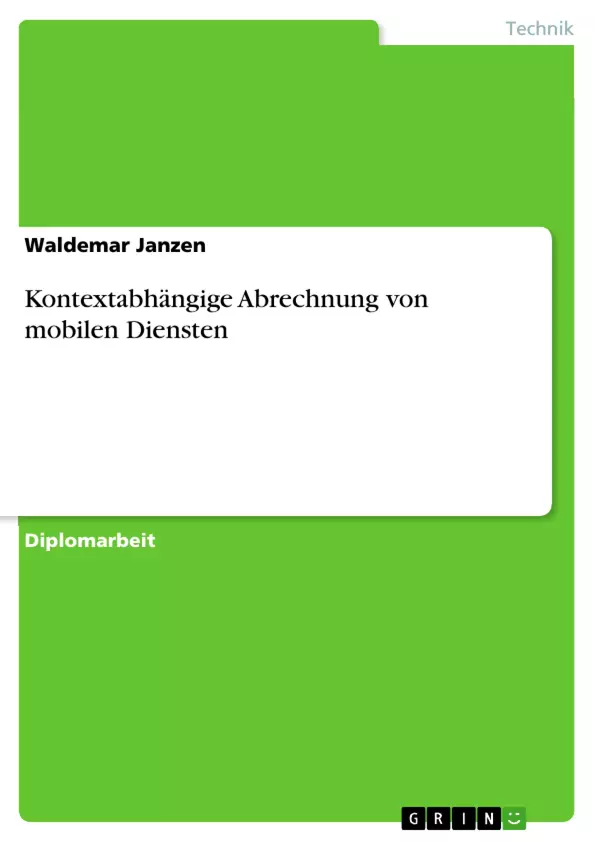Für die kontextabhängige Abrechnung wird zunächst anhand einer Analyse existierender mobiler Dienste festgestellt, welcher Art Kontextinformationen sein können, für die es sinnvoll erscheint, sie bei der Abrechnung innovativer mobiler Dienste zu berücksichtigen. Dann wird geklärt, welche Komponenten in einem Abrechnungssystem welche Kontextinformationen speichern, verarbeiten oder anderen Komponenten übermitteln sollen. Für die maschinelle Handhabung von Kontextinformationen wird ein geeignetes Vokabular in Form einer Kontextontologie identifiziert, anhand derer dann Abrechnungsregeln spezifiziert werden können.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Motivation
1.2 Laufendes Beispiel
1.3 Ziele der Arbeit
1.4 Eingrenzung des Themas
1.4.1 B2C und B2B
1.4.2 Informationsdienste und technische Dienste
1.4.3 Zweck der Kontextinformationen
1.5 Vorgehensweise
2 Grundlagen zur Abrechnung im Mobilfunk
2.1 Begriffsdefinitionen
2.2 Abrechnungsprozess im Mobilfunk
2.3 Szenarien zur Abrechnung mobiler Dienste
2.4 Standardschnittstelle zur Abrechnung mobiler Dienste
2.4.1 Direkte Kontobelastungen und -gutschriften
2.4.2 Advice of Charge
2.4.3 Session-basierte Abrechnung
2.4.4 Beispiel einer Charging Session
3 Die LOMS-Plattform
3.1 Das LOMS Rollenmodell
3.2 LOMS-Systemarchitektur
3.3 Ansatzpunkte für die Abrechnung der LOMS-Dienste
4 Verfahren zur Abrechnung anhand von Kontextinformationen
4.1 Was ist Kontext?
4.2 Marktanalyse zu kontextabhängigen mobilen Diensten
4.2.1 Beispielhafte Dienste
4.2.2 Ergebnis der analysierten Beispiele
4.3 Darstellungs- und Verarbeitungskonzepte für Kontextinformationen
4.3.1 Key-Value Paare
4.3.2 Markup Schemes
4.3.3 Graphical Models
4.3.4 Object Oriented Models
4.3.5 Logic Based Models
4.3.6 Ontology Based Models
4.4 Schlussfolgerung
5 Anforderungen
5.1 Schnittstellenanforderungen
5.1.1 Schnittstelle zu den Abrechnungssystemen der MNOs
5.1.2 Standardisierte Abrechnungsschnittstellen
5.1.3 Einfache Pflege von Abrechnungsregeln
5.1.4 Bereitstellung und Abruf von Kontextinformationen
5.2 Anforderungen an das kontextabhängige Abrechnungskonzept
5.3 Nebenbedingungen
6 Notwendige Anpassungen auf der LOMS-Plattform
6.1 Aufgaben der Akteure
6.2 Betroffene Systemkomponenten
6.2.1 Beispielhafter Ablauf
6.3 Schnittstellenspezifikation
6.3.1 Schnittstelle A: Customer Self-Care
6.3.2 Schnittstelle B: Get Profile Data
6.3.3 Schnittstelle C: Update Service Templates
6.3.4 Schnittstelle D: Charge Service Usage
6.3.5 Schnittstelle E: Update Charging Rules
6.3.6 Schnittstelle F: Calculate Discount
7 Konzept zur kontextabhängigen Abrechnung
7.1 Vorgehen für das kontextabhängige Rating
7.2 Struktur und Verwendung der Kontextdaten
7.2.1 Kontextverarbeitung zur Ermittlung von Rabatten
7.2.2 Revenue Sharing
7.3 Abrechnungsbeispiel
7.4 Ergebnis des vorgestellten Konzepts
8 Implementierung
8.1 Auswahl eines Ontologie-Frameworks
8.1.1 Ontologie-Frameworks
8.1.2 Das Ontologie-Framework Jena
8.1.3 Das Ontologie-Framework Protégé
8.1.4 Kontextabhängige Abrechnung mit Protégé und Jena
8.2 Technologien des implementierten Prototyps
8.3 Benutzeroberflächen
8.3.1 Benutzeroberfläche für Customer Self-Care
8.3.2 Benutzeroberfläche für Update Charging Rules
8.4 Evaluation
8.4.1 Kontextabhängige Abrechnung des Local News Service
8.4.2 Erweiterung der Basis-Ontologie
8.4.3 Erfüllung der Anforderungen
9 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Internet-Referenzen
Anhang
1 Einleitung
Besitzer von Mobilfunkgeräten geben weltweit immer mehr Geld für kontextabhängige Informationsdienste aus. Nach einem Bericht des Marktanalysten Strategy Analytics [1] werden sich die weltweiten Ausgaben der Endkunden für ortsbezogene Dienste bis zum Jahr 2011 auf jährlich 4,3 Milliarden Euro mehr als versechsfachen - 2006 beliefen sich die Ausgaben noch auf 643 Millionen Euro. Die Analysten schätzen für das Jahr 2011 die Anzahl der zahlungsbereiten Kunden für ortsbezogene Dienste wie On- line-Navigation, Kinderortung oder Stadtführer auf knapp 95 Millionen (2006: 20,1 Mil- lionen) ein. Neben ortsbezogenen Diensten, die in den letzten Jahren stark weiterent- wickelt wurden, gewinnen auch weitere Dienste, die sich direkt auf den Kontext des Anwenders beziehen, an Bedeutung.
1.1 Motivation
Auf dem Mobilfunkmarkt zeichnet sich die Situation ab, dass einem großen bislang unausgeschöpften Potential von Anwendungsgebieten in Form von innovativen mo- bilen Mehrwertdiensten leider noch keine adäquate Infrastruktur gegenüber steht. Für viele Firmen oder auch Personen wäre es interessant, als so genannte Drittanbie- ter ihre eigenen innovativen mobilen Dienste anzubieten, die der Nachfrage von Mo- bilfunkkunden entsprechen und wofür diese auch zu bezahlen bereit wären. Beispiels- weise könnten Mobilfunkkunden, die einer bestimmten Interessengruppe angehören – wie etwa ein Freundeskreis oder Angler, mit einem mobilen Dienst über aktuelle Ereig- nisse oder Gegebenheiten des Aufenthaltsortes informiert werden.
Auf dem Telekommunikationsmarkt werden zwar schon viele mobile Mehrwertdienste angeboten, doch sind die damit verbundenen Integrationsaufgaben zwischen Drit- tanbietern und Mobilfunkgesellschaften (MNO – Mobile Network Operator) mit ei- nem hohen wirtschaftlichen und technischen Aufwand verbunden, der insbesondere auch mit der Abrechnung der angebotenen Dienste zusammenhängt. Die Reduzierung des Integrationsaufwandes durch eine geeignete Infrastruktur würde die Installation und Verbreitung mobiler Dienste für Drittanbieter vereinfachen. Den Anbietern der Infrastruktur und der Dienste werden dadurch finanzielle Erträge und eine engere Kundenbindung ermöglicht und die Kunden profitieren von neuen ständig verfügba- ren Diensten, die deren Interessen besser entsprechen können.
Ein Ansatz für eine solche Infrastruktur wird vom ITEA-Forschungsprojekt LOMS (Lo- cal Mobile Services [2]) vorgeschlagen. Das LOMS-Projekt hat zum Ziel, das Angebot innovativer mobiler Dienste dadurch zu fördern, indem die Entwicklung und Bereit- stellung von mobilen Diensten durch innovative Methoden und Werkzeuge so verein- facht wird, dass insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen der Einstieg zur Bereitstellung solcher Dienste erleichtert wird.
Neben den Integrationsaufgaben entsteht bei der Gebührenberechnung und -abrech- nung von mobilen Diensten das Problem, dass die vorhandenen standardisierten Schnittstellen nicht für die nächste Generation von kontextabhängigen mobilen Diens- ten ausreichen; die Gebührenberechnung wird bei zukünftigen Diensten nicht mehr nur wie zur Zeit vorwiegend von Uhrzeit, Verbindungsdauer oder übertragenem Da- tenvolumen abhängen. So gibt es zum Beispiel schon seit mehreren Jahren Zonenkon- zepte bei MNOs, die im Wesentlichen zwischen einer Heimatzone und weiteren in- und ausländischen Zonen unterscheiden und hierfür verschiedene Tarife bei Mobil- funkgesprächen ansetzen. Der aktuelle Aufenthaltsort ist aber nur als ein Beispiel für eine ganze Reihe von weiteren möglichen Parametern anzusehen, die unter dem Be- griff Kontext für die Gebührenberechnung zusätzlich herangezogen werden können.
Wenn Drittanbieter also demnächst kontextabhängige mobile Dienste über eine ent- sprechende Infrastruktur anbieten wollen und diese Dienste entsprechend kontextab- hängig abgerechnet werden sollen, muss es ein gemeinsames Verständnis bei Drittan- bietern und Betreibern von Abrechnungssystemen über die zu berücksichtigenden Kontextinformationen geben.
1.2 Laufendes Beispiel
Ein kontextabhängiger mobiler Dienst mit der Bezeichnung Local News Service, der in ähnlicher Form auch im LOMS-Projekt betrachtet wird, soll als laufendes Beispiel für diese Diplomarbeit dienen. Die Idee dieses Dienstes ist, dass Kunden, die ein Ver- tragsverhältnis mit einem lokalen Zeitungsverlag eingegangen sind, als mobile Anwen- der mit ausgewählten aktuellen Nachrichten versorgt werden, die von Kontextinforma- tionen wie dem aktuellen Aufenthaltsort oder einem zuvor angelegten Kundenprofil abhängig sind. Die Kosten für den Abruf einzelner Nachrichten sollen ebenfalls von Kontextinformationen abhängen.
Die Nachrichten werden z.B. per SMS oder MMS an das Mobilfunkgerät des Kunden versendet oder sind über einen Browser auf dem Gerät abrufbar. Die Zeitungsverlage müssen zur Bereitstellung dieses Dienstes aber nicht direkt an der Infrastruktur eines MNOs ansetzen, sondern verwenden eine spezielle Diensteplattform, die eine Vermitt- leraufgabe zwischen MNOs und Dienste-Drittanbietern übernimmt. Die Abbildung 1 zeigt, welche Aufgaben auf der Diensteplattform und der Infrastruktur der MNOs bei der Dienstnutzung anfallen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein Zeitungsverlag benötigt für die Entwicklung des Local News Service keine IT-Spe- zialisten, sondern konfiguriert lediglich eine von einem Dienstbetreiber bereitgestell- te Vorlage durch Beantwortung eines Fragenkatalogs mit einem hierzu zur Verfügung gestellten Werkzeug. In Bezug auf die Spezifikation von anfallenden Gebühren ist es Dienstanbietern (hier: Zeitungsverlagen) möglich, bei der Dienstkonfiguration zu- sätzlich eine entsprechende kontextabhängige Gebührenstruktur zu spezifizieren.
Kunden können über ein Web-basierte Oberfläche ihre Profildaten wie zum Beispiel ihre Interessen eingeben, sodass die vom Dienst gelieferten Nachrichten ihren persön- lichen Wünschen entsprechend angepasst werden. Der Kunde kann beispielsweise be- vorzugte Themengebiete wählen oder zusätzliche Audio- oder Videoinhalte an- oder abbestellen. Die mit den Optionen verbundenen Kosten werden dabei stets angezeigt. Die Abrechnung der Dienstnutzung erfolgt über den MNO des Kunden. Es besteht au- ßerdem die Möglichkeit, die aktuellen Umsatzdaten über ein Web-basierte Oberfläche zu verfolgen.
Der dargestellte Dienst ist ein Beispiel dafür, wie mobile Dienste in Zukunft von Drit- tanbietern bereitgestellt und vermarktet werden können. Die eine Innovation besteht dabei darin, dass es eine generische Diensteplattform gibt, auf der mobile Dienste an- hand von Vorlagen von unterschiedlichen Dienstbetreibern bereitgestellt und über MNOs abgerechnet werden können. Die Idee erscheint deshalb sinnvoll, weil durch die Wiederverwendung von Vorlagen und durch eine gemeinsame Plattform Aufwände für die ansonsten mehrfach benötigte Dienstentwicklung und -bereitstellung gespart wer- den können. Die zweite Innovation ist, dass die Gebühren für die Dienstnutzung kon- textabhängig anhand zusätzlicher, durch die einzelnen Dienste jeweils festgelegter Parameter berechnet werden können. Diese Parameter können z.B. den aktuellen Auf- enthaltsort des mobilen Dienstnutzers, die Art des benutzten Gerätes, das Format des angefragten Inhalts, die Menge der abgefragten Daten, aber auch völlig neue Parame- ter wie besondere Attribute eines Nutzerprofils oder die Wetterlage betreffen.
Der Local News Service wird in dieser Arbeit beispielhaft verwendet, um aufzuzeigen, wie die Nutzung von mobilen Diensten, die über eine generische Diensteplattform zur Verfügung gestellt werden, kontextabhängig, d.h. unter Berücksichtigung weiterer zur Berechnung der Gebühren relevanter Parameter, abgerechnet werden kann. Es wird unter anderem aufgezeigt, dass die Verwendung verschiedener Endnutzergeräte (zum Einen ein PC, zum Anderen ein Smartphone/PDA) zur Ansicht derselben lokalen Nachrichten unterschiedliche Gebühren für die Dienstnutzung nach sich ziehen kön- nen. So könnte zum Beispiel ein günstigerer Tarif für eine bestimmte Art von Geräten angeboten werden, um deren Verwendung zu fördern.
1.3 Ziele der Arbeit
Die Ziele der Arbeit orientieren sich an den Anforderungen an eine zukünftige Mobil- funk-Infrastruktur, die vom 3GPP1 definiert wurden (siehe Abbildung 2). Koutsopoulou hat die Anforderungen zusammengefasst und dazu eine konkrete Architektur vorge- schlagen [Kou04].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Anforderungen des 3GPP an eine zukünftige Mobilfunk-Infrastruktur
Das 3GPP berücksichtigt die Wünsche verschiedener Akteure: mobile Anwender, MNOs und Drittanbieter (Service Providers). Deshalb ist zu erwarten, dass sich die Ak- teure auch auf Schnittstellen einigen werden, die die Anforderungen des 3GPP berück- sichtigen.
- Die mobilen Anwender wünschen sich laut 3GPP, dass die Abrechnung aller mobilen Dienste in einer gemeinsamen Rechnung zusammengefasst wird und bei einer einzelnen Stelle zu bezahlen ist. Der Abrechnungsprozess soll dabei gut nachvollziehbar sein und dem mobilen Nutzer sollen die zugrunde liegen- den Preise so angegeben werden, dass er sich der entstehenden Kosten bei der Nutzung unterschiedlicher Dienste stets bewusst ist.
In die Studie „Der Markt für mobile Inhalte“ der LogicaCMG wurde festgestellt, dass 45% der weltweit befragten Mobilfunkkunden in Zukunft einfachere Be- zahlmöglichkeiten erwarten [3].
- Die MNOs sollen mehrschichtige Architekturen zur Abrechnung anbieten, so- dass mobile Nutzer wählen können, von welchen Drittanbietern sie Dienste nutzen möchten ohne dadurch mehrere Rechnungen zu bekommen. Die Bezah- lung soll wie am Mobilfunkmarkt üblich nach dem Prepaid- oder Postpaid-Kon- zept unterstützt werden (vgl. Abschnitt 2.1).
- Die Drittanbieter fordern eine hohe Flexibilität bei der Preisgestaltung für ihre Dienste. Dabei soll die Infrastruktur sicherstellen, dass die Einnahmen automa- tisch gemäß den Verträgen auf die unterschiedlichen Akteure verteilt werden.
Im oben beschriebenen Local News Service (vgl. Abschnitt 1.2) werden die hier ge- nannten dienstspezifischen Anforderungen bereits berücksichtigt. Darüber hinaus die- nen die genannten Innovationen „generische Diensteplattform“ und „kontextabhängi- ge Abrechnung“ der Erfüllung von 3GPP-Anforderungen (vgl. Abbildung 3):
- Die generische Diensteplattform zur Bereitstellung und Abrechnung von mobi- len Diensten deckt sich mit der Forderung der MNOs nach einer mehrschichti- gen Abrechnungsarchitektur.
- Die kontextabhängige Abrechnung ist eine Ausprägung für eine dynamische Preisge- staltung, die von den Drittanbietern angestrebt wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Lösung für die kontextabhängige Abrechnung auf ei- ner generischen Diensteplattform zu liefern. Dabei sollen folgende Fragen geklärt wer- den:
1. Welche Schnittstellen zur Abrechnung werden in einer generischen Infra- struktur für innovative mobile Dienste benötigt? Welche Aufgaben sind den Akteuren zuzuordnen, damit Drittanbieter ihre Dienste über die Abrechnungs- systeme der Mobilfunkgesellschaften bezahlen lassen können?
2. An welchen Stellen treten in der Infrastruktur für die Abrechnung relevante Kontextinformationen auf? Wie können diese Kontextinformationen model- liert und bei der Abrechnung berücksichtigt werden?
Eine Randbedingung deser Arbeit ist, dass als generische Infrastruktur die Dienste- plattform aus dem ITEA-Projekt LOMS betrachtet werden soll. Die LOMS-Plattform ist eine Maßnahme gegen derzeitige Hürden bei der Verbreitung von mobilen Diens- ten; das Angebot innovativer mobiler Dienste soll dadurch gefördert werden, dass der damit verbundene technische und wirtschaftliche Aufwand für die Drittanbieter redu- ziert wird.
Die LOMS-Plattform erleichtert im aktuellen Stand den Drittanbietern bereits das Konfigurieren und Bereitstellen mobiler Dienste, jedoch ist die genaue Abrechnungs- weise zwischen den Beteiligten, d.h. den mobilen Anwendern, den Dienstbetreibern, dem Plattformbetreiber und den MNOs, noch weitgehend ungeklärt (Stichwort: Reve- nue Sharing). Die Plattform sieht bisher nur Standardschnittstellen zur Abrechnung vor. Deshalb sollen die Rollen und Komponenten der LOMS-Plattform identifiziert werden, die bei der Bestimmung und Übermittlung der Abrechnungssummen invol- viert sind, und entsprechend benötigte Schnittstellen beschrieben werden.
Für die kontextabhängige Abrechnung ist zunächst anhand einer Analyse existierender mobiler Dienste festzustellen, welcher Art Kontextinformationen sein können, für die es sinnvoll erscheint, sie bei der Abrechnung innovativer mobiler Dienste zu berück- sichtigen. Dann muss geklärt werden, welche Komponenten welche Kontextinforma- tionen speichern, verarbeiten oder anderen Komponenten übermitteln sollen. Für die maschinelle Handhabung von Kontextinformationen soll ein geeignetes Vokabular in Form einer Kontextontologie identifiziert werden, anhand derer dann Abrechnungsre- geln spezifiziert werden können.
Im praktischen Teil der Diplomarbeit soll eine Plattformkomponente realisiert werden, mit der zusätzliche Kontextinformationen, die der zuvor identifizierten Kontextontolo- gie für mobile Dienste entsprechen, zur Abrechnung mit einbezogen werden können. Weiterhin soll anhand eines Beispiels aufgezeigt werden, wie im Falle einer Erweite- rung der Kontextontologie das betrachtete System rekonfiguriert werden muss. Auf diese Weise soll die Erweiterbarkeit des kontextabhängigen Abrechnungskonzepts auf Machbarkeit evaluiert werden.
1.4 Eingrenzung des Themas
1.4.1 B2C und B2B
Wenn für die mobilen Dienste die Endkunden als Kriterium herangezogen werden, können die Dienste in zwei Gruppen eingeteilt werden: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Im einführenden Beispiel (Abschnitt 1.2) liegt ein B2C Geschäftsmodell vor, denn der Dienst kann potentiell von jeder Privatperson verwen- det werden. B2B-Dienste werden dagegen von Firmen bzw. ihren Mitarbeitern verwen- det, um die innerbetrieblichen Arbeitsabläufe zu verbessern.
Was die Beschaffenheit und die Vergebührung der Dienste betrifft, besteht zwischen den beiden Geschäftsmodellen der Unterschied, dass für B2C-Dienste in der Regel we- niger Annahmen getroffen werden können als für B2B-Dienste. Beispielsweise können bei innerbetrieblichen Anwendungen im Gegensatz zu B2C-Anwendungen der Schu- lungsstand oder die Endgeräte der Benutzer bekannt sein. In Bezug auf die Abrech- nung gibt es den Unterschied, dass bei B2B die anfallenden Gebühren typischerweise vom Unternehmen getragen werden und die Abrechnung eher pauschal als individuell und insbesondere kontextabhängig erfolgt.
Die Unterschiede der Geschäftsmodelle machen deutlich, dass für verschiedene Inte- grationsschwerpunkte unterschiedliche Plattformen und Abrechnungsmechanismen sinnvoll sein können. In dieser Arbeit soll vorrangig die Abrechnung von B2C-Diensten betrachtet werden und im Ausblick die Übertragbarkeit auf B2B-Dienste erörtert wer- den.
1.4.2 Informationsdienste und technische Dienste
Man kann zwischen zwei Arten von Mobilfunkdiensten unterscheiden. Zum einen gibt es Dienste technischer Art, die dem Kunden zum Beispiel ermöglichen R-Gespräche2 zu führen, Faxe zu versenden oder SMS-Nachrichten per Email weiterzuleiten. Infor- mationsdienste dagegen verwenden die gegebene technische Infrastruktur und liefern dem Anwender Informationen, die aus unterschiedlichen Quellen ggf. kontextabhän- gig zusammengestellt werden.
Gegenstand dieser Arbeit sind Informationsdienste. Die Technologien, die bei der Nut- zung der Informationsdienste eingesetzt werden, sind zwar für die Abrechnung rele- vant, jedoch besteht die Innovation bei der kontextabhängigen Abrechnung darin, dass weitere Informationen über die Gegebenheiten bei der Nutzung eines mobilen Diens- tes sich auf die Abrechnung auswirken. Deshalb liegen Informationsdienste auch im Fokus dieser Arbeit.
Eine weitere Einschränkung in diesem Zusammenhang ist, dass nur vom MNO ausge- hende Dienste betrachtet werden sollen. Theoretisch besteht für die mobilen Anwen- der die Möglichkeit, über einen Rückkanal den MNOs Nachrichten zukommen zu las- sen, beispielsweise um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Diese Nachrichten könn- ten auch kontextabhängig abgerechnet werden, aber sollen hier nicht betrachtet wer- den.
1.4.3 Zweck der Kontextinformationen
Bei mobilen Diensten können Kontextinformationen nicht nur für die Abrechnung sinnvoll sein. Auch zuvor bei der Auswahl und Zusammenstellung der Dienste können Kontextinformationen – z.B. aus Nutzerprofilen berücksichtigt werden. Dabei kann es sich unter Umständen um dieselben Daten handeln, wie bei der Abrechnung. Aller- dings sollen in dieser Arbeit nur Kontextinformationen für die Abrechnung berück- sichtigt werden, jedoch mit gewährleisteter Erweiterung zur Nutzung der Kontextin- formationen für die Zusammenstellung der Dienste.
1.5 Vorgehensweise
Die Behandlung des Themas dieser Arbeit erfolgt in drei Schritten: Analyse, Konzept und praktische Umsetzung (siehe Abbildung 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Kapitelübersicht und -abhängigkeiten
(grün: Plattform-bezogene Unterkapitel; rot: Kontext-bezogene Unterkapitel)
Bei der Analyse wird zunächst eine Übersicht über den gegenwärtigen Abrechnungs- prozess für mobile Dienste bei Mobilfunknetzbetreibern gegeben (Kapitel 2).
Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass innovative mobile Dienste von Drittanbietern in Zukunft verstärkt über MNO-übergreifende Plattformen angeboten werden. Eine prototypische Implementierung einer solchen Plattform liefert das LOMS-Projekt. Kapitel 3 gibt daher einen Überblick über dieses Projekt im Hinblick auf das spezielle LOMS-Rollenmodell (Abschnitt 3.1) und die Systemarchitektur (Ab- schnitt 3.2). Darauf aufbauend folgt in Abschnitt 3.3 eine Diskussion über die Ansatz- punkte für die kontextabhängige Abrechnung mobiler Dienste auf der LOMS-Platt- form.
In Abschnitt 4.1 werden Begriffe um das Thema „Kontext“ für diese Arbeit definiert, um dann in Abschnitt 4.2 für innovative mobile Dienste, die aktuell auf dem Markt im Ge- spräch sind, bereits gebräuchliche Kontextinformationen zu identifizieren. Anhand der identifizierten Kontextinformationen folgt eine Untersuchung verschiedener Ansätze zur Modellierung und Verarbeitung von Kontextinformationen in Abschnitt 4.3. Diese Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Ontologien einen semantisch fundierten, dabei jedoch auch flexiblen und leicht erweiterbaren Ansatz zur Definition und Verar- beitung von Kontextinformationen bieten (Abschnitt 4.4). Im Rahmen dieser Diplom- arbeit wird dementsprechend eine initiale Basis-Ontologie definiert.
Die Beschreibung des Konzepts für die kontextabhängige Abrechnung mobiler Dienste erstreckt sich über die Kapitel 5, 6 und 7. In Kapitel 5 werden zunächst die Anforderun- gen an die zu erstellende, auf LOMS aufbauende, Dienste- und Abrechnungs-Infra- struktur identifiziert. Die Anforderungen leiten sich aus den in Kapitel 3 identifizierten Ansatzpunkten für die kontextabhängige Abrechnung auf der LOMS-Plattform und dem in Kapitel 4 gewählten Modellierungsansatz einer Referenzontologie für Kontext- informationen ab.
In Kapitel 6 wird das eigentliche Systemkonzept vorgestellt, das die in Kapitel 5 aufge- stellten Anforderungen erfüllt. Zunächst werden die einzelnen, sich aus den Anforde- rungen ergebenden Aufgaben im Rahmen der kontextabhängigen Abrechnung mobiler Dienste beschrieben und den entsprechenden Akteuren zugeordnet (Abschnitt 6.1). Dann wird in Abschnitt 6.2 ein Überblick über die entsprechenden zu erweiternden und neuen Schnittstellen zwischen den Systemkomponenten gegeben, bevor die Schnittstellen in Abschnitt 6.3 im Detail beschrieben werden.
Für die kontextabhängige Abrechnung liefert Kapitel 7 eine Lösung für die Struktur der Kontextdaten und die Verarbeitungsweise von Abrechnungsregeln.
Im letzten Schritt folgt eine Beschreibung, wie die Konzepte in einem konkreten Ab- rechnungssystem umgesetzt wurden (Abschnitt 8). Es wird die Auswahl konkreter Ar- chitekturkomponenten erläutert (Abschnitte 8.1 und 8.2), die neuen grafischen Ober- flächen werden aufgestellt (Abschnitt 8.3) und schließlich folgt eine Evaluation der Lö- sung (Abschnitt 8.4) anhand des laufenden Beispiels.
In Kapitel 9 wird schließlich zusammengefasst, welche Ziele erreicht wurden und für welche Bereiche noch Diskussionsbedarf besteht.
2 Grundlagen zur Abrechnung im Mobilfunk
Dieses Kapitel vermittelt ein Grundverständnis über mobile Dienste und deren derzeit übliche Abrechnung. Zunächst wird die Bedeutung von Fachbegriffen in diesem The- mengebiet definiert. Anschließend werden in einigen Szenarien die Verantwortlichkei- ten bei der Abrechnung von mobilen Diensten erläutert.
2.1 Begriffsdefinitionen
Um ein eindeutiges Verständnis über die verwendete Terminologie festzulegen, wer- den an dieser Stelle einige Fachbegriffe definiert.
Mobilfunkgesellschaft
Eine Mobilfunkgesellschaft (MNO - Mobile Network Operator) ist ein Unternehmen, das Mobilfunkdienste für Privat- und Geschäftskunden anbietet.
Zu diesem Zweck beantragt oder erwirbt diese Telefongesellschaft bei staatlichen Stel- len eine Mobilfunk-Sendelizenz. Anschließend baut der Lizenznehmer eine Mobil- funk-Infrastruktur (heute in den allermeisten Fällen ein GSM-Netz oder ein UMTS- Netz) auf, die ein der Lizenz entsprechendes bestimmtes geographisches Gebiet ab- deckt. Die zur Verfügung gestellten Dienste werden entweder mit einer Prepaid-Karte oder mittels einer monatlichen Rechnung, die meistens auch eine Grundgebühr bein- haltet, abgerechnet. Manche Mobilfunkgesellschaften haben sich als MVNO (Mobile Virtual Network Operator) auf den Wiederverkauf von Mobilfunk-Diensten speziali- siert [4].
Basisdienste und Mehrwertdienste
In der Telekommunikation gibt es zwei Bedeutungen für Basisdienste:
1. Eine einfache Übermittlungserlaubnis über einen Kommunikationskanal, der im Hinblick auf die Interaktion mit Kunden-unterstützenden Informationen virtu- ell transparent ist.
2. Das Angebot einer Übermittlungserlaubnis zwischen zwei oder mehr Punkten entsprechend den Übermittlungsanforderungen der Anwender und nur gemes- sen an technischen Parametern wie Genauigkeit oder Verzerrung der Signale.
Als Mehrwertdienste werden spezielle Telekommunikationsdienste bezeichnet, deren Leistungen auf Basisdiensten beruhen [5]. Beispielsweise stellt der Telefondienst den Kommunikationspartnern nur eine Verbindung zur Verfügung, sodass in diesem Fall eindeutig von einem Basisdienst gesprochen werden kann. Werden jedoch die übertra- genen Informationen in irgendeiner Weise gespeichert oder weiterverarbeitet, erhält der Basisdienst eine Wertsteigerung, was sich im englischen Begriff „value added ser- vice“ (VAS) für Mehrwertdienst widerspiegelt.
Mehrwertdienste können im Sprachbereich und im Datenbereich angeboten werden. Aus technischer Sicht sind Mehrwert-Sprachdienste zum Beispiel die Computer-Tele- fonie-Integration3, das Least Cost Routing4 oder der Centrex-Dienst5. Im Datenbereich sind an Mehrwertdiensten zu nennen: Premium-SMS, Telefax oder E-Mail. Für beide Bereiche werden außerdem Informationsdienste als VAS angeboten, wie zum Beispiel die Telefonauskunft, Börsenkurse oder Flugpläne.
Mobile Dienste von Drittanbietern sind ebenfalls Mehrwertdienste, weil sie auf die Ba- sisdienste der MNOs aufsetzen und deren Wert steigern. Die MNOs ermöglichen durch ihre Basisdienste erst das Angebot der Mehrwertdienste. In der Praxis bieten die MNOs selber ihren Kunden schon vielfach Mehrwertdienste an, wie etwa die Mailbox- funktion oder Multimedia- und Community-Dienste, wie sie beispielsweise vom Voda- fone live! Portal angeboten werden [6].
Mehrwertdienste, die die MNOs anbieten werden in dieser Arbeit jedoch nicht behan- delt, weil die MNOs sich in diesem Fall auch bereits selbst um die Abrechnung küm- mern. Wegen der Begrenzung auf B2C-Informationsdienste im Rahmen dieser Arbeit (vgl. Abschnitt 1.4.1) sind mit Mehrwertdiensten im Folgenden Informationsdienste von Drittanbietern gemeint.
Abrechnungsbegriffe im Mobilfunk
Bei Abrechnungssystemen auf dem Mobilfunkmarkt gibt es zwar ebenso wie bei ande- ren Abrechnungssystemen auch Produkte und Tarife, die der Abrechnung zugrunde liegen, doch haben diese eine eigene Ausprägung, die hier näher beschrieben wird.
Ein Mobilfunk- Produkt bestimmt, welche Basis- und/oder Mehrwertdienste zur Ver- fügung gestellt werden sollen. Zum Beispiel ermöglicht ein typisches Mobilfunk-Pro- dukt die übliche Sprachtelefonie inklusive Mehrwertdiensten wie Konferenzschaltung, Mailbox oder automatischer Rückruf sowie Datendienste wie SMS, MMS und GPRS.
Tarife werden an Produkte gebunden und bestimmen, welche Dienste auf welche Weise zu welchen Konditionen bezahlt werden müssen. So kann ein Produkt z.B. mit einer monatlichen Grundgebühr behaftet sein, wobei bei der Verwendung einiger Dienste abhängig von der Verwendungszeit oder dem übertragenen Datenvolumen zu- sätzliche Gebühren anfallen können. Die Gebührenbestimmung ist also Bestandteil ei- nes Tarifs und kann aus komplexen Abhängigkeiten und mathematischen Regeln be- stehen.
Zwischen den Tarifen ist insbesondere in Bezug auf den Zahlungszeitpunkt zu unter- scheiden. Zum einen gibt es Laufzeitverträge, auch Postpaid -Verträge genannt, die meistens über zwei Jahre abgeschlossen werden und den Kunden in der Regel ver- pflichten, monatlich zumindest eine Grundgebühr zu bezahlen.
Bei Prepaid -Verträgen hingegen wird dem Kunden direkt bei einer gebührenpflichti- gen Dienstnutzung das entsprechende Entgelt von einem zuvor eingezahlten Gutha- ben abgezogen.
Konvergente Verträge stellen eine Kombination aus einem Prepaid- und einem Post- paid-Vertrag dar. So ist beispielsweise ein Vertrag für Mitarbeiter einer Firma denkbar, bei dem die Firma monatlich 30 Euro für Prepaid-Guthaben bezahlt und die Mitarbei- ter nach Verbrauch des Guthabens weitere anfallende Gebühren nach dem Post- paid-Konzept selber bezahlt.
2.2 Abrechnungsprozess im Mobilfunk
Die folgende allgemeine Beschreibung des Abrechnungsprozesses für die Dienstnut- zung im Mobilfunk orientiert sich an einer Ausarbeitung der Orga Systems GmbH, ei- nem Hersteller moderner Echtzeit-Abrechnungssysteme [MKK07].
Jedes Abrechnungssystem durchläuft bis zur tatsächlichen Belastung des Nutzerkontos einen mehrstufigen Prozess, in dem Informationen, die der Abrechnung zugrunde lie- gen, verarbeitet werden. Abbildung 5 zeigt eine Übersicht der Schlüsselfunktionalitä- ten, die ein Abrechnungssystem bereitstellt. Die einzelnen Schritte werden im Folgen- den näher erläutert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Schlüsselfunktionen eines Abrechnungssystems
Im ersten Schritt, der Vermittlung (Abbildung 6), sammelt das Abrechnungssystem zu- nächst Daten von Netzwerkelementen oder empfängt Informationen von anderen Ver- rechnungsstellen (collecting). Die gesammelten Daten werden anschließend zusam- mengeführt (aggregating) und Einträge, die nicht abrechenbar sind, werden ausgefil- tert. In einem Normalisierungsprozess werden noch fehlende Informationen berechnet und ergänzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Schritt 1 im Abrechnungsprozess: Mediation
Nachdem die Vermittlung der Nutzungsdaten abgeschlossen ist, beginnt die Gebüh- renberechnung durch die so genannte rating engine (Abbildung 7). Die Daten werden zunächst in ein gemeinsames, internes Format überführt und für die weitere Behand- lung klassifiziert (reformatting). Anschließend müssen die Daten einem existierenden Kunden-Tarifierungsplan zugeordnet werden (guiding), um die zutreffenden mathe- matische Regeln zu erhalten, nach denen der Preis für die Nutzung schließlich be- stimmt wird (rating).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Schritt 2 im Abrechnungsprozess: Rating
An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Gebührenberechnung, die in diesem Schritt erfolgt, bisher nur sehr begrenzt kontextabhängig ist, z.B. wird bereits jetzt die aktuelle Uhrzeit und die "Aufenthaltszone" des Anrufers und des Angerufenen berücksichtigt. In dieser Arbeit wird jedoch ein generischer Ansatz für die Berücksichtigung von Kon- textinformationen gesucht. Die Kontextinformationen müssen deshalb schon in den Daten, die in den früheren Schritten bearbeitet wurden, enthalten sein.
Bei der Abrechnung (billing, Abbildung 8) werden aus allen abrechnungsbezogenen Daten für die aktuelle Rechnung relevante Summen extrahiert. Neben den zuvor be- rechneten Gebühren (rated calls) sind vom Kunden getätigte Zahlungen, Produktdaten und kundenspezifische Daten zu berücksichtigen. Die ermittelten Summen werden dann einer weiteren Verrechnung mit Nachlässen und Steuern unterzogen (bill run), welche dann als Resultat für diesen Schritt als digitale Auflistung noch ohne Lay- out-Informationen für die endgültige Rechnung weitergegeben wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Schritt 3 im Abrechnungsprozess: Billing
Im letzten Schritt, der Rechnungslegung (invoicing, Abbildung 9), werden die Verrech- nungsdaten in eine druckbare Form überführt. Die einzelnen Posten werden dabei mit beschreibendem Text, Mengenangabe, Gebühr und Steueranteil aufgeführt und das Dokument wird um weitere Briefelemente ergänzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Schritt 4 im Abrechnungsprozess: Invoicing
Die oben aufgeführten Schritte stellen die Funktionsweise eines vollständigen Abrech- nungssystems in der Mobilfunkbranche dar. Jedoch verfügen nicht alle Abrechnungs- systeme über alle genannten Funktionalitäten. Abrechnungsprozesse können auch von einem Verbund verteilter Systemenkomponenten bewerkstelligt werden. Zum Beispiel können die Eingabedaten von einem prerating-System vorverarbeitet worden sein, wo- durch bereits ein Teil der Gebührenberechnung vollzogen wurde.
Wichtige Anforderungen an Abrechnungssyteme in Bezug auf die Leistungsfähigkeit sind Stabilität, Performanz und Skalierbarkeit. Millionen von Kunden, die Tausende von Aktionen pro Minute durchführen, generieren entsprechend viele Anfragen an das Abrechnungssystem, die für einen reibungslosen Ablauf – und insbesondere im Falle von Prepaid-Konten unter Echtzeitanforderungen – verarbeitet werden müssen.
2.3 Szenarien zur Abrechnung mobiler Dienste
Um einen grundlegenden Überblick über die Beteiligten an der Nutzung von Mehr- wertdiensten zu vermitteln, werden in diesem Abschnitt drei Szenarien vorgestellt. Auf einer hohen Abstraktionsstufe wird zunächst skizziert, wie MNOs ihre Basisdienste ab- rechnen. Dann folgt die Betrachtung von Drittanbietern, die die Gebühren für ihre
Mehrwertdienste beim Kunden selbst erheben. Das dritte Szenario zeigt schließlich auf, wie Drittanbieter ihre Umsätze dem MNO des Kunden vermitteln, der die Gebüh- renerhebung schließlich zentral vornimmt.
1. Die aktuellen Abrechnungssysteme sind dafür ausgelegt, Basisdienste zu verge- bühren, die der MNO über sein Mobilfunk-Netzwerk anbietet (siehe Abbil- dung 10). Als Basisdienst werden in diesem Zusammenhang Telefonie, SMS und alle Dienste verstanden, die direkt von den MNOs zur Verfügung gestellt wer- den.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Abrechnung ohne Drittanbieter
Um dem Abrechnungssystem mitzuteilen, wer in welchem Umfang einen be- stimmten Dienst genutzt hat, gibt es die Möglichkeit, auf Standardprotokolle und -schnittstellen wie zum Beispiel Diameter und Parlay X zurückzugreifen (vgl. Abschnitt 2.4). Die Erstellung von Abrechnungsregeln, die die Abrech- nungssummen bestimmen, ist jedoch Aufgabe von Experten für das jeweilige Abrechnungssystem.
2. Viele Drittanbieter rechnen ihre Mehrwertdienste aus wirtschaftlichen und or- ganisatorischen Gründen bisher selbst ab und fordern anfallende Gebühren zum Beispiel per Kreditkartenzahlung direkt vom Kunden ein (Abbildung 11). Dabei kann es zu Pauschalverträgen zwischen Drittanbieter und MNO oder auch zwischen Drittanbieter und Kunden kommen. Im letzteren Fall ist das Ab- rechnungssystem des MNO nicht involviert. Vom Kunden wird verlangt, den Drittanbietern Bankdaten zur Abrechnung zur Verfügung zu stellen oder per Vorkasse zu bezahlen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 11: Drittanbieter mit getrennter Abrechnung
3. Für mobile Dienste, die kontextabhängig abgerechnet werden sollen, besteht das Interesse, den Mobilfunkkunden für Basis- und Mehrwertdienste eine ge- meinsame Rechnung auszustellen, damit die Kunden nicht für jeden einzelnen Mehrwertdienst eine eigene Rechnung bekommen müssen. Die Bezahlung für die Mehrwertdienste sollte über den MNO sichergestellt werden, damit der Kunde die Basisdienste sowie die Mehrwertdienste von einer einzelnen Stelle zugestellt bekommt (vgl. Abbildung 12).
Die kontextabhängige Gebührenberechnung für die Mehrwertdienste erfordert ein weiteres Abrechnungssystem auf der Infrastruktur, die der Drittanbieter ver- wendet. Im Laufe der Arbeit wird noch gezeigt, dass die Alternativlösung, allein die Abrechnungssysteme der Mobilfunkbetreiber zu erweitern, nicht praktika- bel wäre.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 12: Drittanbieter mit integrierter Abrechnung
Die oben dargestellten Szenarien beziehen sich auf die aktuelle Handhabung von Ab- rechnungsaufgaben. Die integrierte Abrechnung im dritten Szenario (Abbildung 12) wird wegen des hohen Aufwandes zur Zeit aber nur sehr eingeschränkt durchgeführt. Die vorgestellte Architektur in dieser Arbeit soll den Aufwand reduzieren und Stan- dards für die Integration mobiler Dienste bezüglich der Vergebührung vorschlagen bzw. erweitern.
2.4 Standardschnittstelle zur Abrechnung mobiler Dienste
Es gibt im Mobilfunkmarkt bereits etablierte Standard-Protokolle zur Abrechnung mo- biler Dienste, wie z.B. RADIUS [7] und Diameter [8] und ihre Erweiterungen. Über- sichten hierzu finden sich u.a. in den Wikipedia-Artikeln [9] und [10].
Für eine generische Diensteplattform wie die LOMS-Plattform, die im nächsten Kapitel noch näher beschrieben wird, ist jedoch eine standardisierte, Technologie-unabhängi- ge Webservice-Schnittstelle für die Abrechnung mobiler Dienste geeigneter, da sich eine solche Schnittstelle – angeboten über einen dedizierten Charging Service – kon- zeptionell nahtlos in das Konzept einer serviceorientierten Architektur (SOA) inte- griert.
In Zusammenarbeit mit dem 3GPP wurde 2003 der Parlay X-Standard [11] entwickelt, der eine Reihe von Schnittstellen für Telefonnetze in Form von Webservice APIs mit Hilfe von XML spezifiziert [12]. Teil 6 des Standards (Parlay X 3 Payment API) befasst sich mit der Abrechnung von Telefongesprächen, Teil 7 mit der Kontenverwaltung (Parlay X 3 Account Management API). Über die durch die Parlay X Payment API ange- botenen Operationen kann man Geldbeträge oder Mengen von Einheiten auf beste- henden Konten abbuchen, reservieren oder zurückerstatten. Außerdem ermöglicht die Schnittstelle die Abfrage von zu erwartenden Kosten für die Nutzung eines Dienstes (sog. Advice of Charge).
Die Spezifikation der Parlay X APIs abstrahiert von konkret verwendeten Technologien und verfolgt dabei auch das Ziel, die Integration von IT-basierten Mehrwertdiensten in Telekommunikationsnetzwerken zu vereinfachen. Parlay X soll insbesondere Program- mierern aus der Softwareentwicklung ermöglichen, Anwendungen als Telekommuni- kationsdienste auch ohne spezielle Kenntnisse von Telefonie- und Telekommunikati- onstechniken zu erstellen.
Die Parlay X Payment API unterscheidet zwischen monetärer und volumenbasierter Abrechnung, d.h. zwischen „amount charging“ und „volume charging“. Es wird davon ausgegangen, dass Anfragen von bereits authentisierten und autorisierten Clients (Netzwerkelementen, Prozessen) gestellt werden. Diese Annahme kann getroffen wer- den, wenn die Schnittstelle als ein Webservice – im Folgenden Charging Service ge- nannt – in einer vertrauenswürdigen Umgebung realisiert ist und entsprechend ge- schützt ist.
2.4.1 Direkte Kontobelastungen und -gutschriften
Ein Client kann die Operation chargeAmount(endUserIdentifier, charge, referenceCode) aufrufen, um ein Konto – eindeutig zu bestimmen durch endUserIdentifier – direkt mit einem vorgegebenen Geldbetrag zu belasten. Der Parameter charge beinhaltet neben dem eigentlichen Betrag auch die Währungseinheit und einen beschreibenden Text für den Ausdruck der Rechnung, und der Parameter referenceCode wird als eindeutige Kennung für spätere Referenzzwecke (z.B. zur Klärung bei Beschwerden) übergeben und gespeichert. Analog kann mit der Operation refundAmount(endUserIdentifier, charge, referenceCode) einem Nutzerkonto eine Gutschrift gegeben werden.
Neu in der Version 3 der Parlay X Payment API ist die Operation chargeSplitAmount(splitInfo, charge, referenceCode) , mit der mehreren Konten anteilig ein gegebener Betrag direkt belastet werden kann. Diese Operation ist z.B. nützlich bei der Abrechnung von Konferenzschaltungen oder Multi-User-Anwendungen. Der Para- meter splitInfo enthält dazu eine Liste von Konten und prozentualem Anteil am Be- trag.
Auf ähnliche Weise können über die Operationen chargeVolume() und refundVolume() einem Nutzerkonto volumenbasierte Einheiten belastet bzw. gutge- schrieben werden sowie mit chargeSplitVolume() mehreren Konten gleichzeitig und prozentual anteilig volumenbasierte Einheiten belastet werden. Dies bedeutet, dass das
dem Charging Service zu Grunde liegende Abrechnungssystem den ausmachenden monetären Betrag basierend auf Abrechnungsregeln erst noch aus dem übermittelten Volumenwert berechnen muss. Die Festlegung der Volumeneinheit und der Abrech- nungsregeln ist wiederum nicht Bestandteil der Parlay X Spezifikation.
2.4.2 Advice of Charge
Mit der Operation getAmount(endUserIdentifier, volume, parameters) kann eine Anfra- ge über potentiell anfallende Kosten vor der eigentlichen Dienstnutzung erfolgen (sog. Advice of Charge). Das zurückgelieferte Ergebnis ist ein Betrag, der aus dem übermit- telten Volumen und den Abrechnungsregeln vom Abrechnungssystem errechnet wird. Tatsächlich abgerechnet wird jedoch nichts. Über den Parameter parameters können zur näheren Beschreibung optional eine Volumeneinheit (z.B. bytes), eine Vertrags- nummer, eine Kennung des betrachteten Dienstes (z.B. SendMessageService) und eine auszuführende Operation (z.B. sendMessage) angegeben werden. An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die Parlay X Spezifikation auf genau diese vier Elemente als mögliche Bestandteile des Parameters parameters festlegt.
2.4.3 Session-basierte Abrechnung
Die Parlay X Payment API bietet weitere Operationen an, mit denen sog. Charging Ses- sions durchgeführt werden können. Auch hier wird zwischen monetären und volumen- basierten Operationen unterschieden. Wichtig ist anzumerken, dass eine einzelne Charging Session auch nur als ein einzelner Posten auf der Kundenrechnung auftaucht.
Eine Charging Session wird durch einen Aufruf der Operation reserveAmount(endUser- Identifer, charge) bzw. reserveVolume(endUserIdentifier, volume, billingText, parame - ters) initiiert. Der Charging Service reserviert daraufhin den entsprechenden Betrag auf dem angegebenen Konto. Die leicht unterschiedlichen Parameterlisten für die beiden Sessionarten resultieren aus der unterschiedlichen Kapselung von einigen Informatio- nen in den Parametern charge und parameters (z.B. bzgl. der Währungseinheit und der Volumeneinheit). Der Parameter parameters ist wie oben bereits erwähnt auf optionale Angaben zu Volumeneinheit, Vertragsnummer, Dienstbezeichner und Operationsna- me beschränkt.
Jede Reservierung ist durch einen eindeutigen Bezeichner (Identifier, ID) gekennzeich- net, der bei dem initialen Aufruf festgelegt wird und bei einer erfolgreichen Reservie- rung als Ergebnis zurückgegeben wird, sodass in Folgeaufrufen der beteffenden Char- ging Session auf die korrekte Reservierung referenziert werden kann. Reservierungen bleiben nicht ewig gültig und verfallen nach einer gewissen Zeit. Die Parlay X Payment Spezifikation gibt jedoch nicht an, wie die Gültigkeitsdauer von Reservierungen zwi- schen Clients und Charging Service vereinbart wird. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer werden auf dem Konto reservierte, aber noch nicht als verbraucht gemeldete Beträge/Einheiten wieder freigegeben.
Im Folgenden wird der weitere Ablauf einer Charging Session am Beispiel von volu- menbasierten Sessions erläutert. Monetäre Charging Sessions laufen weitestgehend identisch ab, nur einige übergebene Parameter sind unterschiedlich.
Eine Charging Session kann durch Aufruf der Operation reserveAdditionalVolume(re- servationIdentifier, volume, billingText) beliebig oft ausgedehnt bzw. bei einem über- mittelten negativen Volumen verkleinert werden. Die Gültigkeitsdauer der Reservie- rung wird mit jedem neuen Aufruf entsprechend verlängert. Der optionale Rechnungs- text billingText wird an die bisher übermittelten Text angehängt.
Zusätzlich zur Reservierung von Einheiten in einer laufenden Charging Session kann durch Aufruf der Operation chargeReservation(reservationIdentifier, volume, billing- Text, referenceCode) eine Anzahl von Einheiten als verbraucht, d.h., als definitiv abzu- rechnen, übermittelt werden. Das Ergebnis dieses Aufrufs ist, dass das angegebene Vo- lumen unter Berücksichtigung der zuvor übermittelten optional gesetzten Parameter (Volumeneinheit, Vertragsnummer, Dienstbezeichner und Operationsname) vom Ab- rechnungssystem in einen monetären Wert umgerechnet und dem angegebenen Konto auf jeden Fall belastet wird.
Falls eine Charging Session aus irgendeinem Grund vorzeitig beendet werden muss, z.B. weil von Seiten des Clients eine fehlerhafte Dienstausführung bemerkt wird, kann die Operation releaseReservation(reservationIdentifier) aufgerufen werden, um die lau- fende Session zu beenden und das reservierte, noch nicht als verbraucht gemeldete Vo- lumen auf dem betreffenden Konto wieder freizugeben.
Weitere Informationen über die von Parlay X gemachten Annahmen, die genannten Operationen und Parameter, die Fehlerbehandlung, und die aktuellste Schnittstellenbeschreibung sind in [ETSI07] zu finden.
2.4.4 Beispiel einer Charging Session
Zum besseren Verständnis, wie eine Charging Session unter Parlay X ablaufen kann, wird in diesem Abschnitt ein (fiktiver) mobiler Multimediadienst beschrieben, der aus der Parlay X 3 Payment Spezifikation entnommen ist. In jenem Beispiel wird ein Multi- mediadienst von einem Dienstbetreiber über einen MNO angeboten.
Angenommen, ein mobiler Nutzer möchte sich ein Fußballspiel über diesen Multi- mediadienst auf seinem mobilen Gerät anschauen. Er loggt sich ein und fragt über eine entsprechende Funktion die anfallenden Kosten für das Betrachten des gesamten Fuß- ballspiels ab. Der Dienstbetreiber interagiert dazu mit dem MNO, um die entstehen- den Kosten über dessen Rating Engine berechnen zu lassen (getAmount).
[...]
1 Das 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ist eine weltweite Kooperation von Standardisierungsgremien für die Standardisierung im Mobilfunk; konkret für UMTS und GERAN (GSM).
2 R-Gespräch: Der Angerufene zahlt nach erfolgter Zustimmung die Kosten des Anrufs.
3 Computer-Telefonie-Integration (CTI): Verknüpfung von Telekommunikation mit elektronischer Datenverarbeitung, die Computerprogrammen die Handhabung von Telefongesprächen und anderen Telekommunikationsdiensten ermöglicht.
4 Least Cost Routing (LCR): Eine Vorrichtung, die mittels Call-by-Call die automatische Verwendung des preiswertesten Telefonanbieters festlegt.
5 Centrex (Central Office Exchange) stellt die Funktionen einer Telefonanlage für Privatpersonen oder Firmen mit Hilfe von Elementen eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes (zum Beispiel ISDN) bereit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter kontextabhängiger Abrechnung bei mobilen Diensten?
Dabei hängen die Kosten eines Dienstes nicht nur von Dauer oder Datenvolumen ab, sondern von Kontextfaktoren wie dem Aufenthaltsort, dem Nutzerprofil oder der aktuellen Situation.
Was ist das Ziel des LOMS-Projekts?
LOMS (Local Mobile Services) zielt darauf ab, die Entwicklung und Bereitstellung innovativer lokaler mobiler Dienste für kleine und mittelständische Unternehmen zu vereinfachen.
Wie werden Kontextinformationen technisch dargestellt?
In der Arbeit werden verschiedene Modelle wie Key-Value-Paare, Markup-Schemata und insbesondere ontologiebasierte Modelle (Kontextontologien) untersucht.
Welche Rolle spielt die Ontologie bei der Abrechnung?
Die Ontologie liefert ein gemeinsames Vokabular für Kontextdaten, anhand dessen flexible Abrechnungsregeln (z.B. Rabatte bei bestimmten Standorten) spezifiziert werden können.
Was ist der "Local News Service" in dieser Studie?
Dies ist ein beispielhafter Dienst, der Nachrichten basierend auf dem Standort und den Interessen des Nutzers liefert und diese kontextabhängig abrechnet.
Welche Frameworks wurden für den Prototyp verwendet?
Für die Implementierung des Abrechnungskonzepts wurden die Ontologie-Frameworks Jena und Protégé eingesetzt.
- Quote paper
- Waldemar Janzen (Author), 2008, Kontextabhängige Abrechnung von mobilen Diensten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212931