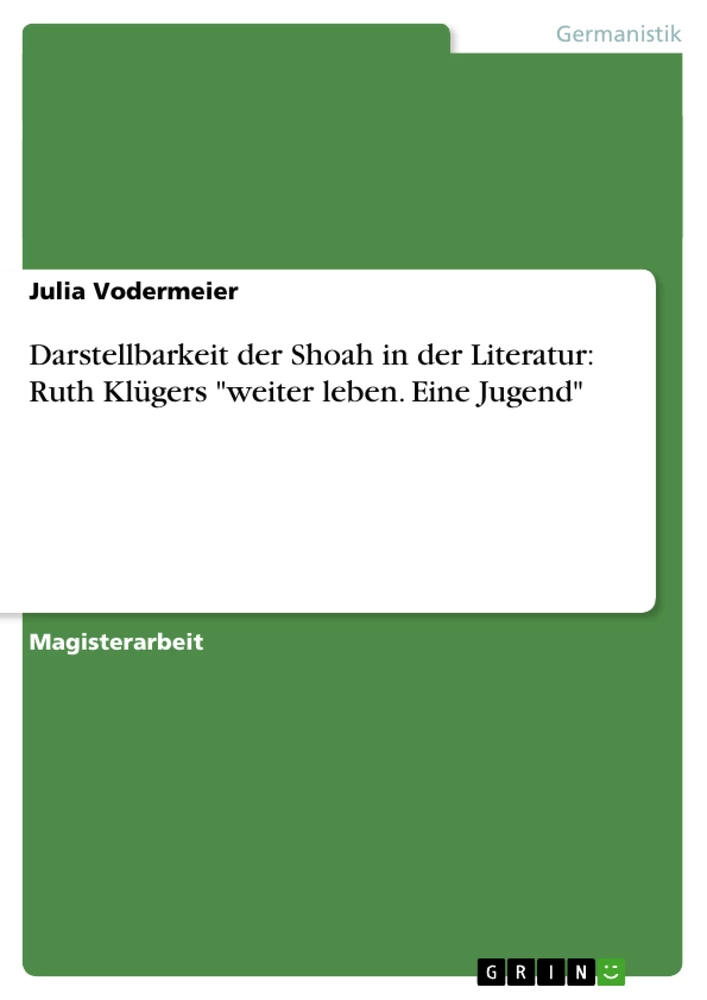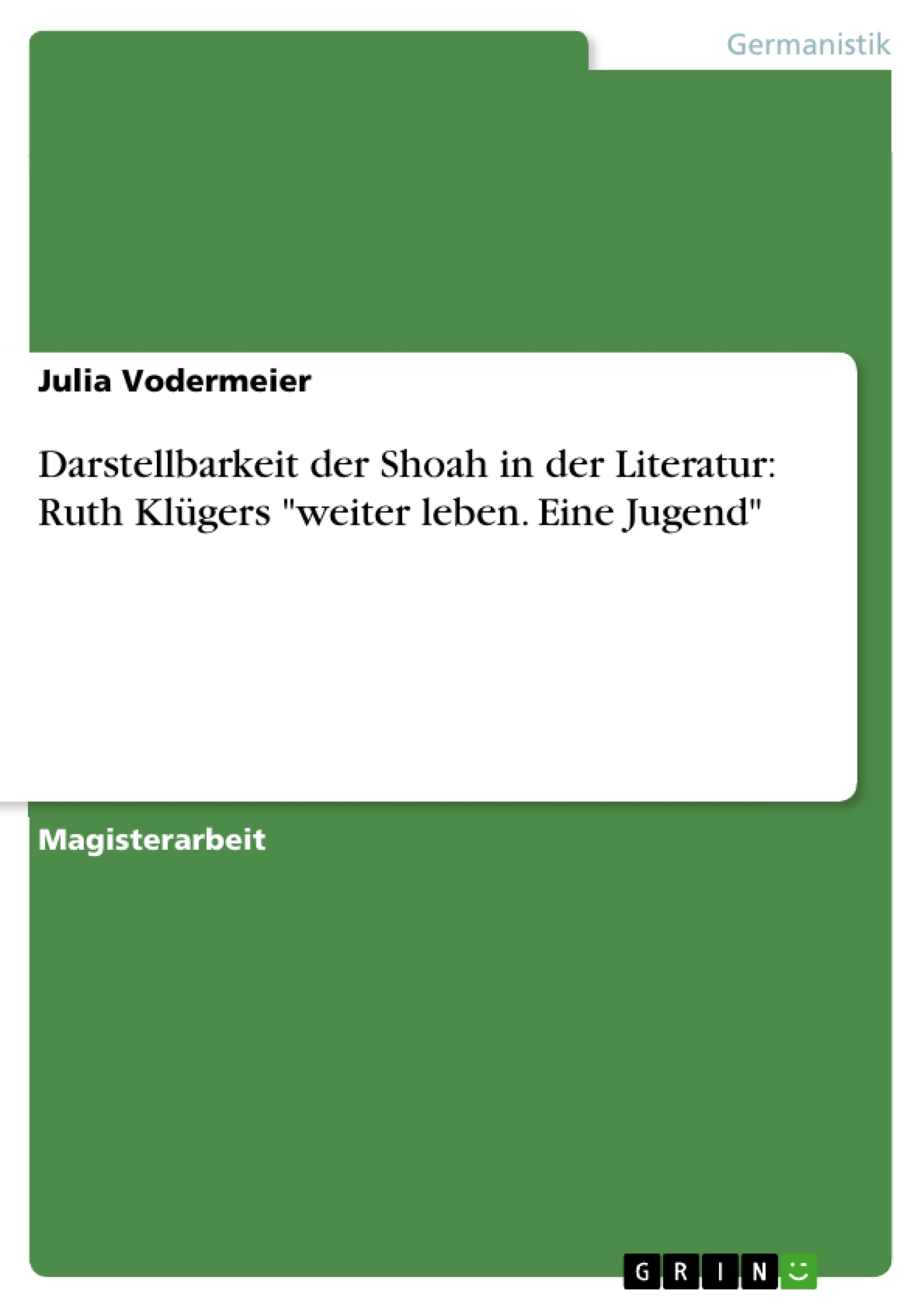Die Magisterarbeit beschäftigt sich mit der Darstellbarkeit der Shoah in der Literatur der Überlebenden und in diesem Rahmen mit Ruth Klügers Autobiographie "weiter leben. Eine Jugend".
Die Vorgehensweise und der Aufbau der Arbeit sind maßgeblich von James E. Youngs Beobachtung bestimmt, dass das Wissen der Nachgeborenen über die Shoah immer ein medial vermitteltes und bereits interpretiertes Wissen ist. Aus diesem Grund leite ich aus der Frage Ruth Klügers "Wie legt man Zeugnis ab, befangen in den Ketten des eigenen Körpers, des eigenen Wahrnehmungsvermögens? In meinem Fall Zeugnis einer großen Mordaktion?" - diese Frage ist zentral für ihr autobiographisches Schreiben - eine Frage an mich als Rezipientin ab: Wie gehe ich, deren Wahrnehmungsvermögen ebenfalls durch die eigene Subjektivität beschränkt ist, mit den Zeugnissen der Überlebenden und darüber hinaus mit der Shoah um?
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: Nach einem kurzen Überblick über den Forschungsstand zu Klügers Autobiographie stelle ich die Namen in den Mittelpunkt, mit denen die Nachwelt den Massenmord der Nationalsozialisten an der jüdischen Bevölkerung Europas während des Zweiten Weltkriegs bezeichnet und begreift. Da die Benennung des Ereignisses immer schon Teil eines Interpretationsvorgangs ist, betrachte ich die Begriffe "Holocaust", "Shoah" und "Churban" begriffsgeschichtlich und problematisiere sie hinsichtlich ihrer inhärenten, teilweise verdeckten Bedeutungen und Deutungen des Geschehens.
Im zweiten Teil frage ich nach den Ursachen, die die Darstellung der Shoah für die Überlebenden prekär werden lassen. Ich zeige den Zusammenhang auf, der zwischen dem Kern des historischen Ereignisses, der Intention, dieses zu bezeugen und dem Dilemma besteht, die Ereignisse sprachlich zu erfassen und zu vermitteln. Ich vertrete die These, dass das Schreiben der Überlebenden nicht einseitig als problematisches Darstellen eines schwer zu erfassenden Ereignisses verstanden werden kann, sondern mit Blick auf die Verankerung der Texte als Zeugnisse in einer Rezeptionsdimension immer auch als Mitteilungsproblem betrachtet werden muss.
Im dritten Teil zeige ich anhand von Klügers Autobiographie, wie die Autorin durch ihre Sprache und ihre Erzählstrategien die Rezipienten in ihr autobiographisches Schreiben über die Shoah einbindet und wie ihr konfrontativer Blick in der Sprache auf Involvierung des Lesers in das Erzählgeschehen und darüber hinaus auch in die Nachgeschichte des Holocaust zielt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzer Überblick über den Forschungsstand
- Problematisierung der Begriffe
- Aktualität der Thematik
- Charakteristika des Benennungsprozesses
- Der Holocaust-Begriff
- Die ursprüngliche Bedeutung
- „Holocaust" im Prozess der Vergangenheitsbewältigung
- Erstarrung des Begriffes zum politischen Schlagwort und zur leeren Worthülse?
- Die Begriffe „Shoah" und „Churban"
- Terminologie der Arbeit
- Das Problem der Repräsentation
- Germanistik und Shoah
- Grenze der Verstehbarkeit
- Die Zeugnisintention
- Die Shoah als Darstellungsproblem
- Das Problem der Repräsentation als Problem der Rezeption
- Ruth Klügers Autobiographie „weiter leben. Eine Jugend". Involvierung des Lesers in das Dilemma des autobiographischen Schreibens über die Shoah
- Der konfrontative Blick Klügers
- Die kommunikative Grundsituation zwischen Autorin und Leser
- Erzählerische Konstruktion
- „Zwei unvereinbare Landschaften": Die Kontinuität des Bruches
- Der geteilte Blick Klügers
- Schluss
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit der Darstellbarkeit der Shoah in der Literatur der Überlebenden und analysiert in diesem Rahmen Ruth Klügers Autobiographie „weiter leben. Eine Jugend". Die Arbeit basiert auf der Beobachtung, dass das Wissen der Nachgeborenen über die Shoah immer ein medial vermitteltes und bereits interpretiertes ist.
- Die Arbeit untersucht die Schwierigkeiten, die für Überlebende beim Schreiben über die Shoah bestehen.
- Sie analysiert, wie Ruth Klüger in „weiter leben" mit diesen Schwierigkeiten umgeht.
- Die Arbeit widmet sich der Problematik der Benennung und Interpretation des Holocaust.
- Sie untersucht, wie die Shoah in der Literatur der Überlebenden dargestellt wird und welche Auswirkungen diese Darstellungen auf die Rezeption haben.
- Die Arbeit analysiert, wie Ruth Klüger ihre Leser in ihr autobiographisches Schreiben über die Shoah einbindet.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Autobiographie „weiter leben. Eine Jugend" von Ruth Klüger vor und beschreibt ihren Erfolg in der Literaturkritik und bei der Leserschaft. Die Autorin schildert ihre eigene Reaktion auf die Lektüre einer Textpassage und die daraus entstandene Fragestellung, die der Arbeit zugrunde liegt.
Im zweiten Kapitel wird ein kurzer Überblick über den Forschungsstand zu Ruth Klügers Autobiographie gegeben. Es wird auf die Auseinandersetzung der Autorin mit dem Deutungsprozess ihres eigenen Werks sowie auf die Rezeption von „weiter leben" durch Literaturwissenschaftler und Medien eingegangen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Problematik der Benennung und Interpretation des Holocaust. Die Autorin stellt die Aktualität des Themas anhand eines aktuellen Falls vor und thematisiert die verschiedenen Begriffe, mit denen der Massenmord der Nationalsozialisten an der jüdischen Bevölkerung Europas bezeichnet wird. Sie beleuchtet die Begriffsgeschichte von „Holocaust", „Shoah" und „Churban" und begründet ihren eigenen Umgang mit der Terminologie.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Ursachen, die die Darstellung der Shoah für die Überlebenden prekär werden lassen. Die Autorin zeigt den Zusammenhang zwischen dem historischen Ereignis, der Intention dieses zu bezeugen und dem Dilemma, die Ereignisse sprachlich zu erfassen und zu vermitteln. Sie skizziert die Problematiken, mit denen sich Autoren früherer Zeugnisse über die Shoah konfrontiert sahen, und argumentiert, dass das Schreiben der Überlebenden nicht nur als problematisches Darstellen eines schwer zu erfassenden Ereignisses verstanden werden kann, sondern auch als Mitteilungsproblem betrachtet werden muss.
Das fünfte Kapitel analysiert Ruth Klügers Autobiographie „weiter leben. Eine Jugend" und zeigt, wie die Autorin durch ihre Sprache und ihre Erzählstrategien die Rezipienten in ihr autobiographisches Schreiben über die Shoah einbindet. Die Autorin arbeitet heraus, wie Klügers konfrontativer Blick in der Sprache und ihre Erzählstrategien auf Involvierung des Lesers in das Erzählgeschehen zielen und darüber hinaus auch in die Nachgeschichte des Holocaust. Sie konzentriert sich auf die Interpretation einer längeren Erinnerungs-Passage, die sie als Schlüsselstelle im Werk Klügers ansieht, da sich in ihr die kommunikative Grundsituation zwischen Autorin und Leser widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Darstellbarkeit der Shoah in der Literatur, die Autobiographie von Ruth Klüger, „weiter leben. Eine Jugend", die Problematik der Benennung und Interpretation des Holocaust, die Schwierigkeiten beim Schreiben über die Shoah aus der Perspektive der Überlebenden, die Rezeption von Holocaust-Literatur und die kommunikative Grundsituation zwischen Autorin und Leser.
- Citar trabajo
- Julia Vodermeier (Autor), 2011, Darstellbarkeit der Shoah in der Literatur: Ruth Klügers "weiter leben. Eine Jugend", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213045