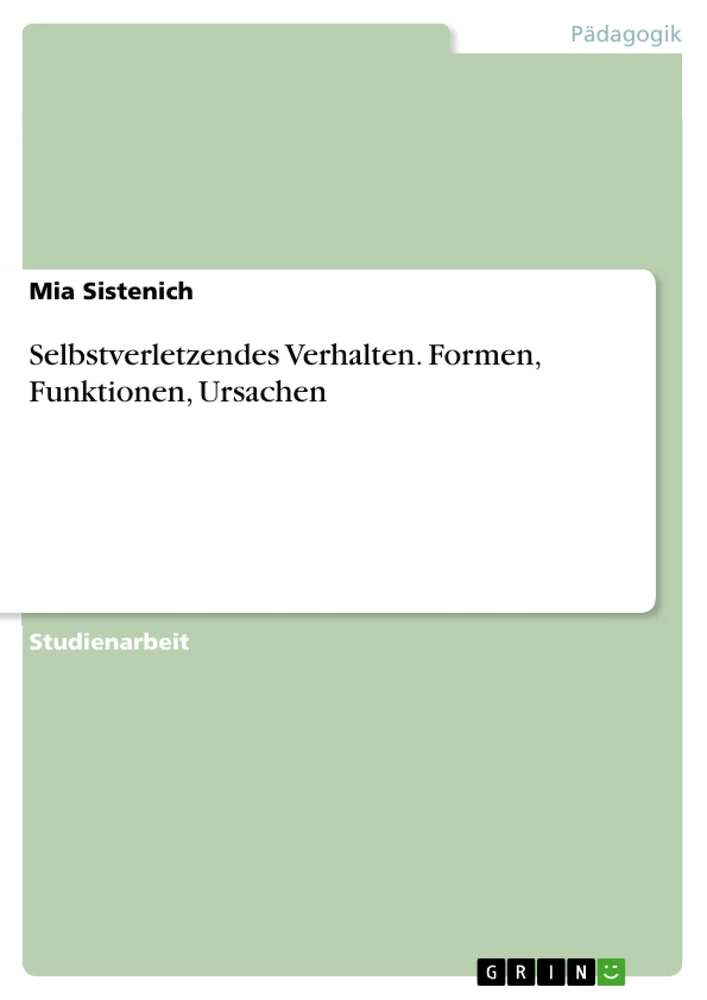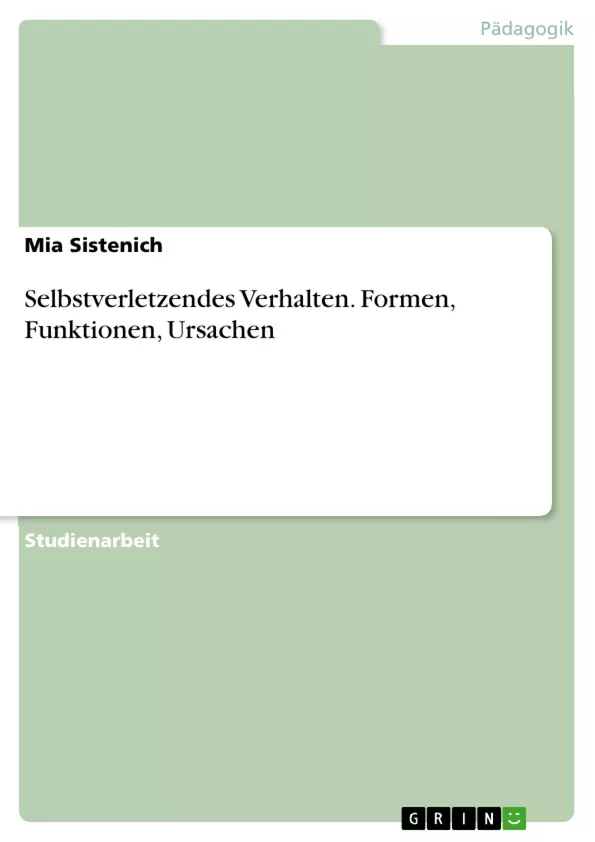Inhalt:
1.Hinführung 2
2. Begrifflichkeit selbstverletzenden Verhaltens 3
3. Formen selbstverletzenden Verhaltens 4
4. Funktionen selbstverletzenden Verhaltens 7
5. Ursachen selbstverletzenden Verhaltens 9
6. Fazit 13
Literatur
Erklärung
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Begrifflichkeit selbstverletzenden Verhaltens
- Formen selbstverletzenden Verhaltens
- Funktionen selbstverletzenden Verhaltens
- Ursachen selbstverletzenden Verhaltens
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema selbstverletzendes Verhalten, seinen Formen, Funktionen und Ursachen. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Erscheinungsformen der Selbstverletzung, untersucht ihre möglichen Funktionen für die Betroffenen und beleuchtet verschiedene Erklärungsmodelle für die Entstehung des Verhaltens. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für dieses komplexe Phänomen zu entwickeln und mögliche Interventionsansätze aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Selbstverletzendes Verhalten"
- Vielfältige Formen und Ausprägungen der Selbstverletzung
- Psychologische Funktionen der Selbstverletzung
- Mögliche Ursachen und Risikofaktoren für Selbstverletzung
- Therapiemöglichkeiten und Interventionsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung stellt das Thema Selbstverletzendes Verhalten vor und beleuchtet die Relevanz dieses Themas im Kontext der pädagogischen Arbeit. Es wird auf die Häufigkeit des Verhaltens, insbesondere bei Mädchen und jungen Frauen, hingewiesen und die Bedeutung des Themas für pädagogische Fachkräfte in verschiedenen Arbeitsfeldern hervorgehoben. Die Einleitung betont die Komplexität des Themas und die Schwierigkeit, das Störungsbild eindeutig zu klassifizieren.
-
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs "Selbstverletzendes Verhalten". Es wird zwischen direkten und indirekten Formen der Selbstverletzung unterschieden und die Grenzen zur Pathologie werden diskutiert. Der Text konzentriert sich auf die direkten Formen der Selbstverletzung und beleuchtet die Bedeutung des kulturellen Kontextes für die Interpretation des Verhaltens. Es werden Beispiele für ritualisierte Formen der Selbstverletzung in verschiedenen Kulturen vorgestellt, die im Gegensatz zu pathologischem Selbstverletzungsverhalten als sozial akzeptiert und in einen kulturellen Kontext eingebettet sind. Abschließend wird eine Definition von Selbstverletzendes Verhalten nach Petermann/Winkel vorgestellt, die das Verhalten als "funktionell motivierte Verletzung oder Beschädigung des eigenen Körpers" beschreibt.
-
Das Kapitel beschreibt die vielfältigen Erscheinungsformen selbstverletzenden Verhaltens. Es werden verschiedene Methoden der Selbstverletzung aufgezeigt, die von leichten Formen wie Haare ausreißen oder Sich-Beißen bis hin zu schweren Formen wie Kopf gegen die Wand schlagen oder Selbstverstümmelung reichen. Die Kapitel beleuchtet die Rolle des Schmerzes bei Selbstverletzung und geht auf mögliche Erklärungen für die fehlende Schmerzempfindung während des Verletzungsakts ein. Es wird auf die Häufigkeit des Verhaltens bei Frauen und die Ähnlichkeiten im Verhalten von Erwachsenen und Jugendlichen hingewiesen. Schließlich werden verschiedene Klassifikationsmodelle für Selbstverletzendes Verhalten vorgestellt, wobei der Fokus auf dem Modell der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie liegt.
-
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Funktionen selbstverletzenden Verhaltens. Es werden drei Hauptbereiche der Funktionen unterschieden: Selbstregulation, Bewältigung von Lebensereignissen und soziale Funktionen. Im Bereich der Selbstregulation werden die Funktionen der Sichtbarmachung eigener Gefühle, der Emotionsregulation, der Selbstbestrafung und der Selbstfürsorge erläutert. Die Bewältigung von belastenden Lebensereignissen durch Selbstverletzung wird im zweiten Bereich betrachtet, wobei die Funktionen der Traumabewältigung, der Herstellung von Liebes- und Zuwendungsgefühlen und der Beendigung dissoziativer Gefühle beleuchtet werden. Der dritte Bereich widmet sich den sozialen Funktionen der Selbstverletzung, die in der Kommunikation über eigene Gefühle, der Erlangung von Aufmerksamkeit und Zuwendung, der Regulierung von Nähe und Distanz, der sozialen Beeinflussung und Kontrolle sowie der Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit liegen können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Selbstverletzendes Verhalten, Formen, Funktionen, Ursachen, psychische Störungen, Trauma, Emotionsregulation, soziale Funktionen, Kommunikation, Therapie, Interventionsansätze, Risikofaktoren, biologische Faktoren, kognitive Faktoren, emotionale Aspekte, soziale Faktoren, Familientherapie, psychoanalytische Therapie, psychodynamische Therapie, tiefenpsychologische Therapie.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird selbstverletzendes Verhalten (SVV) definiert?
SVV wird als funktionell motivierte Verletzung oder Beschädigung des eigenen Körpers beschrieben, die oft der Emotionsregulation dient.
Welche psychologischen Funktionen erfüllt die Selbstverletzung?
Zu den Hauptfunktionen gehören die Selbstregulation (z. B. Abbau von Spannungen), die Bewältigung von Traumata und soziale Funktionen wie Kommunikation oder Abgrenzung.
Welche Formen der Selbstverletzung gibt es?
Die Formen reichen von Schneiden, Beißen und Haareausreißen bis hin zu schwereren Verletzungen wie dem Schlagen des Kopfes gegen Wände.
Warum empfinden Betroffene während der Tat oft keinen Schmerz?
Dies kann durch dissoziative Zustände erklärt werden, bei denen das Schmerzempfinden aufgrund extremer psychischer Anspannung zeitweise ausgeschaltet ist.
Welche sozialen Aspekte spielen bei SVV eine Rolle?
SVV kann als Hilferuf, Mittel zur Erlangung von Aufmerksamkeit oder als Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe fungieren.
- Citar trabajo
- Mia Sistenich (Autor), 2010, Selbstverletzendes Verhalten. Formen, Funktionen, Ursachen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213066