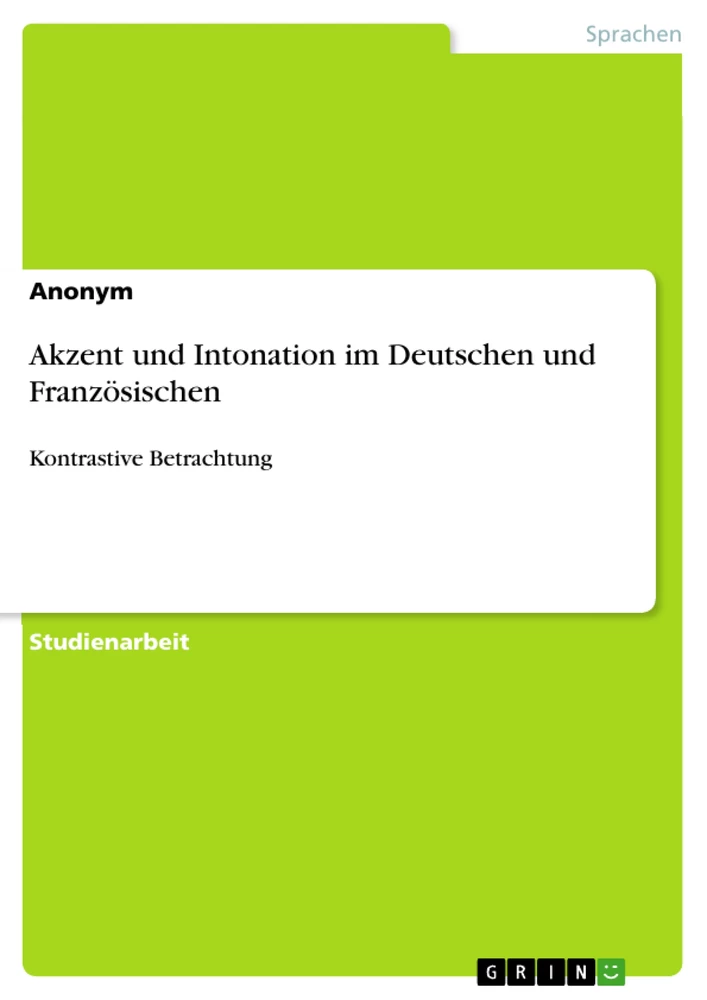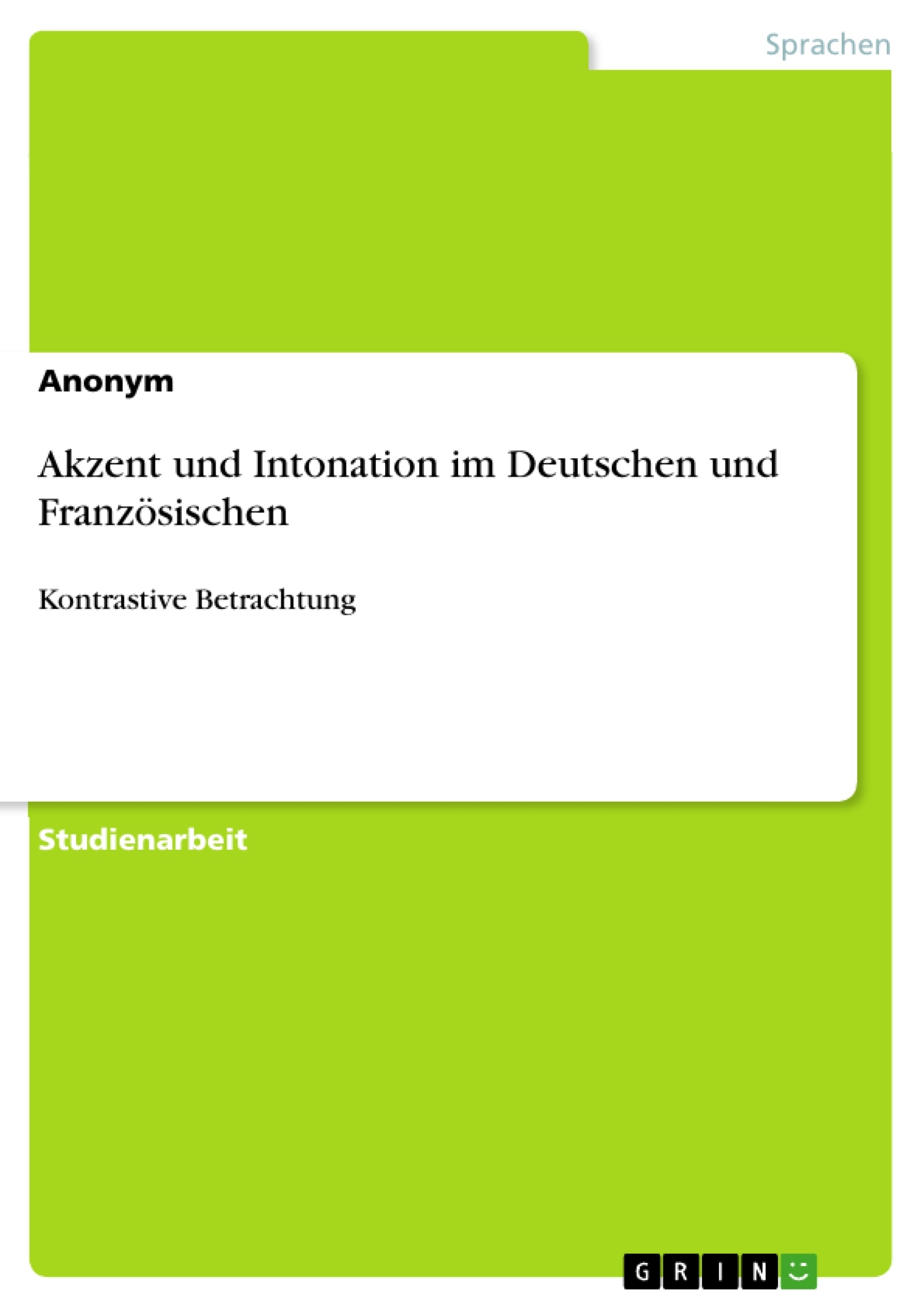Ziel der vorliegenden Arbeit soll eine Herausarbeitung der Unterschiede und der Parallelen zwischen dem deutschen und dem französischen Akzent- und Intonationssystem sein. Hierbei wird der Fokus auf der kontrastiven Betrachtung der sehr ungleichen Akzentmerkmale der zwei Sprachen liegen. Einem allgemeinen Überblick über das prosodische Phänomen des Akzents soll eine genauere Betrachtung des deutschen und des französischen Akzents folgen, diese wird anschließend durch eine Gegenüberstellung der Hervorhebungssysteme ergänzt. Der zweite Teil der Arbeit fährt mit der Vorstellung des eng mit dem Akzent zusammenhängenden prosodischen Merkmals der Intonation fort, abschließend soll der Versuch eines Vergleichs der französischen und deutschen Intonationskonturen unternommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Akzent
- Akzentsystem des Deutschen
- Akzentsystem des Französischen
- Zusammenfassung
- Intonation
- Intonationskonturen des Französischen und Deutschen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede und Parallelen zwischen dem deutschen und französischen Akzent- und Intonationssystem herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf dem kontrastiven Vergleich der Akzentmerkmale beider Sprachen. Es wird ein Überblick über das prosodische Phänomen des Akzents gegeben, gefolgt von einer detaillierten Betrachtung des deutschen und französischen Akzents und einer Gegenüberstellung der Hervorhebungssysteme. Der zweite Teil behandelt die Intonation und vergleicht die französischen und deutschen Intonationskonturen.
- Kontrastive Analyse des deutschen und französischen Akzentsystems
- Untersuchung der phonetischen Merkmale von Akzent und Intonation
- Vergleich der Hervorhebungsmittel im Deutschen und Französischen
- Analyse der Funktion von Akzent und Intonation in der Satzstruktur
- Bedeutung von Akzent und Intonation für die Sprachperzeption
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik heraus, dass selbst Franzosen mit exzellenten Deutschkenntnissen aufgrund prosodischer Unterschiede oft als Nicht-Muttersprachler identifiziert werden. Akzent und Intonation, als suprasegmentale Merkmale, spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Arbeit verfolgt das Ziel, diese Unterschiede und Parallelen zwischen Deutsch und Französisch kontrastiv zu beleuchten, wobei der Akzent im Mittelpunkt steht, gefolgt von einem Vergleich der Intonation.
Akzent: Dieses Kapitel definiert Akzent als die Hervorhebung von Silben durch Tonhöhe, Intensität und Dauer. Es werden dynamischer und musikalischer Akzent unterschieden. Die unterschiedliche Stärke der Betonung (Haupt- und Nebenakzent) wird erläutert, ebenso die Unterscheidung zwischen Sprachen mit festem und freiem Akzentsystem. Die Bedeutung des Akzents für die rhythmische Gliederung von Sprechakten und seine Funktion in der Satzbetonung (logischer und affektiver Akzent) werden diskutiert. Schließlich wird die Notwendigkeit eines Modells zur Beschreibung der Prominenzrelationen innerhalb sprachlicher Einheiten angesprochen.
Akzentsystem des Deutschen: Dieses Kapitel beschreibt das deutsche Akzentsystem, wobei das Wort als Basis der Akzentuierung gilt. Es werden akzentuierbare und nicht-akzentuierbare Wörter (Funktionswörter) unterschieden. Der Erhalt des Wortakzents im Satzkontext, jedoch mit veränderter Wahrnehmbarkeit, wird erwähnt. Die Nutzung des International Phonetic Alphabets (IPA) zur Notation von Akzenten wird erläutert, sowie die Problematik der Darstellung von Nebenakzenten.
Schlüsselwörter
Akzent, Intonation, Prosodie, Deutsch, Französisch, Kontrastive Linguistik, Suprasegmentalia, Betonung, Hervorhebung, Intonationskonturen, Phonetik, Phonologie, Muttersprachler, Fremdsprachenlernen.
Häufig gestellte Fragen zu: Kontrastive Analyse des deutschen und französischen Akzent- und Intonationssystems
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede und Parallelen zwischen dem deutschen und französischen Akzent- und Intonationssystem. Der Fokus liegt auf einem kontrastiven Vergleich der Akzentmerkmale beider Sprachen. Es werden sowohl der Akzent als auch die Intonation behandelt, um die Herausforderungen für Sprecher der einen Sprache beim Verstehen und Produzieren der anderen Sprache zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einführung in die Thematik, eine detaillierte Beschreibung der Akzentsysteme des Deutschen und des Französischen (inklusive der phonetischen Merkmale und der Notation mit dem International Phonetic Alphabet – IPA), einen Vergleich der Intonationskonturen beider Sprachen, sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Die Bedeutung von Akzent und Intonation für die Sprachperzeption und das Fremdsprachenlernen wird ebenfalls thematisiert.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede im Akzent und in der Intonation zwischen Deutsch und Französisch herauszuarbeiten und ein besseres Verständnis für die Herausforderungen beim Erlernen und Verstehen dieser Sprachen zu schaffen. Es geht um den kontrastiven Vergleich der Akzentmerkmale, die Untersuchung phonetischer Merkmale von Akzent und Intonation und den Vergleich der Hervorhebungsmittel in beiden Sprachen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Akzent (mit Unterkapiteln zum deutschen und französischen Akzentsystem), ein Kapitel zur Intonation und ein Fazit. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was wird unter Akzent verstanden?
Akzent wird als die Hervorhebung von Silben durch Tonhöhe, Intensität und Dauer definiert. Die Arbeit unterscheidet zwischen dynamischem und musikalischem Akzent und behandelt die Bedeutung des Akzents für die rhythmische Gliederung von Sprechakten und seine Funktion in der Satzbetonung (logischer und affektiver Akzent).
Wie wird der deutsche Akzent beschrieben?
Das Kapitel zum deutschen Akzentsystem beschreibt das Wort als Basis der Akzentuierung und unterscheidet zwischen akzentuierbaren und nicht-akzentuierbaren Wörtern (Funktionswörter). Es wird erläutert, wie der Wortakzent im Satzkontext erhalten bleibt, aber seine Wahrnehmbarkeit sich verändert. Die Nutzung des IPA zur Notation von Akzenten und die Problematik der Darstellung von Nebenakzenten werden ebenfalls besprochen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Akzent, Intonation, Prosodie, Deutsch, Französisch, Kontrastive Linguistik, Suprasegmentalia, Betonung, Hervorhebung, Intonationskonturen, Phonetik, Phonologie, Muttersprachler, Fremdsprachenlernen.
Warum ist diese Thematik relevant für das Fremdsprachenlernen?
Die Arbeit verdeutlicht, dass prosodische Unterschiede, insbesondere im Akzent und in der Intonation, entscheidend für die Identifizierung von Mutter- und Nicht-Muttersprachlern sind. Selbst bei exzellenten Kenntnissen der Grammatik und des Wortschatzes können prosodische Fehler dazu führen, dass ein Sprecher als Nicht-Muttersprachler wahrgenommen wird. Das Verständnis dieser Unterschiede ist daher essentiell für erfolgreiches Fremdsprachenlernen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Akzent und Intonation im Deutschen und Französischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213150