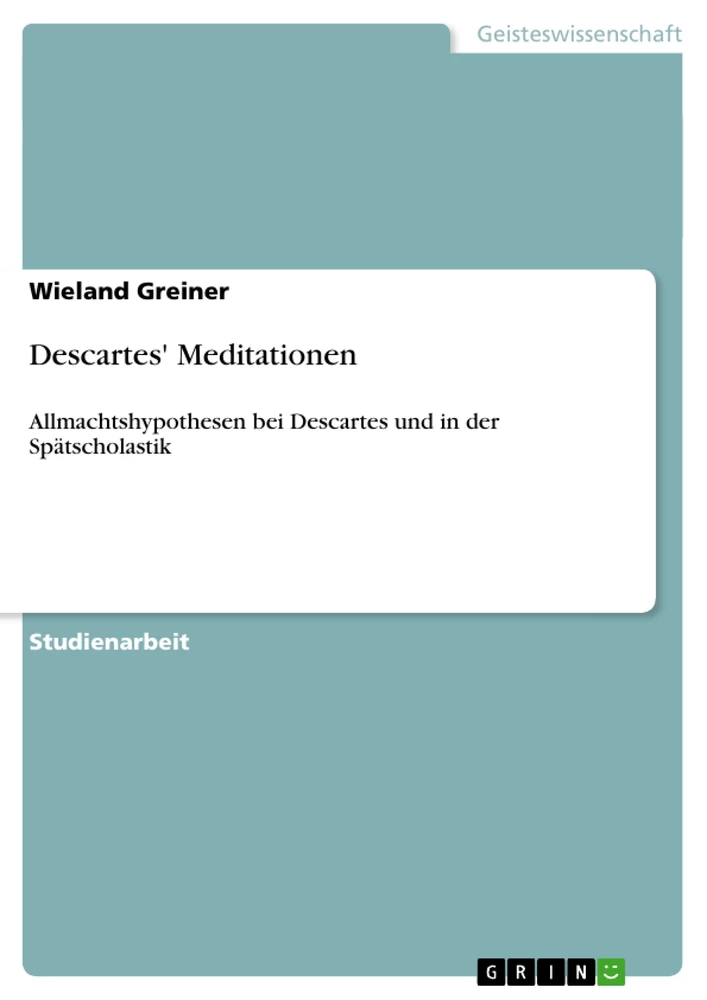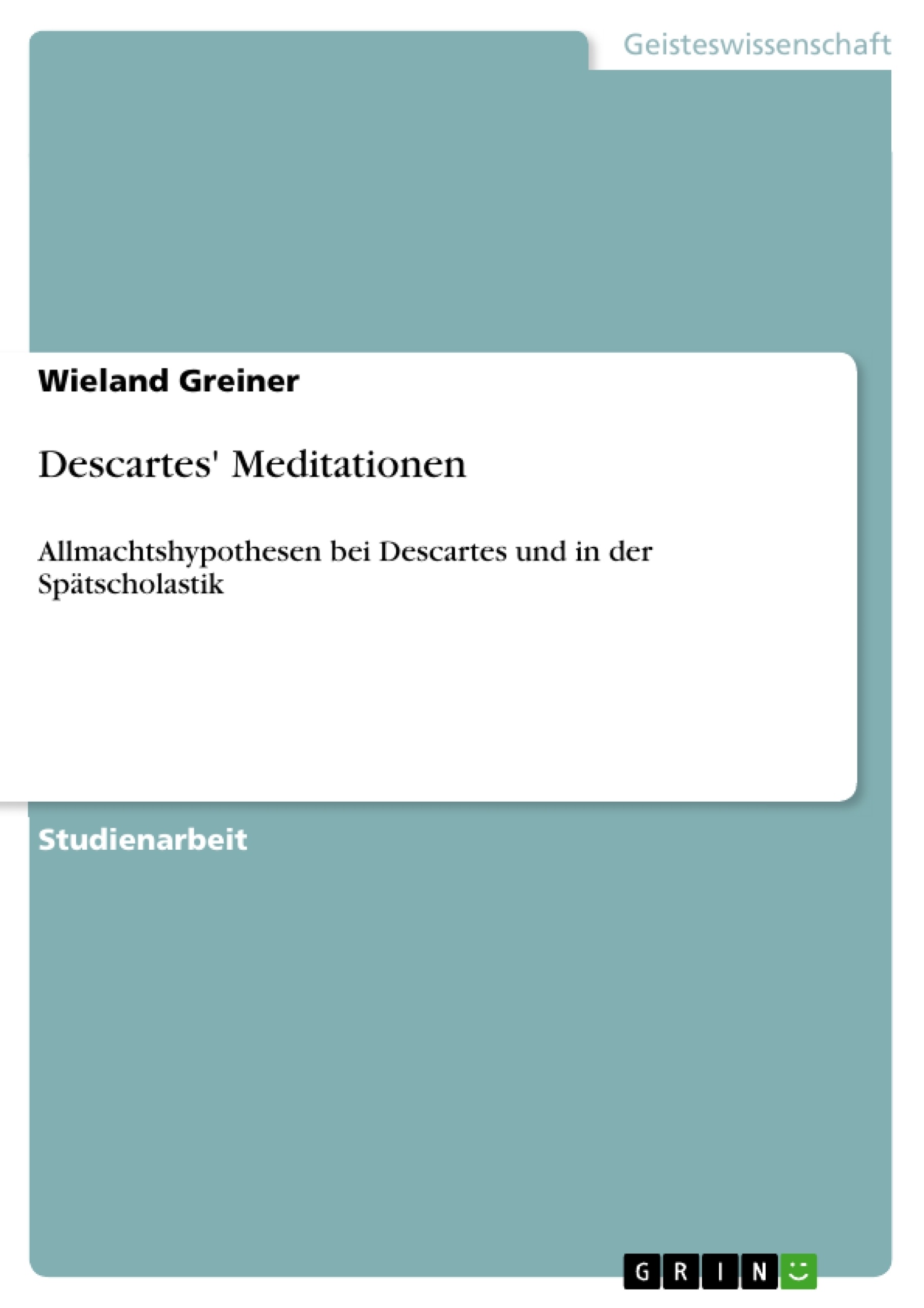Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung
2.Descartes' methodischer Zweifel
3.Der täuschende Dämon bei Thomas von Aquin
4.Die Allmachtshypothese bei Olivi und Rodington
5.Schluss
6.Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Descartes' methodischer Zweifel
- Der täuschende Dämon bei Thomas von Aquin
- Die Allmachtshypothese bei Olivi und Rodington
- Peter Johannis Olivi
- Johannes Rodington
- Schluss
- Literaturverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verwendung der Hypothese eines allmächtigen Täuschergottes in der Philosophie des 13. und 14. Jahrhunderts und bei René Descartes. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Funktion dieses skeptischen Arguments in den jeweiligen philosophischen Kontexten zu analysieren und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Verwendung der Allmachtshypothese bei den genannten Autoren aufzuzeigen.
- Die Rolle der Allmachtshypothese in der Erkenntnistheorie des Spätmittelalters
- Die Funktion des methodischen Zweifels bei Descartes
- Die Auseinandersetzung mit skeptischen Argumenten im Kontext der scholastischen Philosophie
- Die Rezeption der antiken Skepsis im Mittelalter
- Die Entwicklung des skeptischen Denkens im 13. und 14. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Allmachtshypothese und deren Bedeutung in der Philosophiegeschichte ein. Sie stellt dar, dass die Hypothese eines täuschenden Gottes bereits im Spätmittelalter eine wichtige Rolle in der Erkenntnistheorie spielte und nicht erst, wie Richard Popkin behauptet, mit Beginn der Neuzeit im philosophischen Diskurs Einzug hielt.
Das zweite Kapitel widmet sich Descartes' methodischem Zweifel und der Rolle der Allmachtshypothese in dessen erster Meditation. Descartes' Ziel ist es, ein sicheres Fundament für wissenschaftliche Erkenntnis zu legen. Um dies zu erreichen, unterzieht er alle seine Meinungen und Überzeugungen einer radikalen skeptischen Prüfung. Dabei spielt die Hypothese eines täuschenden Gottes eine zentrale Rolle, da sie es Descartes ermöglicht, selbst die scheinbar evidentesten Vernunftwahrheiten der Mathematik und Geometrie in Zweifel zu ziehen.
Das dritte Kapitel untersucht die Funktion der Allmachtshypothese in der Erkenntnistheorie Thomas von Aquins. Thomas geht davon aus, dass ein allmächtiger Gott zwar theoretisch in der Lage wäre, den Menschen zu täuschen, dies aber nicht tun würde, da Täuschung eine Sünde darstellt. Thomas' Hauptargument gegen einen täuschenden Gott basiert auf der Vorstellung, dass Gott über eine absolute Macht verfügt, die an das Gesetz der Widerspruchsfreiheit gebunden ist. Folglich kann Gott nicht gleichzeitig eine bestimmte Ordnung schaffen und diese gleichzeitig außer Kraft setzen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Einwänden und Ergänzungen, die von Zeitgenossen des Thomas' im Zuge ihrer Auseinandersetzung mit seiner Philosophie vorgebracht wurden. Peter Johannis Olivi und Johannes Rodington nutzen die Allmachtshypothese, um die Schwächen der thomistischen Species-Theorie aufzuzeigen. Olivi argumentiert, dass Gott theoretisch alle im Intellekt existierenden Species ex nihilo erzeugen könnte, ohne dass ein realer Gegenstand existiert. Rodington hingegen stellt die Möglichkeit einer Täuschung durch Gott nicht in Frage, betont aber, dass Gott mit seinen Eingriffen in den Erkenntnisprozess nicht unbedingt etwas Schlechtes beabsichtigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Allmachtshypothese, den methodischen Zweifel, die Erkenntnistheorie, die scholastische Philosophie, die Spätscholastik, die Skepsis, die Species-Theorie, Thomas von Aquin, René Descartes, Peter Johannis Olivi und Johannes Rodington.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Descartes' methodischem Zweifel?
Descartes möchte ein absolut sicheres Fundament für wissenschaftliche Erkenntnisse schaffen, indem er alles bezweifelt, was nicht zweifelsfrei gewiss ist.
Was versteht man unter der Allmachtshypothese?
Es ist das skeptische Argument eines allmächtigen Gottes oder "bösen Dämons", der den Menschen selbst in grundlegenden logischen oder mathematischen Wahrheiten täuschen könnte.
Wurde die Allmachtshypothese erst von Descartes erfunden?
Nein, die Arbeit zeigt auf, dass diese Hypothese bereits in der Spätscholastik des 13. und 14. Jahrhunderts (z.B. bei Olivi und Rodington) diskutiert wurde.
Wie beurteilt Thomas von Aquin die Möglichkeit eines täuschenden Gottes?
Thomas lehnt dies ab, da Täuschung als Sünde mit der vollkommenen Natur Gottes unvereinbar ist und Gott an das Prinzip der Widerspruchsfreiheit gebunden ist.
Welche Rolle spielt die Species-Theorie in diesem Kontext?
Kritiker wie Peter Johannis Olivi nutzten die Allmachtshypothese, um Schwächen in der thomistischen Erkenntnistheorie (Species-Theorie) aufzuzeigen.
Was ist das Ergebnis des Vergleichs zwischen Mittelalter und Neuzeit?
Die Arbeit weist nach, dass skeptische Argumente eine kontinuierliche Entwicklung vom Spätmittelalter bis zu Descartes durchliefen und nicht erst mit der Neuzeit begannen.
- Arbeit zitieren
- Wieland Greiner (Autor:in), 2012, Descartes' Meditationen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213248