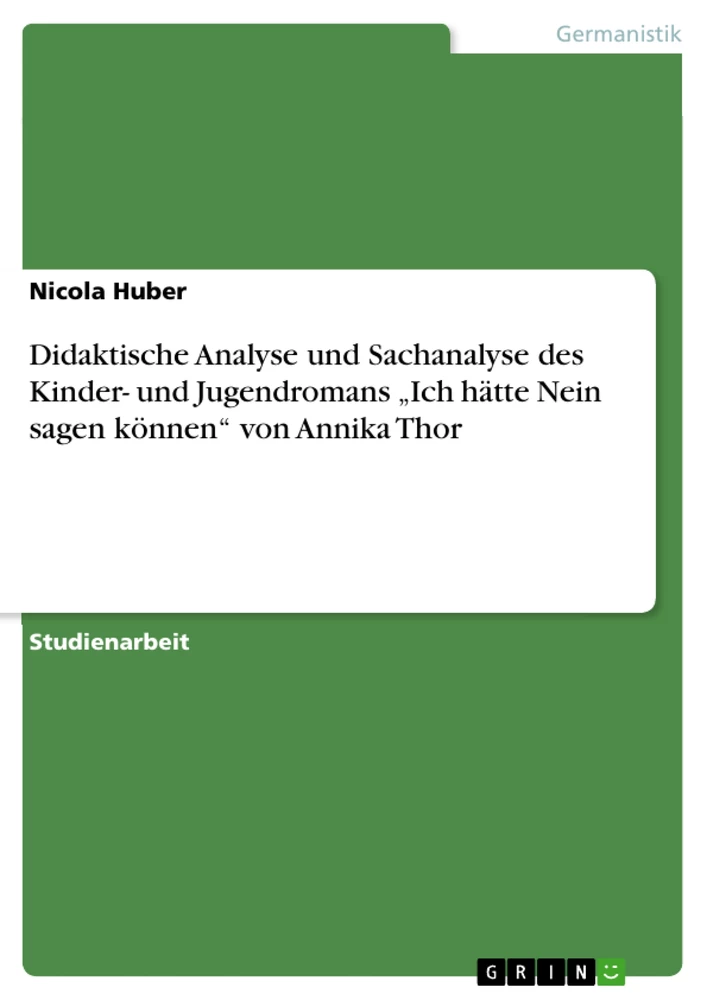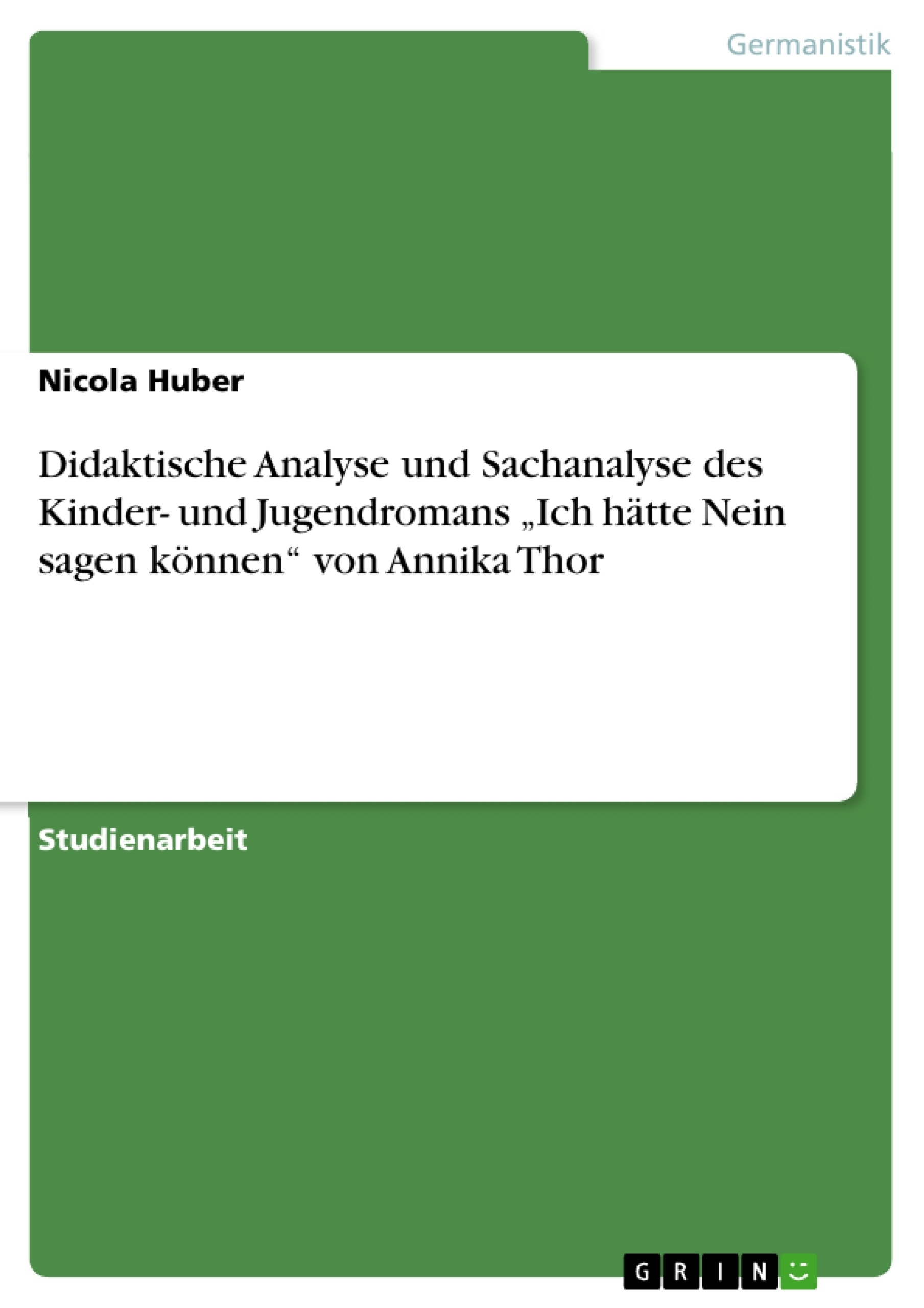Nach einer kurzen Einführung, in der der Roman für eine geeignete Jahrgangsstufe ausgewählt wurde, beschäftigt sich die vorliegende Hausarbeit in erster Linie mit einer Sachanalyse und einer didaktischen Analyse des Jugendbuches. Die Sachanalyse unter Punkt 2 ist eine fachwissenschaftliche Analyse des Gegenstandes. Zunächst stellt eine kurze Inhaltsangabe die wichtigsten Aspekte dar, anschließend werden diese analysiert und interpretiert. Punkt 3 entwirft schließlich die didaktische Analyse des Gegenstandes und seiner Aspekte. Dabei geht die Autorin u. a. näher auf die Ziele ein, die das Lesen des Romans bewirken kann und soll. Der Schluss unter Punkt 4 zieht mit „Ein Buch, das Mut macht...“1 ein kurzes Resümee, welches die Bedeutung dieses Jugendromans für den (Deutsch-)Unterricht hervorheben soll.
Inhaltsverzeichnis
- Moderne Jugendliteratur?
- Einordnung in den Lehrplan
- Vorgehensweise. Quellenlage
- Fachwissenschaftliche Analyse (Sachanalyse) des Gegenstands
- Inhaltsangabe
- Analyse und Interpretation
- Inhalt
- Erzähltechnik und Aufbau
- Sprache
- Paratextuelle Merkmale
- Didaktische Analyse des Gegenstands und seiner Aspekte
- Textattraktivität
- Textqualität
- Textverständlichkeit
- Ziele
- Leseförderung
- Literarisches Lernen
- Pädagogisch-psychologische Ziele
- Sachbezogenes Lernen
- Entwicklung des literarischen Verstehens
- „Ein Buch, das Mut macht..."
- Literaturverzeichnis
- Primärliteratur
- Wissenschaftliche Literatur
- Internetadressen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Jugendroman „Ich hätte Nein sagen können" von Annika Thor, um seine Eignung als Lektüre für die sechste Klasse eines Gymnasiums zu beurteilen. Die Arbeit setzt sich mit der Sachanalyse und der didaktischen Analyse des Romans auseinander und untersucht seine Textqualität, -verständlichkeit und seine pädagogischen Potenziale.
- Mobbing und seine Auswirkungen
- Freundschaftsbeziehungen und Cliquenbildung in der Pubertät
- Identitätssuche und moralische Entwicklung
- Soziale Schichten und Lebensbedingungen
- Die Bedeutung von Empathie und Verantwortung
Zusammenfassung der Kapitel
Der Roman erzählt die Geschichte von Nora Berglund, einem beinahe 12-jährigen Mädchen, das in Stockholm in die sechste Klasse geht. Ihre beste Freundin Sabina hat sich von ihr abgewendet und schließt sich einer neuen Clique um Fanny an. Nora versucht, wieder in Sabinas Freundeskreis aufgenommen zu werden, und lässt sich auf eine Intrige gegen Karin Eriksson ein, die als Außenseiterin in der Klasse gilt. Die Clique mobbt Karin sowohl verbal als auch körperlich, und Nora trägt durch ihr Verhalten maßgeblich zu Karins Demütigung bei. Am Ende des Romans verlässt Karin die Schule, und Nora muss mit ihrer Schuld leben.
Die Analyse des Romans zeigt, dass Annika Thor ein sensibles Thema wie Mobbing auf eine realistische und nachvollziehbare Weise behandelt. Sie beleuchtet die Auswirkungen von Mobbing auf das Opfer und die Täter, und sie stellt die moralische Entwicklung der Protagonistin Nora in den Vordergrund. Der Roman zeichnet ein realistisches Bild von Freundschaftsbeziehungen in der Pubertät, die von Konkurrenz, Eifersucht und dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit geprägt sind. Thor zeigt, dass Mobbing nicht nur das Opfer, sondern auch die Täter nachhaltig prägen kann.
Die didaktische Analyse des Romans zeigt, dass „Ich hätte Nein sagen können" sich hervorragend als Lektüre für die sechste Klasse eignet. Der Roman ist sprachlich einfach gehalten und bietet durch seine kurzen Kapitel und die klare Erzählstruktur einen guten Einstieg in die Welt des Jugendbuches. Das Thema Mobbing ist den Schüler_innen aus eigener Erfahrung bekannt, und der Roman bietet ihnen die Möglichkeit, sich mit diesem schwierigen Thema auseinanderzusetzen. Der Roman fördert Empathie, Selbstreflexion und die Entwicklung des literarischen Verstehens.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Jugendroman „Ich hätte Nein sagen können", Mobbing, Freundschaft, Identitätssuche, moralische Entwicklung, Pubertät, soziale Schichten, Lebensbedingungen, Empathie, Verantwortung, Leseförderung, literarisches Lernen und pädagogisch-psychologische Ziele.
- Quote paper
- Nicola Huber (Author), 2012, Didaktische Analyse und Sachanalyse des Kinder- und Jugendromans „Ich hätte Nein sagen können“ von Annika Thor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213386