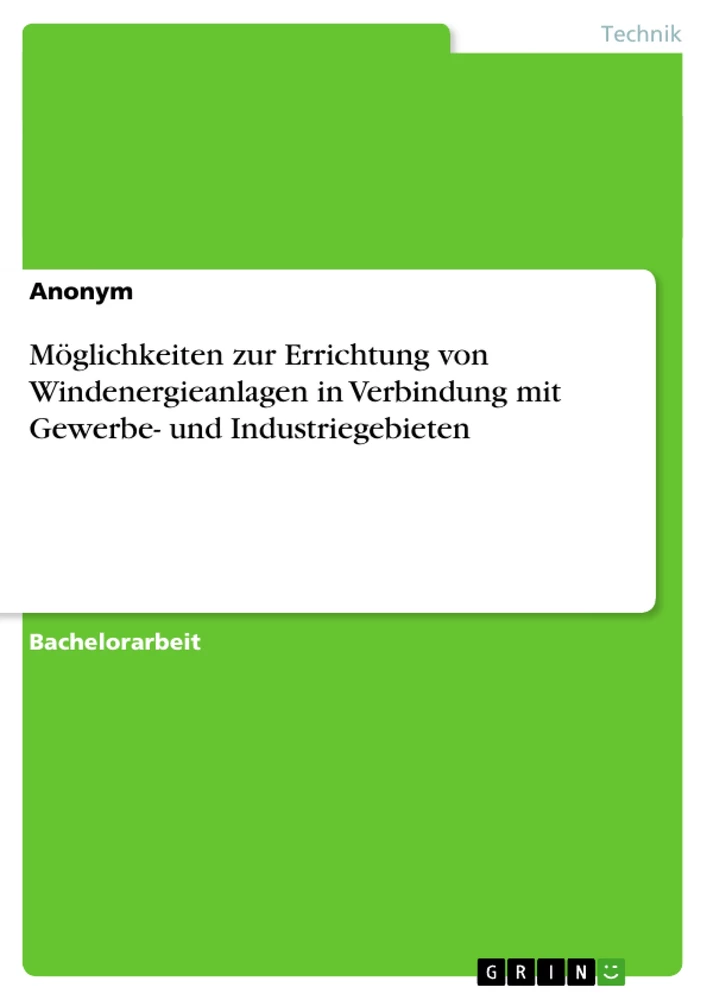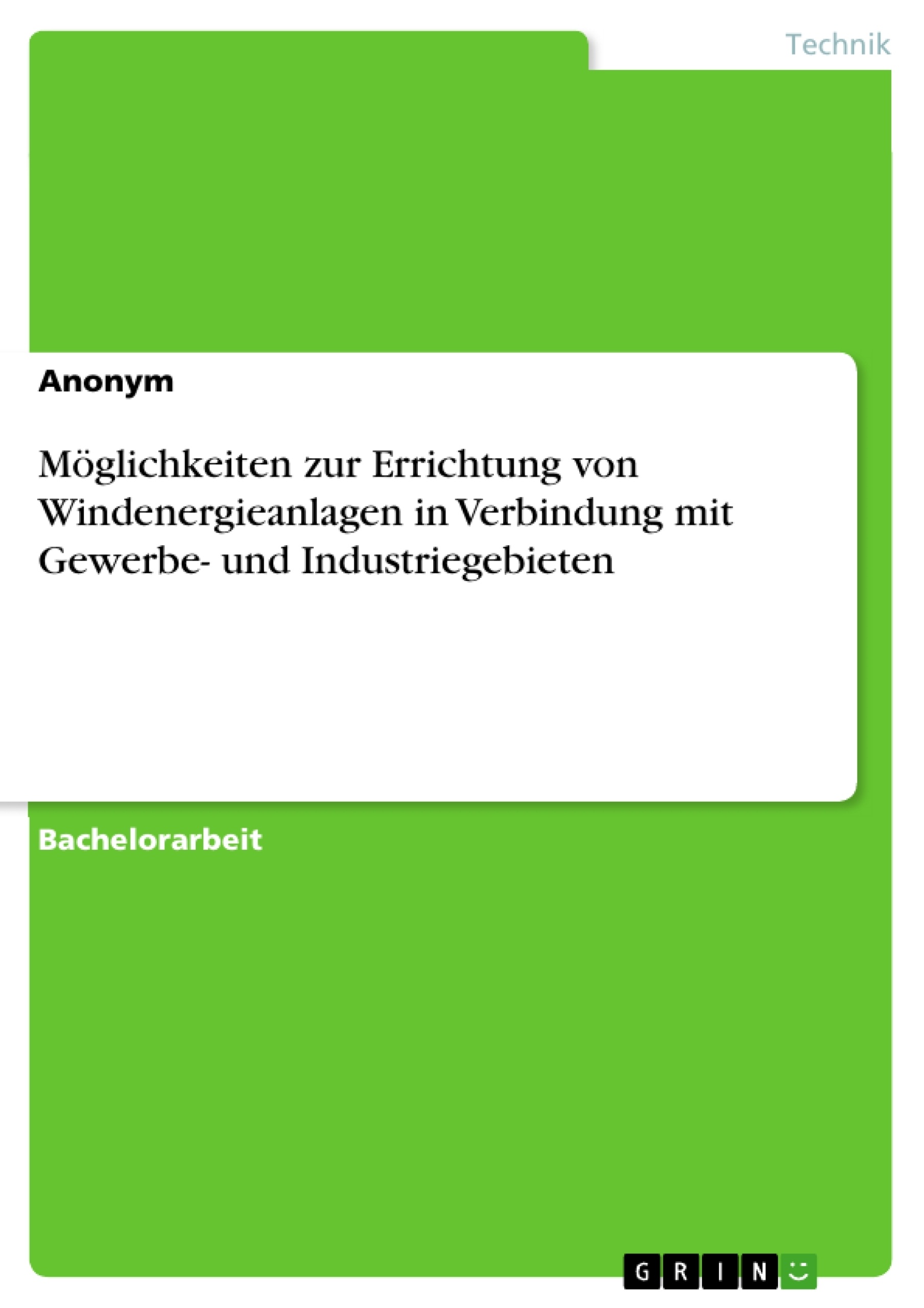EINLEITUNG
„Grün ist in.“ Der ökologische Idealismus ist zur Mode avanciert und lässt sich aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein – in seiner unreflektierten Verwendung – nicht mehr weg-denken. Selbst bei oberflächlicher Medienverfolgung vergeht kaum ein Nachrichtenblock, eine politische Debatte oder eine Werbepause ohne Schlagwörter wie regenerativ, nachhaltig oder grün.
Ein ökologisches Umdenken steht in der Annahme die einzige Option für eine zukunftsträchtige Welt zu sein, wobei nicht eindeutig zu sein scheint, was das tatsächlich bedeutet. So wirbt nahezu jeder Konzern mit diesem Image, egal ob er die Weltmeere verschmutzt wie der Mineralölriese BP oder Milliarden verkalkuliert wie die Hypo Real Estate Bank. Autokonzerne, die durch intensive Lobbyarbeit neue klimafreundliche Mobilitätsstrategien verhindern, gewinnen Nachhaltigkeitspreise. Chemiegiganten, deren gentechnisch verändertes Saatgut weltweit kleine Bauern in die Schuldenspirale treibt, landen bei Nachhaltigkeitsrankings weit vorn. Fluggesellschaften setzen auf Biosprit und die Flughafenbetreiber wirtschaften paradoxerweise – ihrem offiziellen Credo zufolge – nachhaltig, ebenso wie Fast-Food-Konzerne oder die deutsche Zementindustrie. Wo man auch hinschaut, die Nachhaltigkeit ist schon da.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen
- Schädliche Umwelteinwirkungen durch Windenergieanlagen
- Schall
- Schattenwurf
- Sonstige Gefährdungen und Einschränkungen
- Baurecht von Windenergieanlagen
- Flächennutzungsplan
- Bebauungsplan
- Ausweisung von Zonen
- Höhenbegrenzung
- Abstandflächen
- Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
- Netzanschluss
- Transport
- Errichtung am Aufstellort
- Inbetriebnahme
- Gewerbe- & Industriegebiete
- Wirtschaftliche Betrachtung von Windenergieanlagen
- Verwirklichte oder geplante Anlagen in Gewerbe- und Industriegebieten
- Für und Wider von Windenergieanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten
- Fazit / Ausblick
- Zusammenfassung
- Verzeichnisse
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Errichtung von Windenergieanlagen in Verbindung mit Gewerbe- und Industriegebieten. Sie untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich aus dieser speziellen Standortwahl ergeben. Dabei werden sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die wirtschaftlichen Aspekte beleuchtet.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten
- Umweltverträglichkeit von Windenergieanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten
- Wirtschaftliche Aspekte der Windenergieproduktion in Gewerbe- und Industriegebieten
- Realisierte und geplante Projekte zur Windenergienutzung in Gewerbe- und Industriegebieten
- Vorteile und Nachteile der Errichtung von Windenergieanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten im Vergleich zu anderen Standorten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die aktuelle Situation der Windenergie in Deutschland und die Notwendigkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien beleuchtet. Im zweiten Kapitel wird das Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen in Deutschland, mit besonderem Fokus auf Nordrhein-Westfalen, erläutert. Es werden die verschiedenen Behörden und Verfahren sowie die relevanten Gesetze und Verordnungen vorgestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit den schädlichen Umwelteinwirkungen von Windenergieanlagen. Hier werden die Themen Lärm, Schattenwurf und weitere Gefährdungen wie Eiswurf und die bedrängende Wirkung diskutiert. Die Arbeit erläutert die geltenden Immissionsrichtwerte und die Anforderungen an die Planung und den Betrieb von Windenergieanlagen, um diese Einwirkungen zu minimieren.
Kapitel 4 behandelt das Baurecht von Windenergieanlagen. Es werden die verschiedenen Planungsinstrumente wie Flächennutzungsplan und Bebauungsplan sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergie dargestellt. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Höhenbegrenzungen und Abstandflächen für die Planung von Windenergieanlagen, insbesondere in Gewerbe- und Industriegebieten.
Kapitel 5 beschreibt die einzelnen Schritte der Errichtung und des Betriebs einer Windenergieanlage. Es werden die Themen Netzanschluss, Transport, Montage und Inbetriebnahme detailliert erläutert. Dabei wird auch auf die Besonderheiten der Errichtung von Windenergieanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten im Vergleich zu anderen Standorten eingegangen.
Kapitel 6 definiert Gewerbe- und Industriegebiete im Rahmen der Bauleitplanung und erläutert die Unterschiede zwischen diesen beiden Gebietstypen. Die Arbeit beleuchtet die Zulässigkeit und die besonderen Anforderungen an die Errichtung von Windenergieanlagen in diesen Gebieten.
Kapitel 7 widmet sich der Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen. Es werden die verschiedenen Kostenfaktoren und Einnahmequellen einer Windenergieanlage betrachtet. Die Arbeit untersucht die spezifischen Kosten der Windenergieproduktion und die Bedeutung der Windhöffigkeit für die Wirtschaftlichkeit einer Anlage. Darüber hinaus werden die Unterschiede in der Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten im Vergleich zu anderen Standorten beleuchtet.
Kapitel 8 präsentiert einige Beispiele für bereits realisierte oder geplante Windenergieanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten. Anhand dieser Beispiele werden die verschiedenen Planungsprozesse und die Herausforderungen bei der Errichtung von Windenergieanlagen in diesen Gebieten aufgezeigt.
Kapitel 9 diskutiert die Vor- und Nachteile der Errichtung von Windenergieanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten. Es werden die Auswirkungen auf die Natur und Umwelt, die vorhandene Infrastruktur und die Wirtschaftlichkeit der Anlage betrachtet. Die Arbeit stellt die Vorteile der Windenergienutzung in diesen Gebieten heraus und diskutiert gleichzeitig die potenziellen Konflikte und Herausforderungen.
Die Arbeit endet mit einem Fazit und einem Ausblick. Es werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die zukünftigen Herausforderungen für die Windenergienutzung in Gewerbe- und Industriegebieten diskutiert. Die Arbeit betont die Bedeutung der Windenergie für die Energiewende und die Notwendigkeit, weitere geeignete Standorte für Windenergieanlagen zu erschließen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Windenergie, Gewerbegebiete, Industriegebiete, Errichtung, Betrieb, Genehmigungsverfahren, Baurecht, Umwelteinwirkungen, Wirtschaftlichkeit, Dezentrale Energieversorgung, Erneuerbare Energien, Energiewende, Nachhaltigkeit, Nordrhein-Westfalen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Errichtung von Windkraftanlagen in Industriegebieten vorteilhaft?
In diesen Gebieten ist die Akzeptanz oft höher, da bereits eine industrielle Vorbelastung besteht und der Strom direkt vor Ort von Unternehmen genutzt werden kann (dezentrale Versorgung).
Welche Umwelteinwirkungen müssen bei der Planung beachtet werden?
Zentrale Aspekte sind Schallemissionen (Lärm), der Schattenwurf der Rotoren sowie potenzielle Gefahren durch Eiswurf.
Welche baurechtlichen Vorgaben gelten für Windenergieanlagen?
Die Planung erfolgt über Flächennutzungs- und Bebauungspläne, wobei Höhenbegrenzungen, Abstandsflächen und Konzentrationszonen eine wichtige Rolle spielen.
Wie wird die Wirtschaftlichkeit einer Windkraftanlage bestimmt?
Entscheidend sind die Windhöffigkeit des Standorts, die Investitionskosten, Einspeisevergütungen und die Kosten für den Netzanschluss.
Welche Besonderheiten gibt es beim Genehmigungsverfahren in NRW?
Das Verfahren umfasst verschiedene Behörden und muss strikte Immissionsrichtwerte sowie naturschutzrechtliche Vorgaben erfüllen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Möglichkeiten zur Errichtung von Windenergieanlagen in Verbindung mit Gewerbe- und Industriegebieten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213393