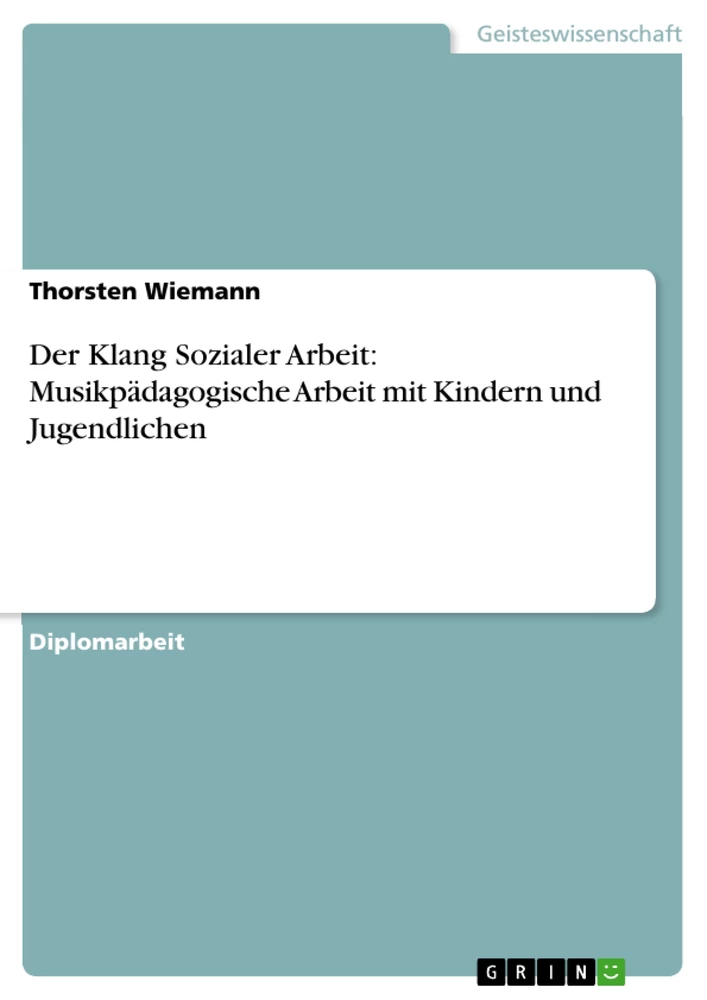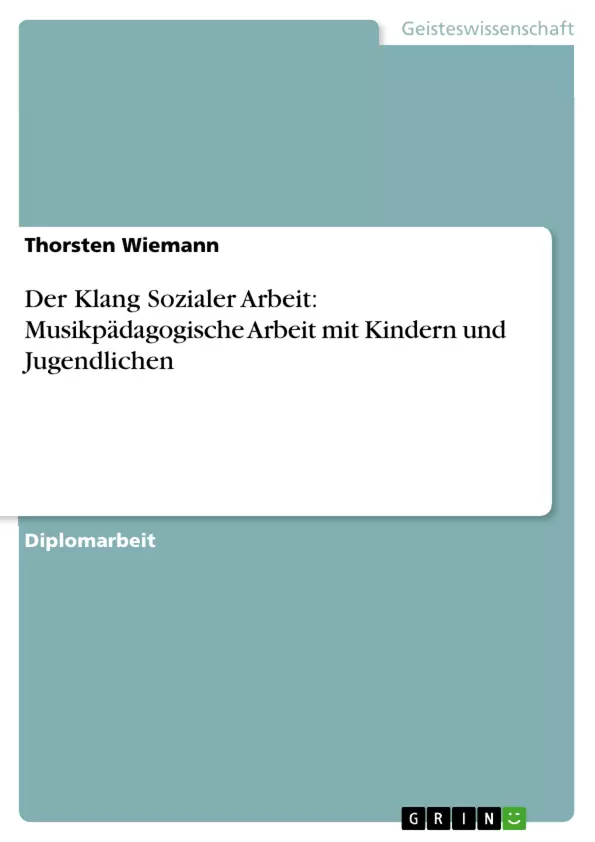Mit Musik geht fast alles besser. Die vorliegende Arbeit soll aufzeigen, dass die Arbeit von PädagogInnen - auch ohne besondere Musikalität - durch den Einsatz von Musik intensiviert und effektiver gestaltet werden kann. Neben einer theoretischen Betrachtung der Möglichkeiten des Mediums Musik geht es darum, die in der Sozialen Arbeit tätigen Menschen zu motivieren, Musik intensiver in pädagogische Prozesse einfließen zu lassen. Hierfür werden konkrete praktische Beispiele des pädagogischen Alltags erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Organigramm
- Einleitung
- Theoretischer Überblick
- Vom Hören
- Der Vorgang des Hörens
- Hören macht Sinn
- Musik an Gehirn
- Musik und Mensch
- Musik im Gehirn
- Musik und Kompetenzerwerb
- Soziale Kompetenz
- Intelligenzentwicklung
- Konzentration
- Schulische Leistungen
- Musik und sozialkommunikative Prozesse
- Musik und Sozialisation
- Musik und Kultur
- Vom Hören
- Praktischer Überblick
- Grundlegende Aspekte
- Musizieren
- Musik mit Kindern
- Singen
- Instrumentalspiel
- Kinderreime, Kindertänze und Kreisspiele
- Musik verstehen
- Instrumentalunterricht
- Musik mit Jugendlichen
- Das Equipment
- Die Band
- Das Konzert
- Musik-Links
- Musik und Sozialschaffende
- Musik im Teamprozess
- Biographische Arbeit
- Improvisation
- Musik im Teamprozess
- Schlussbetrachtung
- Quellenverzeichnis
- Zitierte Literatur
- Flankierende Literatur
- Internetrecherche @
- Abbildungsverzeichnis
- Verwendete Tonträger in chronologischer Reihenfolge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Der Klang Sozialer Arbeit“ beleuchtet die musikpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und zeigt auf, wie Musik sinnvoll in die Praxis der Sozialen Arbeit integriert werden kann. Der Fokus liegt dabei auf der Nutzung von Musik als Medium zur Förderung von Sozialkompetenz, Intelligenzentwicklung, Konzentration und schulischen Leistungen. Die Arbeit soll PädagogInnen motivieren, Musik intensiver in ihre Arbeit einzubinden und die vielfältigen Möglichkeiten des Mediums Musik für die pädagogische Praxis aufzuzeigen.
- Die Bedeutung von Musik für die menschliche Entwicklung
- Die Wirkung von Musik auf das Gehirn und die Förderung von Kompetenzen
- Musik als Mittel der Sozialisation und kulturellen Vermittlung
- Praktische Beispiele für musikpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Die Rolle von Musik im Teamprozess und in der Supervision
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Bedeutung von Musik in der Geschichte und im heutigen Leben dar. Im theoretischen Überblick wird der Vorgang des Hörens und die Wirkung von Musik auf das Gehirn beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von Musik für die Entwicklung von Sozialkompetenz, Intelligenz und Konzentration. Der praktische Überblick präsentiert grundlegende Aspekte der musikpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit mit Jugendbands und die Bereitstellung von Proberäumen werden als wichtige Elemente der musikpädagogischen Praxis vorgestellt. Die Arbeit mit Musik im Teamprozess wird anhand von biographischer Arbeit und Improvisation näher betrachtet. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und plädiert für eine stärkere Einbindung von Musik in die pädagogische Praxis.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Musikpädagogik, die Soziale Arbeit, die Förderung von Kompetenzen, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die Bedeutung von Musik für die Sozialisation, die Nutzung von Musik im Teamprozess, die Arbeit mit Jugendbands und die Bereitstellung von Proberäumen. Die Arbeit beleuchtet die vielfältigen Möglichkeiten, wie Musik in der Sozialen Arbeit sinnvoll eingesetzt werden kann.
Häufig gestellte Fragen
Wie hilft Musik in der Sozialen Arbeit?
Musik kann pädagogische Prozesse intensivieren und als Medium zur Förderung von Sozialkompetenz, Intelligenz und Konzentration dienen.
Müssen Pädagogen musikalisch sein, um Musik einzusetzen?
Nein, die Arbeit zeigt auf, dass Musik auch ohne besondere Musikalität der Pädagogen effektiv in den Alltag integriert werden kann.
Welche musikpädagogischen Angebote gibt es für Kinder?
Die Arbeit nennt Singen, Instrumentalspiel, Kinderreime, Tänze und Kreisspiele als praktische Beispiele.
Wie sieht die Arbeit mit Jugendlichen aus?
Bei Jugendlichen stehen oft das Equipment, die Gründung von Bands und die Organisation von Konzerten im Vordergrund.
Was bedeutet „biographische Arbeit“ mit Musik?
Dabei wird Musik genutzt, um Lebensereignisse zu reflektieren und Teamprozesse oder Supervisionen durch Improvisation zu unterstützen.
- Grundlegende Aspekte
- Quote paper
- Thorsten Wiemann (Author), 2006, Der Klang Sozialer Arbeit: Musikpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213450