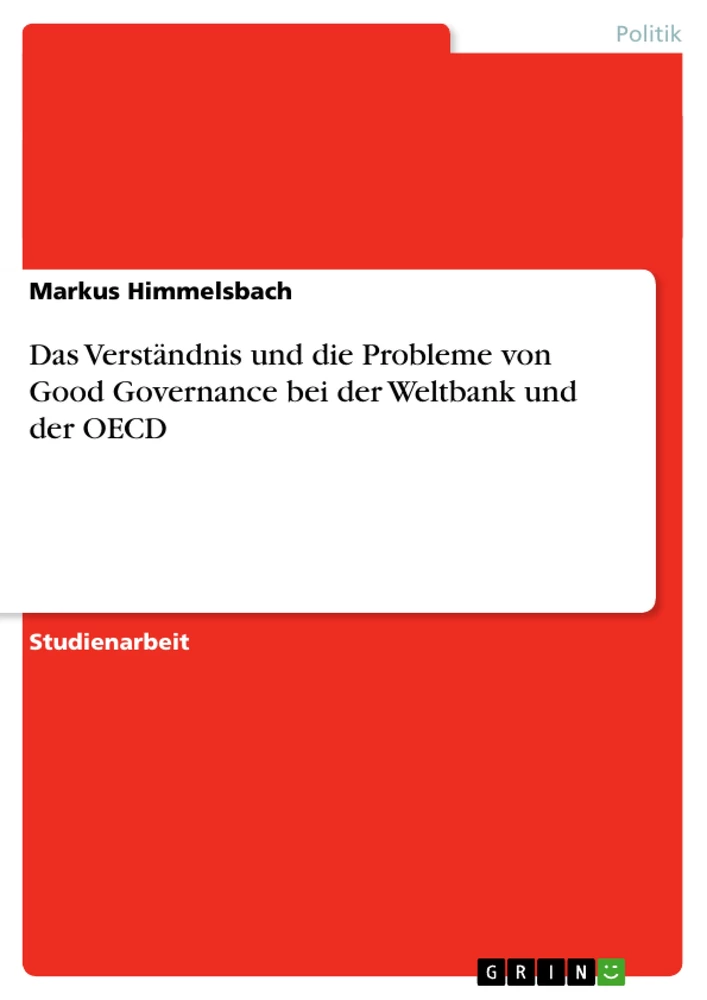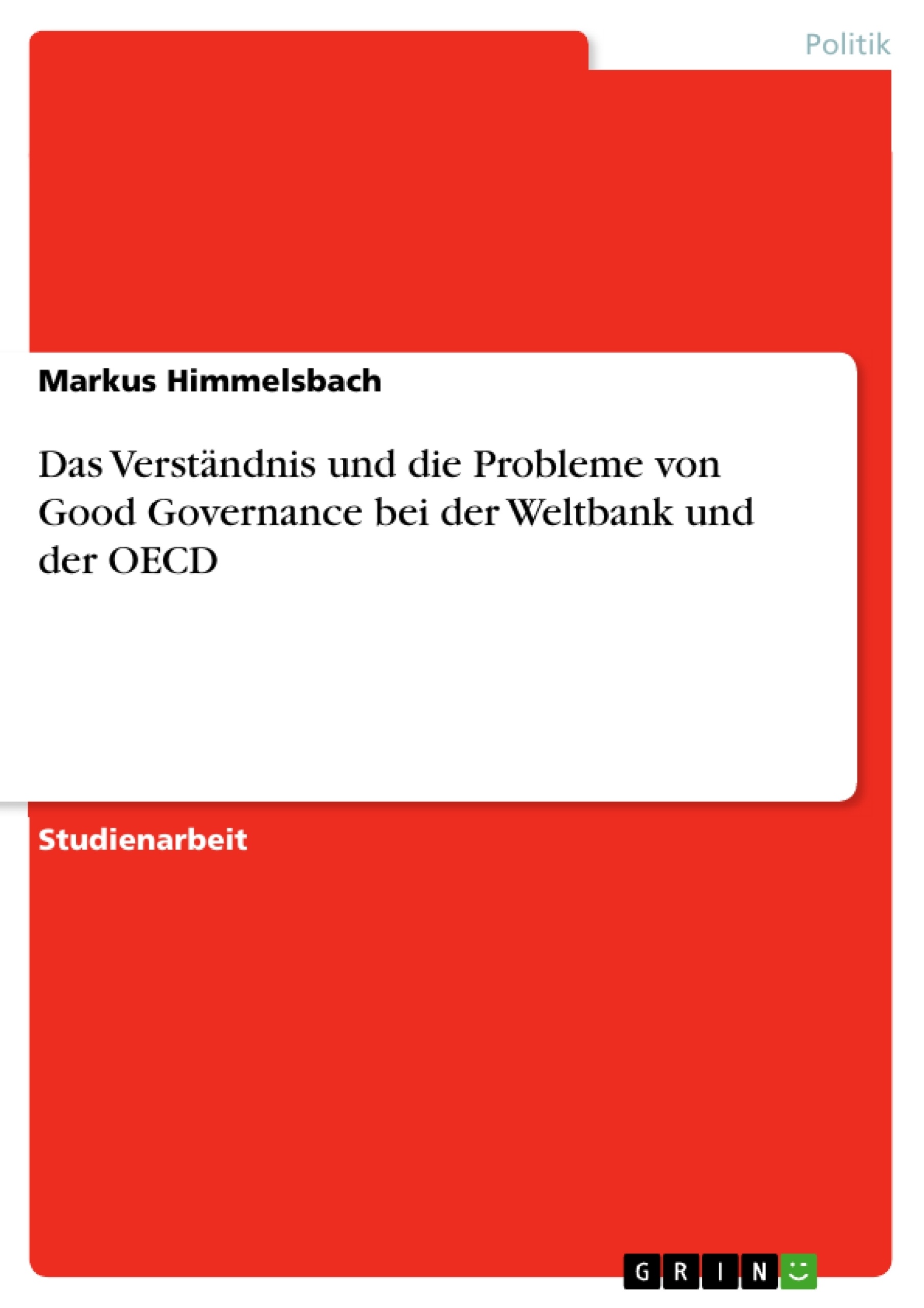Good Governance – ein Begriff der seit nun über 20 Jahren eine wichtige Rolle in der Entwicklungspolitik einnimmt. Kaum eine Erklärung kommt ohne ein Bekenntnis zu Good Governance aus. Organisationen, Institutionen, Wissenschaftler oder auch die Presse verwenden diesen Begriff ständig. Aber was bedeutet eigentlich dieses omnipräsente Schlagwort Good Governance?
Um sich dem Phänomen Good Governance anzunähern, soll im ersten Kapitel eine Begriffsbestimmung vorgenommen. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, woher der Begriff stammt und was er seiner Wortherkunft nach bedeutet. Im Anschluss soll im zweiten Kapitel die Entstehungsgeschichte dieses Begriffes bzw. dieses Konzeptes erläutert werden und wie es überhaupt dazu kam, dass dieses Konzept aufgekommen ist. Die drei folgenden Kapitel befassen sich mit den unterschiedlichen Auffassungen von Good Governance. Hier soll zum einen das Verständnis der Weltbank, die den Begriff initiierte, dargestellt werden. Da dieses Verständnis nicht ohne Kritik auskommt, soll ein anderes, normativ geprägtes, Verständnis vorgestellt werden. Dazu wird das Konzept des Development Assistance Committee (DAC) der Organisation for Economic Development and Coorparation (OECD) vorgestellt. Die beiden unterschiedlichen Auffassungen sollen darauf gegenüber gestellt und auf Gemeinsamkeiten eingegangen werden. Dabei soll noch kurz die Konzeption des Internationalen Währungsfonds (IWF) zum Vergleich hinzugezogen werden.
Es gibt aber nicht nur Kritik am Konzept der Weltbank. Das Konzept der OECD ist auch nicht kritikfrei. Daher soll im fünften Kapitel auf diese und auch auf allgemeine Kritik zu Good Governance eingegangen werden.
In der Schlussbetrachtung soll dann darauf eingegangen werden, was Good Governance letzten Endes in einem heutigen, vorwiegend normativ geprägten Verständnis, ausmacht und was man dabei beachten sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Begriffsbestimmung
- Einleitung
- Aufkommen von Good Governance
- Die Weltbank als Initiator
- Krise der Wirtschaft und des Staates
- Good Governance im engeren Sinn
- Good Governance-Konzept der Weltbank
- Kritik am Weltbank-Konzept
- Good Governance im weiteren Sinn
- Good Governance-Konzept des DAC
- Vergleich der Konzepte
- Good Governance - ein Konzept ohne Probleme?
- Lässt sich Good Governance messen?
- Good Governance und fragile Staaten
- Reformprozesse anstreben und umsetzen
- Der Good Governance-Kolonialismus
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept von Good Governance und dessen Bedeutung in der Entwicklungspolitik. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung des Begriffs sowie die unterschiedlichen Konzepte und Kritikpunkte, die mit ihm verbunden sind. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von Good Governance zu vermitteln und dessen Relevanz für die heutige Entwicklungspolitik zu beleuchten.
- Die Entstehung und Entwicklung des Good Governance-Konzepts
- Die unterschiedlichen Konzepte von Good Governance, insbesondere die der Weltbank und der OECD
- Die Kritikpunkte am Good Governance-Konzept
- Die Anwendung von Good Governance in der Praxis und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben
- Die Bedeutung von Good Governance für die Entwicklung von Staaten und Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs Good Governance und untersucht dessen historische Entstehung. Dabei werden die Weltbank als Initiator des Konzeptes sowie die Gründe für dessen Aufkommen im Kontext der Wirtschafts- und Staatskrise der 1970er und 1980er Jahre beleuchtet. Die Arbeit analysiert dann das Good Governance-Konzept der Weltbank, dessen Kritikpunkte und die Gegenüberstellung mit dem Konzept des Development Assistance Committee (DAC) der OECD. Darüber hinaus werden die Herausforderungen der Messung von Good Governance und dessen Relevanz für fragile Staaten betrachtet. Abschliessend wird die Anwendung von Good Governance in der Praxis und der Begriff des „Good Governance-Kolonialismus“ diskutiert.
Schlüsselwörter
Good Governance, Entwicklungspolitik, Weltbank, OECD, DAC, Staatsführung, Regierungsführung, Kritik, Messung, fragile Staaten, Kolonialismus
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff Good Governance?
Good Governance steht für "gute Regierungsführung". Es beschreibt ein Konzept in der Entwicklungspolitik, das effiziente staatliche Verwaltung, Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und die Bekämpfung von Korruption als Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung ansieht.
Wer hat das Konzept von Good Governance initiiert?
Die Weltbank gilt als Initiatorin des Begriffs. Sie führte ihn Ende der 1980er Jahre ein, um auf das Scheitern von Entwicklungsprojekten aufgrund schwacher staatlicher Strukturen in vielen Ländern zu reagieren.
Wie unterscheidet sich das Verständnis der Weltbank von dem der OECD?
Die Weltbank verfolgt eher ein ökonomisch-technisches Verständnis (Effizienz der Verwaltung), während die OECD (über das DAC) ein breiteres, normatives Verständnis pflegt, das auch Demokratie, Menschenrechte und Partizipation einschließt.
Was wird am Konzept der Weltbank kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass das Konzept zu technisch ist und politische Aspekte wie Demokratie ausklammert. Zudem wird oft eine Einmischung in die Souveränität von Staaten und die Übertragung westlicher Standards kritisiert.
Was versteht man unter „Good Governance-Kolonialismus“?
Dieser Begriff beschreibt die Kritik, dass westliche Geberländer und Organisationen ihre eigenen Vorstellungen von Staatlichkeit und Werten den Entwicklungsländern aufzwingen, was als neue Form der kolonialen Bevormundung wahrgenommen werden kann.
- Quote paper
- Markus Himmelsbach (Author), 2011, Das Verständnis und die Probleme von Good Governance bei der Weltbank und der OECD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213531