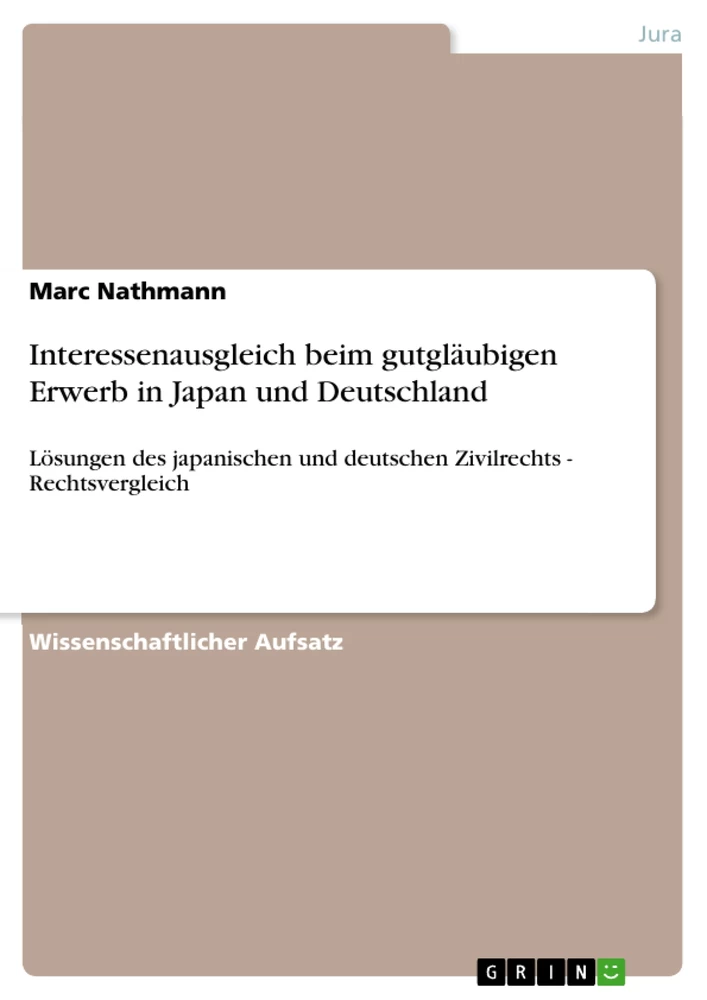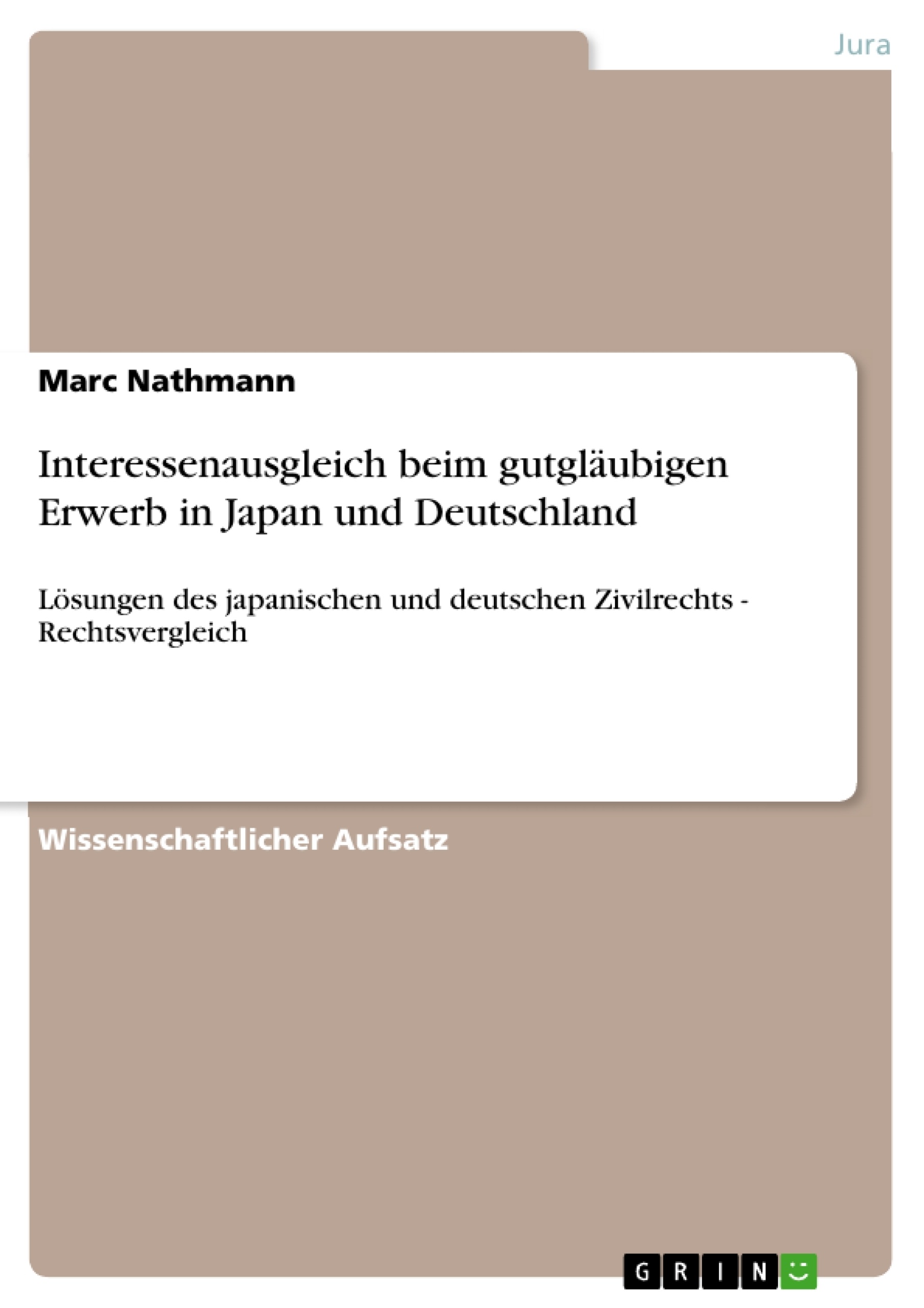Diese Arbeitt beschäftigt sich mit dem Interessenausgleich beim gutgläubigen Erwerb in Japan und Deutschland. Dabei werden die Lösungen des japanischen und deutschen Zivilrechts miteinander verglichen.
Der gutgläubige Erwerb betrifft ein Drei-Personen-Verhältnis: B veräußert eine Sache, die A gehört, an C.
Im Rahmen dieses Vorgangs treten drei unterschiedliche Rechtsbezie-hungen zwischen den Beteiligten auf. Zwischen B und C soll Eigentum übertragen werden. Im Verhältnis zwischen A und B hat B in eine Rechtsposition des A eingegriffen, ohne dass er dazu berechtigt gewesen ist. Das Eigentum an einer Sache kann schließlich nur einmal vergeben werden. Deshalb stellt sich die Frage, wem das Eigentum zustehen soll und wie der Verlust oder Nichterwerb des Eigentums ausgeglichen wird.
Betrachtet wird zunächst die Funktionsweise des gutgläubigen Erwerbs in Japan, um sodann die Lösung des Interessenkonflikts nach japanischem Recht zu betrachten. Danach werden dem die Lösungen nach deutschem Recht gegenüber gestellt, um im Anschluss die Lösungen beider Rechtsordnungen miteinander zu vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Probleme
- Situation im japanischen Recht
- Allgemeines zum gutgläubigen Erwerb
- Zuweisung des Eigentums
- Bewegliche Sachen
- Besitzkonstitut
- Gestohlene und abhanden gekommene Sachen
- Allgemeines
- Öffentliche Versteigerung bei gestohlenen Sachen
- Kraftfahrzeuge
- Bei Immobilien
- Allgemeines
- Interessenlage
- Doppelverkauf
- Entschädigung für den Rechtsverlust
- Situation in Deutschland
- Allgemeines
- Zuweisung des Eigentums
- Grundlagen
- Einschränkung der Rechtsprechung bei Kfz
- Schutz bei Diebstahl und Abhandenkommen
- Allgemeines
- Schranken des Gutglaubensschutzes
- Geldtransfer
- Öffentliche Versteigerung
- Besitzkonstitut
- Immobilien
- Entschädigung für den Rechtsverlust
- Vergleich zwischen Deutschland und Japan — Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Monographien und Sammelbände
- Urteilssammlungen und Zeitschriften
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Interessenausgleich beim gutgläubigen Erwerb in Japan und Deutschland. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die unterschiedlichen Lösungsansätze beider Rechtsordnungen im Hinblick auf den Schutz des gutgläubigen Erwerbers und die Interessen des ursprünglichen Eigentümers. Im Fokus stehen die rechtlichen Regelungen für die Übertragung von Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen, insbesondere im Kontext von gestohlenen oder abhanden gekommenen Gegenständen.
- Der Interessenausgleich beim gutgläubigen Erwerb
- Die Rolle des Rechtsscheins und des Veranlasserprinzips
- Die Bedeutung des Verkehrsschutzes und des Eigentumserhaltungsinteresses
- Die Unterschiede in der Rechtsprechung und Rechtskultur zwischen Japan und Deutschland
- Die Entschädigung für den Rechtsverlust
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problematik des gutgläubigen Erwerbs, wobei die drei beteiligten Rechtsbeziehungen zwischen dem ursprünglichen Eigentümer, dem Veräußerer und dem Erwerber erläutert werden. Anschließend wird die Situation im japanischen Recht beleuchtet, wobei die rechtliche Grundlage des gutgläubigen Erwerbs in 192 JBGB dargestellt wird. Hierbei wird die Bedeutung des Besitzes, des Rechtsscheins und des guten Glaubens hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Zuweisung des Eigentums an bewegliche Sachen, dem Besitzkonstitut und dem Schutz des Erwerbers bei gestohlenen oder abhanden gekommenen Sachen. Die Arbeit analysiert die historischen Grundlagen und die Entwicklung des gutgläubigen Erwerbs im japanischen Recht, wobei die Bedeutung des Verkehrsschutzes und der Zurechenbarkeit im Vordergrund stehen. Im Anschluss werden die Besonderheiten des gutgläubigen Erwerbs bei Kraftfahrzeugen und bei Immobilien erläutert. Abschließend wird die Entschädigung für den Rechtsverlust im japanischen Recht beleuchtet.
Im nächsten Kapitel wird die Situation in Deutschland betrachtet. Hierbei wird die rechtliche Grundlage des gutgläubigen Erwerbs in 929 BGB dargestellt, wobei die Bedeutung der dinglichen Einigung und der Besitzverschaffung im Vordergrund stehen. Die Arbeit analysiert die Zuweisung des Eigentums in Deutschland, wobei die Bedeutung des Rechtsscheins und des Veranlasserprinzips hervorgehoben werden. Der Fokus liegt auf der Einschränkung der Rechtsprechung bei Kraftfahrzeugen und dem Schutz des Erwerbers bei gestohlenen oder abhanden gekommenen Sachen. Die Arbeit beleuchtet die Schranken des Gutglaubensschutzes, insbesondere im Kontext von Geldtransfer und öffentlichen Versteigerungen. Abschließend wird die Entschädigung für den Rechtsverlust im deutschen Recht betrachtet.
Im letzten Kapitel wird ein Vergleich zwischen Deutschland und Japan gezogen, wobei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Rechtsordnungen und den jeweiligen Lösungsansätzen im Hinblick auf den gutgläubigen Erwerb herausgestellt werden. Die Arbeit analysiert die unterschiedliche Gewichtung des Verkehrsschutzes und des Eigentumserhaltungsinteresses in beiden Rechtsordnungen und zeigt die Auswirkungen auf die Rechtsprechung im Kontext von gestohlenen oder abhanden gekommenen Sachen. Abschließend wird der unterschiedliche Umgang mit dem Entschädigungsanspruch im Falle des Rechtsverlustes beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den gutgläubigen Erwerb, den Interessenausgleich, den Rechtsschein, das Veranlasserprinzip, den Verkehrsschutz, das Eigentumserhaltungsinteresse, den Besitz, die Zurechenbarkeit, die Entschädigung für den Rechtsverlust, das japanische Bürgerliche Gesetzbuch (JBGB) und das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Regelungen und die unterschiedlichen Lösungsansätze in Japan und Deutschland im Kontext des gutgläubigen Erwerbs von beweglichen und unbeweglichen Sachen, insbesondere bei gestohlenen oder abhanden gekommenen Gegenständen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der gutgläubige Erwerb?
Er ermöglicht es einem Käufer, Eigentum an einer Sache zu erwerben, selbst wenn der Verkäufer nicht der wahre Eigentümer war, sofern der Käufer "gutgläubig" handelte (nichts vom fehlenden Eigentum wusste).
Wie unterscheidet sich das japanische vom deutschen Recht beim Diebstahl?
Während in Deutschland an gestohlenen Sachen kein gutgläubiger Erwerb möglich ist (§ 935 BGB), kennt das japanische Recht Ausnahmen, z. B. bei öffentlichen Versteigerungen, wo der Erwerber besser geschützt ist.
Was besagt das Veranlasserprinzip?
Es ist ein Grundsatz, wonach derjenige, der den Rechtsschein des Eigentums (z. B. durch freiwillige Übergabe der Sache an einen Dritten) veranlasst hat, das Risiko eines unbefugten Weiterverkaufs tragen muss.
Gibt es Unterschiede beim gutgläubigen Erwerb von Immobilien?
Ja, die Arbeit vergleicht die Bedeutung des Grundbuchs in Deutschland mit der japanischen Praxis und untersucht, wie der Vertrauensschutz bei unbeweglichen Sachen jeweils ausgestaltet ist.
Wie wird der Rechtsverlust des ursprünglichen Eigentümers ausgeglichen?
Sowohl das deutsche als auch das japanische Recht sehen Entschädigungsansprüche gegen den unberechtigten Veräußerer vor, wobei die Durchsetzbarkeit und Höhe dieser Ansprüche variieren kann.
- Arbeit zitieren
- Marc Nathmann (Autor:in), 2011, Interessenausgleich beim gutgläubigen Erwerb in Japan und Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213592