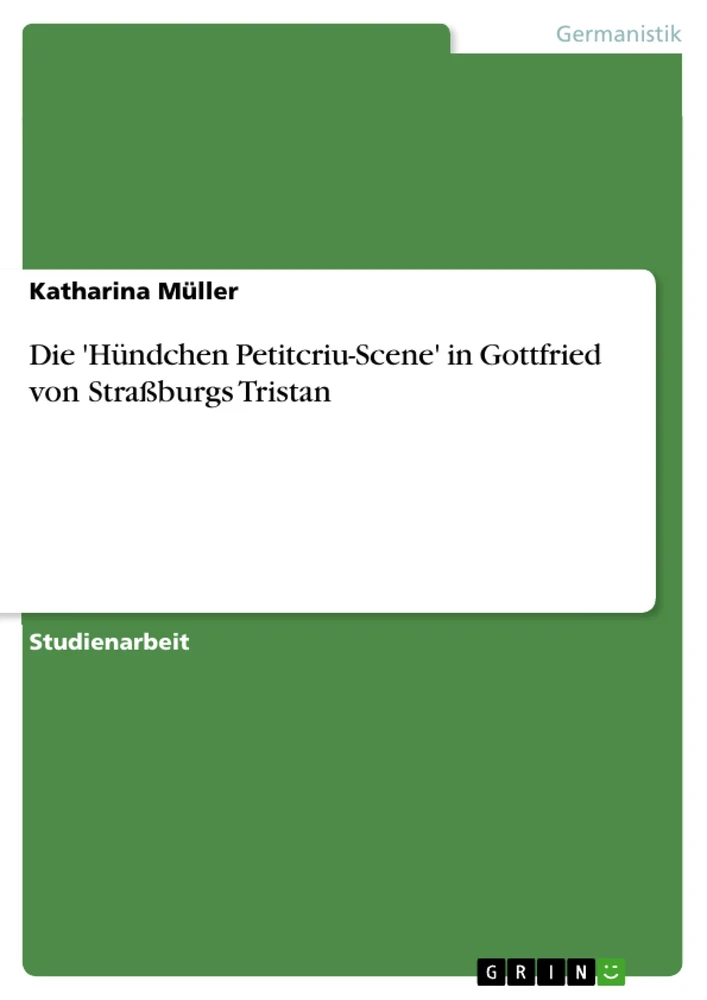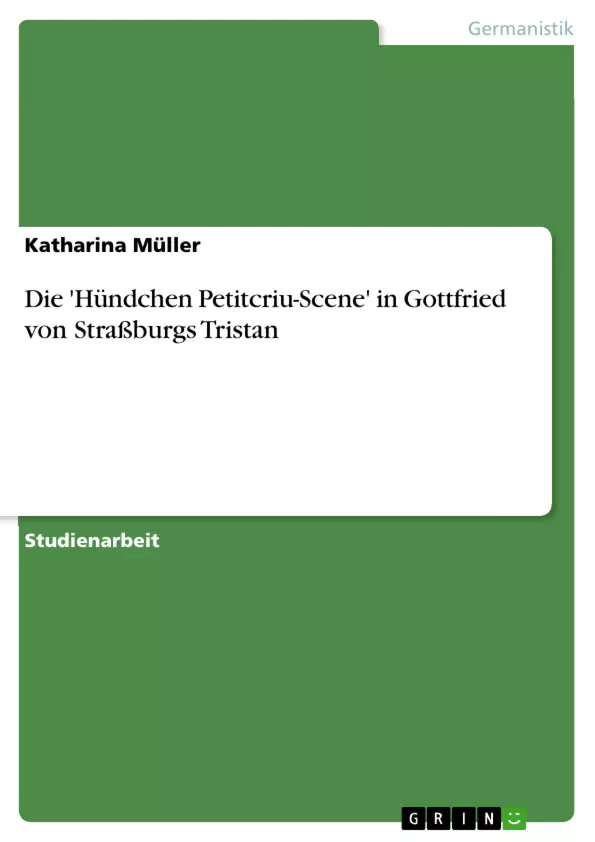swem nie von liebe leit geschach, dem geschach ouch liep von liebe nie. Liep unde leit diu wâren ie an minnen ungescheiden. Mit diesen Worten beschreibt Gott-fried von Straßburg im Prolog seines Werks Tristan die enge Verknüpfung zwi-schen minne und Leid und charakterisiert somit passend den Ausgang der Petit-criu-Szene. Das Zauberhündchen Petitcriu – eine Liebesgabe, welche ausschwei-fend beschrieben wird und doch unbeschreiblich bleibt. Ein Hündchen, welches in seiner ursprünglichen Funktion, nämlich von Leid zu befreien, das Liebesband zwischen den Liebenden zerreißen soll, auch wenn dies aus selbstloser Liebe des Schenkenden Tristan geschieht, der seine Geliebte Isolde vom Liebesschmerz befreien will. Doch die Empfängerin Isolde entscheidet sich gegen die schmerz-stillende Wirkung, die das Hündchen auf sie haben könnte und somit für das Leid der minne wegen.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich zunächst mit der Beantwortung der Frage was eine Liebesgabe ist. Ludger Liebs Aufsatz „Kann denn Schenken Sünde sein?“ und ein kurzer Einblick in die Studien des „Urvaters“ der Liebesgabentheo-rien Marcell Mauss bilden die Grundlagen dieser Überlegungen. Daraufhin wird der Hund als Liebesgabe in der Literatur untersucht und kurz einige Beispiele vorgestellt. Das Hündchen Petitcriu aus Gottfrieds von Straßburg Tristan bildet das zentrale Thema dieser Hausarbeit. Inwieweit Petitcriu die Kriterien einer Lie-besgabe erfüllt und ob es tatsächlich den Inbegriff einer Liebesgabe darstellt wird im Fazit herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist eine Liebesgabe?
- Der Hund als Liebesgabe in der Literatur
- Das Hündchen Petitcriu in Gottfrieds von Straßburg Tristan
- Inwieweit erfüllt Petitcriu die Kriterien einer Liebesgabe?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Funktion und Bedeutung der Liebesgabe im Kontext von Gottfrieds von Straßburg Tristan, wobei das Hündchen Petitcriu im Zentrum der Betrachtung steht. Im Fokus stehen die Kriterien einer Liebesgabe im mittelalterlichen Kontext, die Rolle des Hundes als Symbol und die Frage, ob Petitcriu tatsächlich als Inbegriff einer Liebesgabe betrachtet werden kann.
- Definition und Kriterien einer Liebesgabe
- Der Hund als Liebesgabe in der Literatur
- Die Rolle des Hündchens Petitcriu in Tristan
- Die Frage nach der Erfüllung der Kriterien einer Liebesgabe durch Petitcriu
- Die Bedeutung des Hündchens für die Beziehung zwischen Tristan und Isolde
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die enge Verknüpfung zwischen Liebe und Leid anhand von Gottfrieds von Straßburg Tristan und führt in das Thema der Liebesgabe ein. Kapitel 2 untersucht die Definition der Liebesgabe im Kontext von Mauss und Lieb und stellt die Kriterien dar, die ein Geschenk als Liebesgabe qualifizieren. Kapitel 3 widmet sich dem Hund als Liebesgabe in der Literatur und zeigt anhand verschiedener Beispiele, wie Hunde als Ausdruck von Zuneigung, Erinnerung oder Statussymbol fungierten. Das Hündchen Petitcriu, das im Zentrum dieser Arbeit steht, wird in Kapitel 3.1 vorgestellt. Die Episode über Petitcriu in Gottfrieds von Straßburg Tristan wird analysiert und seine besondere Bedeutung für die Beziehung zwischen Tristan und Isolde hervorgehoben. Kapitel 3.2 beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Petitcriu die Kriterien einer Liebesgabe erfüllt.
Schlüsselwörter
Liebesgabe, Tristan, Isolde, Petitcriu, Gottfried von Straßburg, mittelalterliche Literatur, Gabenprozesse, symbolische Zeichen, metonymische Zeichen, Hund als Liebesgabe, Liebeskummer, Erinnerung, Statussymbol
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Zauberhündchen Petitcriu?
Petitcriu ist eine Liebesgabe in Gottfried von Straßburgs „Tristan“. Es ist ein magisches Hündchen, das durch sein Glockenspiel jeden Kummer und jedes Leid vertreiben kann.
Warum lehnt Isolde die Wirkung des Hündchens ab?
Isolde entscheidet sich gegen die schmerzstillende Wirkung, weil sie das Leid der Liebe (Minne) mit Tristan teilen will, anstatt ohne Schmerz, aber innerlich getrennt von ihm zu sein.
Was definiert eine „Liebesgabe“ in der mittelalterlichen Literatur?
Eine Liebesgabe ist ein symbolisches Objekt, das eine Bindung zwischen Liebenden herstellt oder bestätigt und oft metonymisch für den Schenkenden steht.
Welche Symbolik hat der Hund in diesem Kontext?
Hunde stehen in der Literatur oft für Treue, Erinnerung oder als Statussymbol. Petitcriu ist jedoch durch seine Zauberkraft und seine unbeschreibliche Schönheit ein besonderes Zeichen der Minne.
Wer ist der „Urvater“ der Gabentheorie?
Die Arbeit bezieht sich auf die Studien von Marcel Mauss, der grundlegende Theorien zum Schenken und zu Gabenprozessen in Gesellschaften entwickelte.
- Quote paper
- Katharina Müller (Author), 2012, Die 'Hündchen Petitcriu-Scene' in Gottfried von Straßburgs Tristan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213685