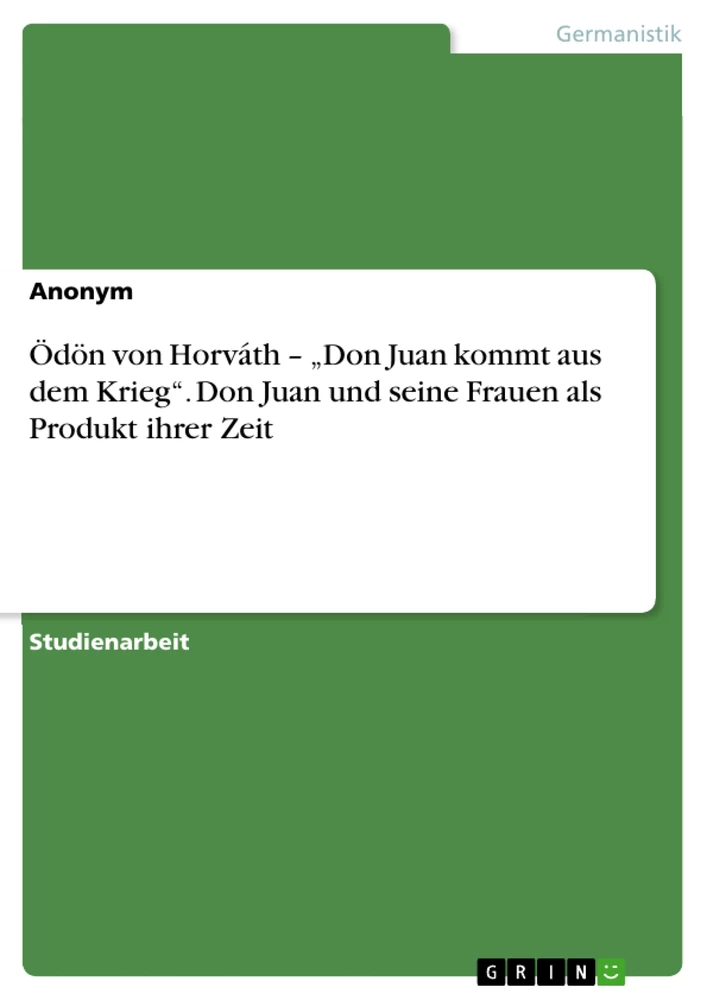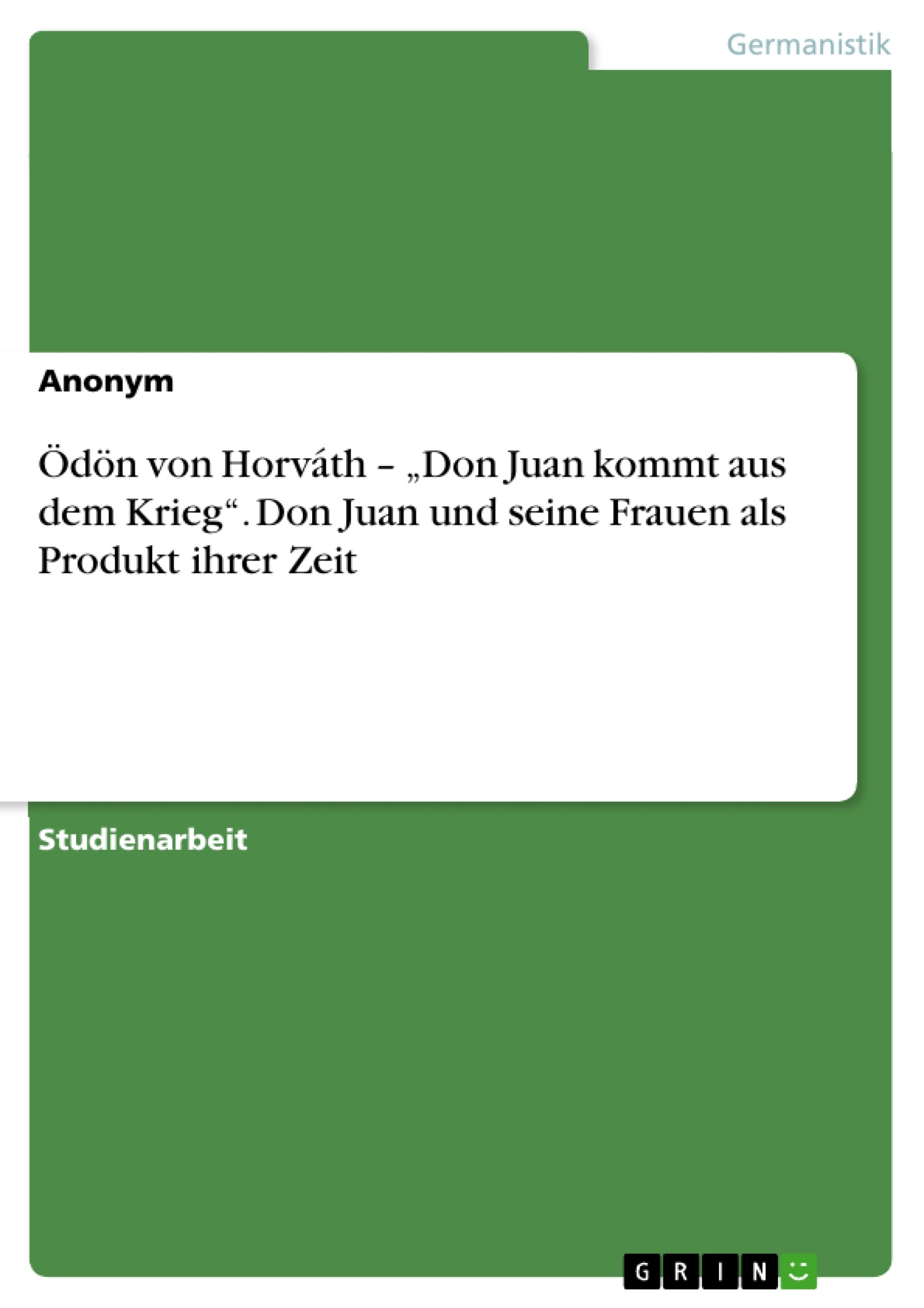Einleitung
In meiner Seminararbeit möchte ich mich dem Schauspiel „Don Juan kommt aus dem Krieg“ von Ödön von Horváth aus dem Jahre 1936 widmen, das sich dem Sujet des „Don Juan Mythos“ zuwendet. Erstmals bei Tirso de Molina und dem „El Burlador de Sevilla y convidado de piedra“ aus dem Jahre 1613 hat sich die Figur des Don Juans über Jahrhunderte weiter entwickelt und unzähligen Interpretationen gebeugt.
Bei Horváth lernen wir einen erschöpften Don Juan kennen, der gerade vom Krieg nach Hause zurück gekehrt ist und sich auf die Suche nach seiner Braut, seinem Ideal, macht. Auf diesem Weg trifft er auf verschiedene Frauen und muss erkennen, dass sich diese in der Zeit des Krieges verändert haben. Im ersten Abschnitt meiner Seminararbeit sollen kurz die äußeren Folgen beschrieben werden, die ein Krieg, speziell der Erste Weltkrieg, mit sich gebracht hat. Danach soll anhand von einzelnen Textstellen aufgezeigt werden, inwiefern sich die Frauenfiguren in dem Stück, ihr Selbstbild, ihre Einstellung und ihre Beziehung zum Mann durch das Zeitgeschehen verändert haben. Im Anschluss soll Don Juan ihnen als männlicher Repräsentant gegenüber gestellt werden und ihn in der Zeit der Inflation beschreiben. Obwohl bei Horváth von dem alten Verführer nichts mehr zu erkennen ist, scheint Don Juans Anziehung auf die Damenwelt nicht gänzlich erloschen, denn sie verfallen ihm trotz geläutertem Selbstbild.
Der zweite Teil der Arbeit soll sich mit Don Juans erotischer Präsenz beschäftigen und klären, warum er es dennoch schafft, die Damenwelt von sich zu überzeugen. Wie kann es sein, dass ein Don Juan, der das Interesse an Frauen verloren zu haben scheint, dennoch so eine große Wirkung erzielt? Durch den Krieg und die kurze Zeit danach haben die Frauen gelernt, sich ohne Mann im Leben zurecht zu finden. Dennoch hat jede Einzelne einen anderen Grund, weshalb sie sich nach einem Mann wie Don Juan, sehnen. Durch seinen Ruf als stadtbekannter Verführer, der er aber nicht mehr ist, regt Don Juan die Phantasie der Frauen an. Die einzelnen Sehnsüchte der Frauen und was sie in Don Juan zu finden suchen, soll Schwerpunkt dieser Arbeit sein. Die Damen schaffen sich also ihren Don Juan, der ihnen das Leben erleichtern soll und projizieren ihre Wünsche auf ihn. Dadurch, dass Don Juan ihnen ihre Wünsche aber nicht erfüllen kann, benötigen sie ihn nicht mehr und schaffen ihn wieder ab, was somit das Ende Don Juans bedeutet.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Zeitumstände und Figuren
1.1. Die Folgen des Krieges
1.2. Die Veränderung in der weiblichen Gesellschaft
1.3. Don Juan in der Zeit der Inflation
2. Don Juan und die Frauen
2.1. Ursache und Wirkung Don Juans erotischer Präsenz
2.2. Die Beziehung zwischen Don Juan und seinen Frauen
3. Der Tod und das Ende Don Juans
4. Zusammenfassung
5. Literatur- und Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Horváths Stück „Don Juan kommt aus dem Krieg“?
Das Stück aus dem Jahr 1936 zeigt einen erschöpften Don Juan, der nach dem Ersten Weltkrieg heimkehrt und feststellt, dass sich die Frauen und die Gesellschaft durch den Krieg und die Inflation grundlegend verändert haben.
Wie haben sich die Frauenfiguren im Stück verändert?
Durch den Krieg mussten Frauen lernen, ohne Männer zurechtzukommen. Ihr Selbstbild und ihre Einstellung zum Leben sind härter und selbstständiger geworden, dennoch sehnen sie sich nach der Projektionsfigur Don Juan.
Welche Rolle spielt die Inflation in der Handlung?
Die Inflation dient als Hintergrund für die soziale Instabilität und den moralischen Verfall der Zeit, in der Don Juan als männlicher Repräsentant einer untergehenden Welt agiert.
Warum übt Don Juan trotz seiner Erschöpfung eine Anziehung auf Frauen aus?
Die Frauen projizieren ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte auf Don Juan. Sein Ruf als Verführer regt ihre Phantasie an, obwohl er selbst das Interesse an der Verführung verloren hat.
Wie endet Don Juan in Horváths Interpretation?
Da Don Juan die in ihn gesetzten Erwartungen der Frauen nicht erfüllen kann, wird er von ihnen "abgeschafft", was schließlich zu seinem einsamen Tod führt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Ödön von Horváth – „Don Juan kommt aus dem Krieg“. Don Juan und seine Frauen als Produkt ihrer Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213720