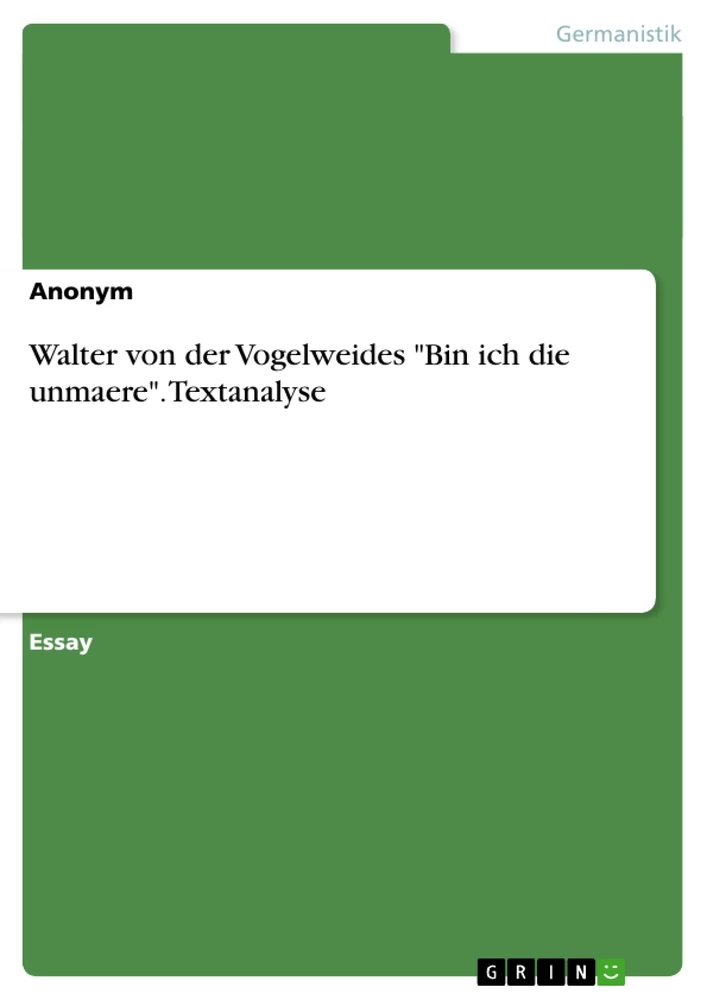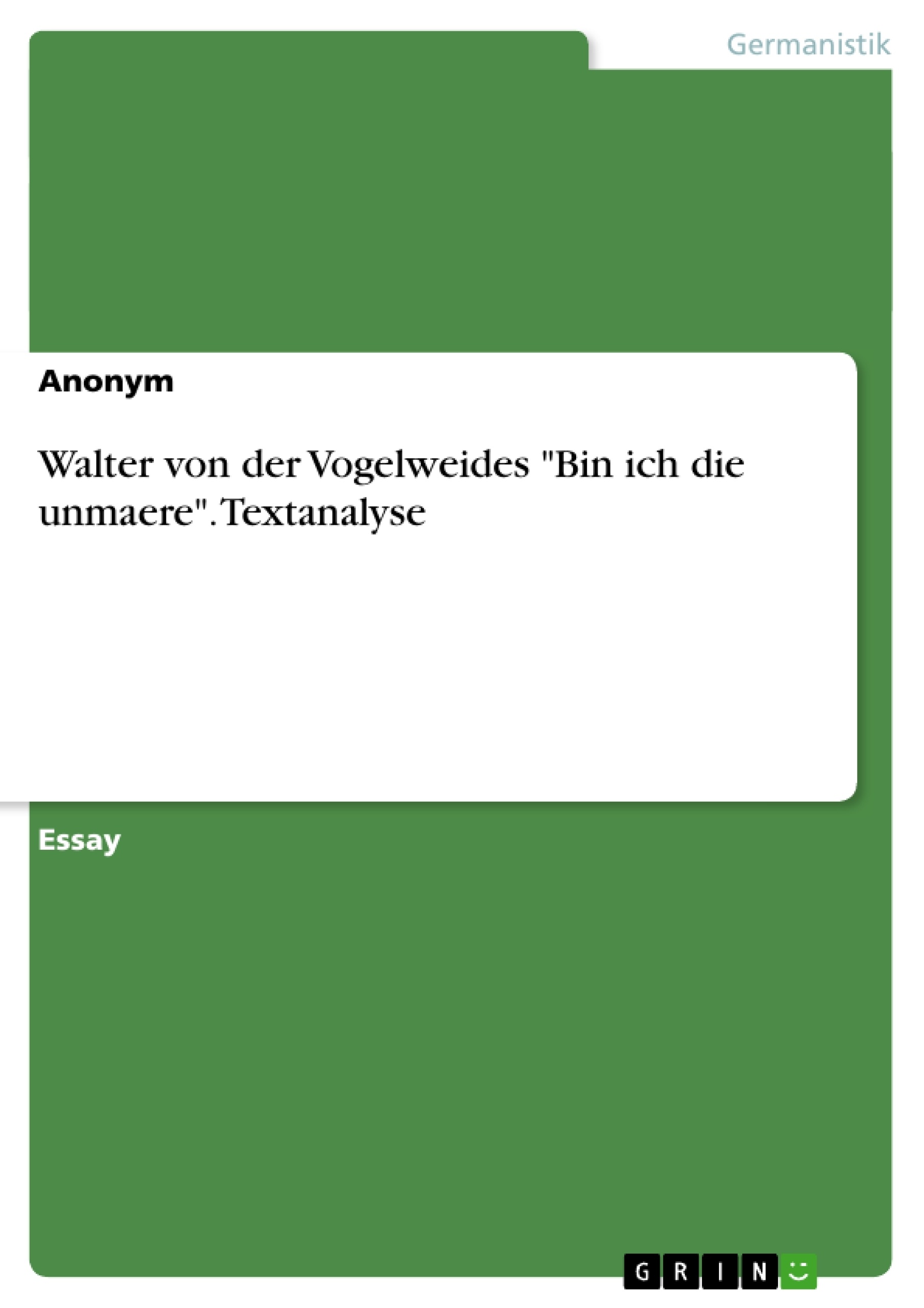Minnelyrik bei Walther von der Vogelweide
Das Werk Walthers von der Vogelweide wird von der heutigen Forschung in recht unterschiedliche Bereiche unterteilt. Zum einen sind das der Minnesang und, mehr oder weniger deutlich von dem Minnesang abgetrennt, die Sangspruchdichtung, die nicht das Minnen um eine Frau zum Thema hat, sondern häufig aktuelle politische Themen zu einer moralischen Anmerkung nutzt. Zum anderen ist dies der Leich, eine weitere Gattung der Lieddichtung des Mittelalters, der bei Walther nur einen sehr geringen Umfang einnimmt und die Marienanbetung, aber auch Kirchen- und Papstkritik zum Thema hat. Eine Unterteilung erfolgt auch bei der Minnelyrik, etwa in die „Hohe Minne“ und die „Niedere Minne“. Diese Einteilung, vor allem jedoch, welche Lieder zu welcher Art von Minne gehören sollen, ist in der Forschung stark umstritten.
Neben der Analyse des Inhalts soll im Folgenden untersucht werden, ob das Lied „ Bin ich dir unmaere“ einer dieser Gattungen zugeordnet werden kann und ob es sich hierbei um eines der sogenannten „Mädchenliedern“ handelt bzw. ob eine solche Einteilung überhaupt vorgenommen werden kann.
Zu „Bin ich dir unmaere“ existieren in vier Handschriften Überlieferungen, die sich in Strophenanzahl und –reihung unterscheiden. Heute wird Hs. C als die vollständigste und korrekteste angesehen, weshalb wir uns in dieser Analyse auf diese beziehen werden.
Eigene Übertragung – Bin ich dir unmaere
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Minnelyrik bei Walther von der Vogelweide
Das Werk Walthers von der Vogelweide wird von der heutigen Forschung in recht unterschiedliche Bereiche unterteilt. Zum einen sind das der Minnesang und, mehr oder weniger deutlich von dem Minnesang abgetrennt, die Sangspruchdichtung, die nicht das Minnen um eine Frau zum Thema hat, sondern häufig aktuelle politische Themen zu einer moralischen Anmerkung nutzt. Zum anderen ist dies der Leich, eine weitere Gattung der Lieddichtung des Mittelalters, der bei Walther nur einen sehr geringen Umfang einnimmt und die Marienanbetung, aber auch Kirchen- und Papstkritik zum Thema hat. Eine Unterteilung erfolgt auch bei der Minnelyrik, etwa in die „Hohe Minne“ und die „Niedere Minne“. Diese Einteilung, vor allem jedoch, welche Lieder zu welcher Art von Minne gehören sollen, ist in der Forschung stark umstritten.
Neben der Analyse des Inhalts soll im Folgenden untersucht werden, ob das Lied „ Bin ich dir unmaere“ einer dieser Gattungen zugeordnet werden kann und ob es sich hierbei um eines der sogenannten „Mädchenliedern“ handelt bzw. ob eine solche Einteilung überhaupt vorgenommen werden kann.
Zu „Bin ich dir unmaere“ existieren in vier Handschriften Überlieferungen, die sich in Strophenanzahl und –reihung unterscheiden. Heute wird Hs. C als die vollständigste und korrekteste angesehen, weshalb wir uns in dieser Analyse auf diese beziehen werden.
Interpretation
„Bin ich dir unmaere“ beginnt mit ebendieser Kernfrage und einer Liebeserklärung des lyrischen Ichs an seine Angebetete. Der Sänger macht sich Sorgen, dass seine Auserwählte ihn für unwichtig hält, da diese ihn missachtet bei jedem Aufeinandertreffen, was den Sänger tief betrübt. So wie er an ihren Gefühlen zu sich zweifelt, ist er sich seinen eigenen Gefühlen sicher und geht direkt in die Offensive indem er ihr seine Liebe gesteht. Für ihn macht es den Anschein, dass sie ihn wahrnimmt, ihn ansieht, aber dennoch durch ihn hin durchsieht und ihn dadurch ignoriert. Er fordert sie auf, dies zu unterlassen, denn für ihn ist das zu schwer zu ertragen. Er wendet sich mit der Bitte um Hilfe an das Mädchen, die für ihn in dieser Situation als Retterin fungieren kann, denn nur durch ihre Liebe kann er wieder glücklich und unbeschwert sein.
Die zweite Strophe beginnt, indem das lyrische Ich die Dame direkt anspricht und ihr eine Frage stellt. In dieser Frage ist indirekte Kritik des Sängers gegenüber seiner Angebeteten versteckt, denn er bemängelt, dass sie ihn nicht so oft ansieht, wie er sich wünschen würde und möchte deshalb nun den Grund dafür erfahren. Sollte der Grund dafür „goute“ sein, verzeiht er der Frau und bestraft sie nicht. Hier könnte man meinen, dass die beiden keine gleichberechtigte Beziehung zueinander führen. Der Mann übernimmt den dominanten Teil, indem er über Strafe oder Vergebung entscheidet. Die Frau hat seine Entscheidung zu akzeptieren. Daraufhin erlaubt er der Dame ihm das Haupt zu neigen, also sich ihm zu verbeugen, um auf seine Füße zu schauen. Der Verliebte nimmt hier deutlich den aktiven Teil ein und versucht den Ablauf ihres Zusammenseins zu bestimmen. Die Erlaubnis zur Verbeugung macht aus der heutigen Sicht einen demütigenden Eindruck. Der Blick nach unten wirkt etwas unterwürfig, da er sie nicht auffordert ihm in die Augen zu gucken, sondern er ihren Blickt nach unten lenkt. Die Forderung der Verbeugung scheint ein Liebesbeweis zu sein, den der Sänger von ihr fordert. Er wirkt unsicher und kann ihre Schüchternheit nicht verstehen und möchte sich nun Klarheit verschaffen. Diese Klarheit wünscht er sich durch eine Verbeugung, die für ihn als Indiz ihrer Liebe ihm gegenüber erscheint. Der letzte Vers entschärft diese Dominanz aber wieder etwas, indem er der Dame ihre Handlung zum Gruße freistellt. Sie kann sich entscheiden, wie sie ihn grüßen möchte, hat sie keinen anderen Wunsche schlägt er diese Form des Grußes vor.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Liedes „Bin ich dir unmaere“?
Es thematisiert die Sorge eines Sängers, von seiner Angebeteten missachtet oder ignoriert zu werden, und seine Bitte um Beachtung und Liebe.
Gehört das Lied zur „Hohen Minne“ oder „Niederen Minne“?
Die Einordnung ist umstritten. Während die direkte Ansprache und die Forderung nach einem Gruß Elemente der „Niederen Minne“ (Mädchenlieder) enthalten, finden sich auch Züge des klassischen Minnesangs.
Welche Handschrift gilt als wichtigste Quelle für dieses Werk?
Die Handschrift C (Manessische Liederhandschrift) wird heute als die vollständigste und korrekteste Überlieferung für dieses Lied angesehen.
Warum fordert der Sänger die Dame auf, das Haupt zu neigen?
Er interpretiert die Verbeugung als einen Liebesbeweis oder Gruß, der ihm Klarheit über ihre Gefühle verschaffen soll, auch wenn dies aus moderner Sicht unterwürfig wirken mag.
Was unterscheidet Walther von der Vogelweide von anderen Minnesängern?
Walther öffnete den Minnesang für neue Formen (wie die „ebene Minne“) und verband ihn mit politischen und moralischen Themen in seiner Sangspruchdichtung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Walter von der Vogelweides "Bin ich die unmaere". Textanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213724