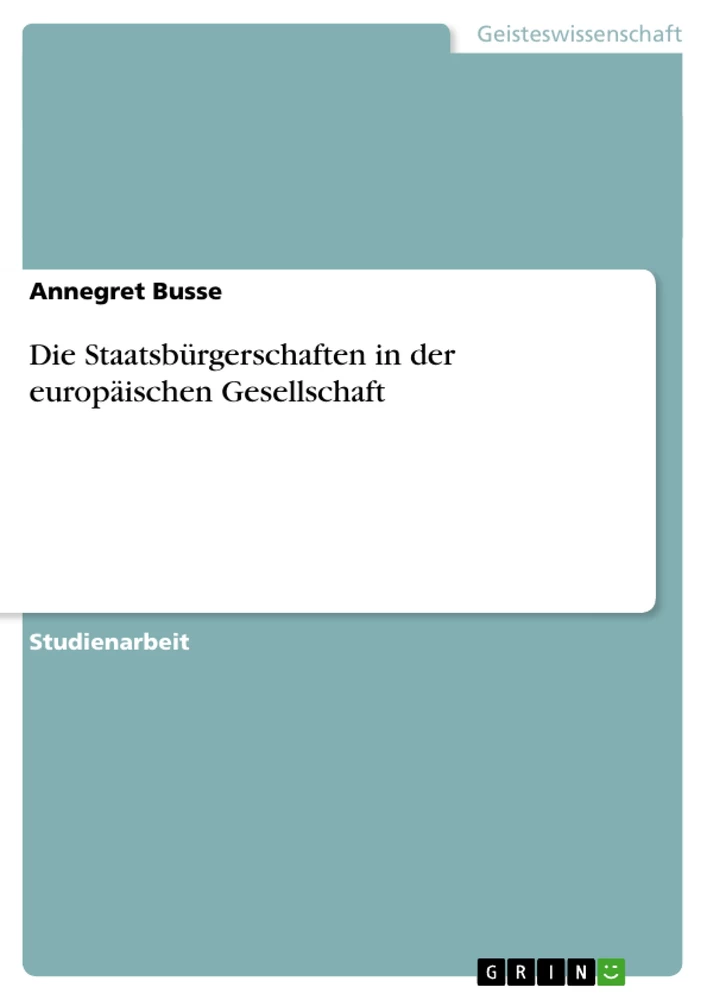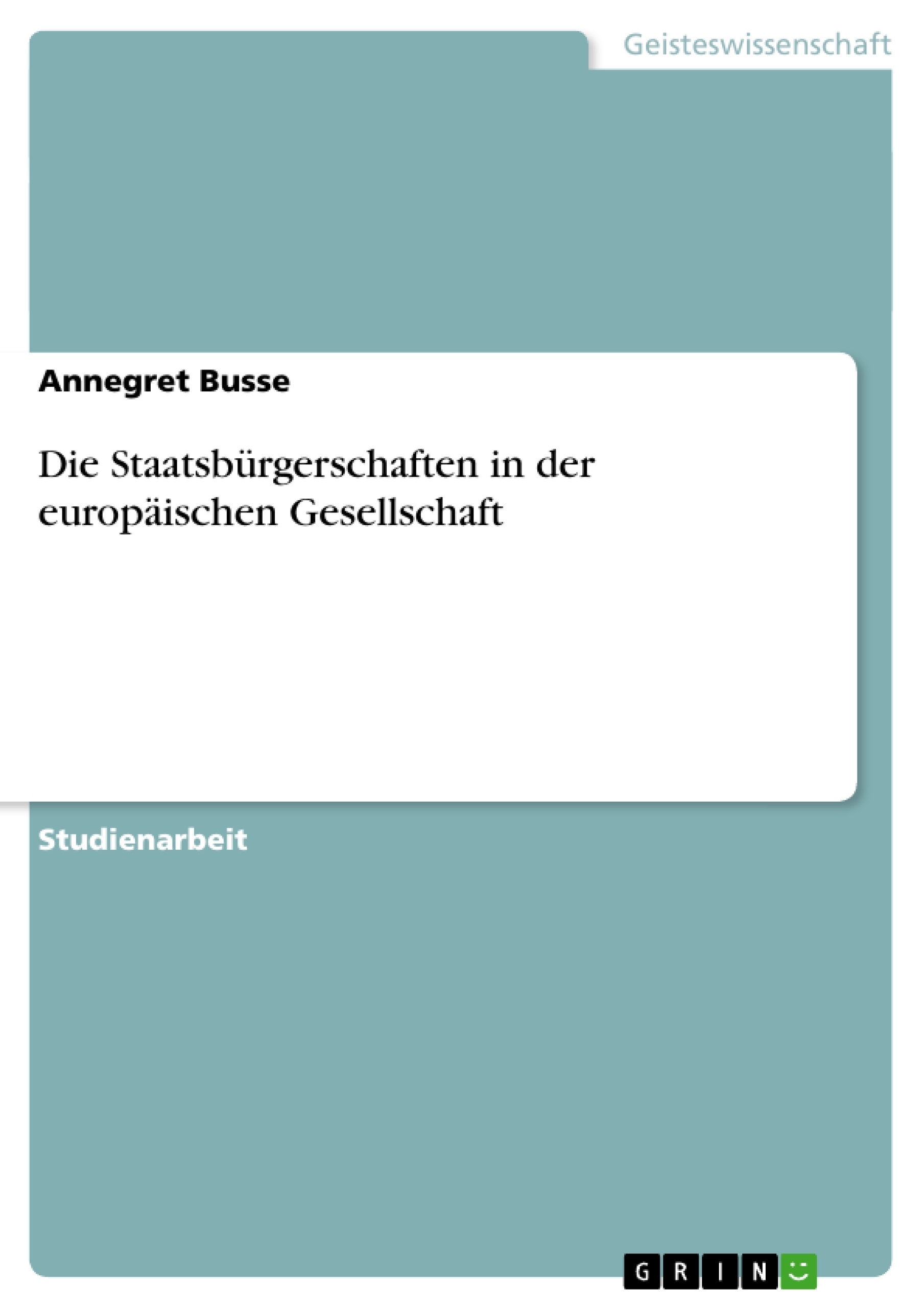Das Problem der Staatsbürgerschaft ist eines der meist diskutierten Themen der europäischen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten. Schon immer ging es um die Frage, inwiefern ein Mensch Mitglied eines Landes ist beziehungsweise sein kann. Vor allem durch die geschichtlichen Ereignisse der zwei Weltkriege beschäftigte man sich intensiver mit dieser Thematik. Die Verhältnisse zwischen den Staaten und den dort lebenden Individuen gaben Anhaltspunkte, welche zu bedenken waren. So führten verschiedenste Entwicklungen auf globaler Ebene nach dem Jahr 1945 zu entscheidenden und prägenden Veränderungen in dem Prinzip der Staatsbürgerschaft.
Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten die Glieder einer Bevölkerung nur Chancen auf Entfaltung in dem Land, in welches sie hineingeboren wurden. Durch ihre Herkunft waren sie von klein auf automatisch diesem jeweiligen Staat zugehörig. Dies wurde durch eine rechtlich anerkannte Staatsbürgerschaft besiegelt, welche Rechte, Privilegien und Pflichten inne hatte. Die weltweiten Neuerungen bewirkten jedoch, dass die herkömmlichen und klassischen Vorstellungen des nationalen Seins eines Individuums einem völlig unbekannten Konzept wichen. Das bedeutet, dass die Staatsbürgerschaft seit der Nachkriegsära einem tiefgehenden und prägenden Wandel unterlag, welcher die Situation komplett veränderte. Die zwei, sonst miteinander verbundenen, Bestandteile der Staatsbürgerschaft, nämlich die Rechte und Identität einer Person, wurden dabei immer mehr getrennt. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Komponenten war demzufolge kein unbedingtes Kriterium mehr.
Diese Feststellung soll in den nachfolgenden Ausführungen bekräftigt werden. Weiterhin werde ich die vier wichtigsten globalen Entwicklungen in der Nachkriegszeit, deren Folgen und weiterführende Prozesse beschreiben. Als letzten Fakt untersuche ich das Modell der Staatsbürgerschaft vor der radikalen Wende und das Konzept, welches sich durch die globalen Ausdehnungen nach 1945 ergeben hat, im Vergleich. Ein kurzes Fazit wird das ganze Themengebiet noch einmal resümieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Nationale Staatsbürgerschaft vor dem Wandel
3. Globale Entwicklungen
3.1 Migrationen
3.2 Entkolonialisierungen
3.3 “ multi – level – politics“
3.4 globale Instrumente
4. Zwischenzeitliche Entwicklungen
5. Folgen
6. Zwei Modelle im Vergleich
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das Problem der Staatsbürgerschaft ist eines der meist diskutierten Themen der europäischen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten. Schon immer ging es um die Frage, inwiefern ein Mensch Mitglied eines Landes ist beziehungsweise sein kann. Vor allem durch die geschichtlichen Ereignisse der zwei Weltkriege beschäftigte man sich intensiver mit dieser Thematik. Die Verhältnisse zwischen den Staaten und den dort lebenden Individuen gaben Anhaltspunkte, welche zu bedenken waren. So führten verschiedenste Entwicklungen auf globaler Ebene nach dem Jahr 1945 zu entscheidenden und prägenden Veränderungen in dem Prinzip der Staatsbürgerschaft.
Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten die Glieder einer Bevölkerung nur Chancen auf Entfaltung in dem Land, in welches sie hineingeboren wurden. Durch ihre Herkunft waren sie von klein auf automatisch diesem jeweiligen Staat zugehörig. Dies wurde durch eine rechtlich anerkannte Staatsbürgerschaft besiegelt, welche Rechte, Privilegien und Pflichten inne hatte. Die weltweiten Neuerungen bewirkten jedoch, dass die herkömmlichen und klassischen Vorstellungen des nationalen Seins eines Individuums einem völlig unbekannten Konzept wichen. Das bedeutet, dass die Staatsbürgerschaft seit der Nachkriegsära einem tiefgehenden und prägenden Wandel unterlag, welcher die Situation komplett veränderte. Die zwei, sonst miteinander verbundenen, Bestandteile der Staatsbürgerschaft, nämlich die Rechte und Identität einer Person, wurden dabei immer mehr getrennt. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Komponenten war demzufolge kein unbedingtes Kriterium mehr.
Diese Feststellung soll in den nachfolgenden Ausführungen bekräftigt werden. Weiterhin werde ich die vier wichtigsten globalen Entwicklungen in der Nachkriegszeit, deren Folgen und weiterführende Prozesse beschreiben. Als letzten Fakt untersuche ich das Modell der Staatsbürgerschaft vor der radikalen Wende und das Konzept, welches sich durch die globalen Ausdehnungen nach 1945 ergeben hat, im Vergleich. Ein kurzes Fazit wird das ganze Themengebiet noch einmal resümieren.
2. Nationale Staatsbürgerschaft vor dem Wandel
Durch die tief greifenden Entwicklungen in der Geschichte und durch den Verlauf des Zweiten Weltkrieges kam es dazu, dass sich die nationale Staatsbürgerschaft in ihrem System komplett veränderte.
Vor diesen historischen Ereignissen war dieser Fakt jedoch nicht der Fall. Man ging bei der nationalen Staatsbürgerschaft davon aus, dass die Bevölkerungen in den einzelnen Ländern, welche durch nationalstaatliche Grenzen gekennzeichnet waren, durch spezifische Regeln organisiert und formiert waren. Diese Regeln und Grundsätze definierten die so genannte „nationale Mitgliedschaft“ als eine rechtsmäßig anerkannte Grundlage der Zugehörigkeit in den modernen Staaten.
Kurz gefasst kann man also sagen, dass eine nationale Staatsbürgerschaft vor dem Zweiten Weltkrieg auf zwei klar feststehenden Prinzipien basierte. Auf der einen Seite beruhte sie auf dem inneren Zusammenhalt des Territorialstaates und der nationalen Gemeinschaft. Auf der anderen Seite stützte sie sich auf die nationale Zugehörigkeit, welche als eine Quelle verschiedener Rechte und Pflichten, aber auch der kollektiven Identität diente. Man definierte die nationale Staatsbürgerschaft als eine Bevölkerung, welche gemeinsam in einem abgegrenzten Gebiet lebte. Diese dort beheimateten Menschen besaßen jeweils eine Anzahl bestimmter Rechte und Pflichten, durch die es ihnen möglich war, zu leben, zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen. Andere Individuen, welche dem Staat nicht angehörten, schloss man auf dieser Grundlage aus. Demnach besaßen sie auch keinerlei Rechte und Pflichten dieses Landes.
3. Globale Entwicklungen
Aufgrund der geschichtlichen Entwicklungen kam es jedoch in der Nachkriegszeit zu entscheidenden und grundlegenden Veränderungen in Europa. Dieser Wandel stellte das, bis jetzt vorherrschende, Prinzip der nationalen Staatsbürgerschaft komplett in Frage. So trugen diese Ereignisse dazu bei, dass es zu einer wichtigen Ausweitung der Mitgliedschaft und Zugehörigkeit kam, das heißt, man ging von nun an über die nationalen Begrenzungen und Territorien hinaus. Aus dem historischen Kontext lassen sich vier globale Entwicklungen herausfiltern, die vor allem herausragend für die gesamte Situation waren.
3.1 Migrationen
Die erste wichtige Entwicklung stellte die Migration dar, das heißt die Arbeitsmärkte wurden internationalisiert. Von nun an konnte man Arbeit auf der ganzen Welt suchen. Daraus resultierten die Migrationsbewegungen, in welchen die Menschen ihre Heimat verließen, um in einem anderen Land Zukunftsperspektiven zu finden. Die Auswanderungen verliefen nach Europa. Die Menschenmassen stammten aus entfernten Ländern, wie zum Beispiel Amerika, oder sie bewegten sich innerhalb der europäischen Länder. Aus diesem Prozess folgte, dass die ethnische und nationale Zusammensetzung in den einzelnen Ländern Europas wesentlicher vielschichtiger und kulturell komplexer wurde. Die Anzahl der Länder, mit ihren verschiedenen Variationen und Kombinationsmöglichkeiten, wuchsen im Laufe der Nachkriegszeit unglaublich stark an. Dadurch kam es dazu, dass man jegliche politische und geographische Entfernungen und Verhältnisse in Frage stellte. Es war also von diesem Moment an egal, ob sich zum Beispiel Chinesen in Rumänien aufhielten beziehungsweise lebten.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie definierte sich die Staatsbürgerschaft vor dem Zweiten Weltkrieg?
Vor 1945 basierte Staatsbürgerschaft primär auf der Herkunft (Geburtsortprinzip) und war eng an einen abgegrenzten Territorialstaat geknüpft, der Rechte und Identität untrennbar vereinte.
Welcher fundamentale Wandel vollzog sich in der Nachkriegsära?
Die enge Verbindung zwischen individuellen Rechten und nationaler Identität löste sich zunehmend auf. Rechte sind heute weniger an die nationale Zugehörigkeit als an globale Standards gekoppelt.
Welche globalen Entwicklungen beeinflussten die Staatsbürgerschaft nach 1945?
Vier Hauptfaktoren werden genannt: Massenmigrationen (Internationalisierung der Arbeitsmärkte), Entkolonialisierungsprozesse, die Entstehung von "Multi-Level-Politics" und neue globale Instrumente des Völkerrechts.
Wie veränderte die Migration die europäische Gesellschaft?
Durch Arbeitsmigration wurden europäische Länder ethnisch und kulturell vielschichtiger. Dies stellte die klassischen nationalstaatlichen Grenzen und das Konzept der exklusiven nationalen Mitgliedschaft in Frage.
Was ist das Ziel des Vergleichs der zwei Staatsbürgerschaftsmodelle?
Die Arbeit vergleicht das klassische Modell der nationalen Zugehörigkeit mit dem modernen, global beeinflussten Konzept, um die Trennung von Rechten und Identität in der heutigen Gesellschaft aufzuzeigen.
- Quote paper
- Annegret Busse (Author), 2008, Die Staatsbürgerschaften in der europäischen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213813