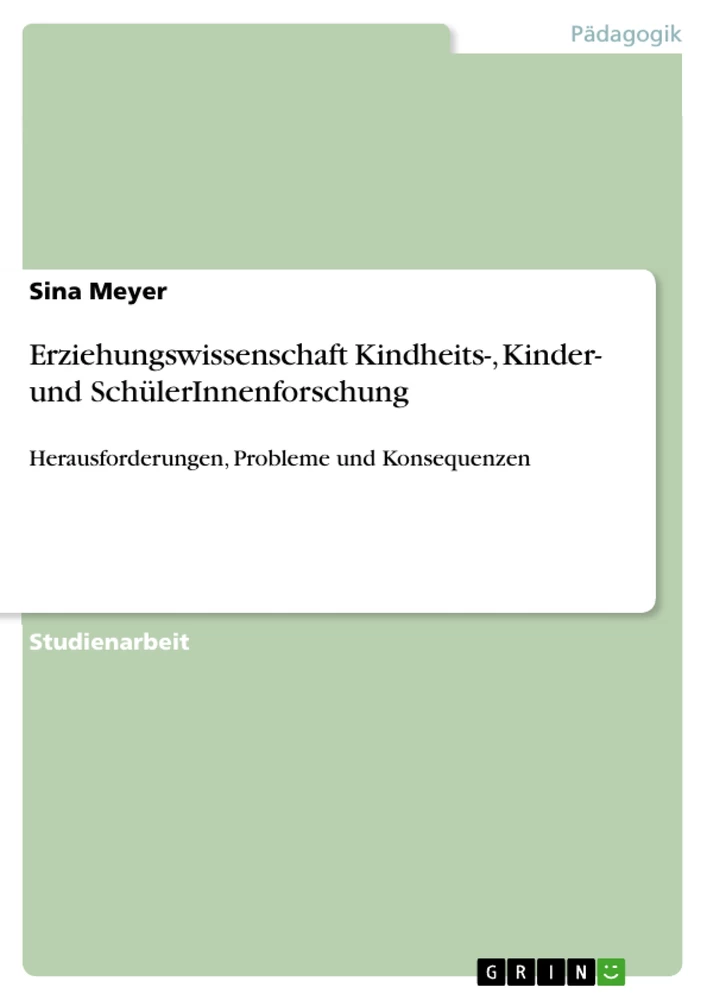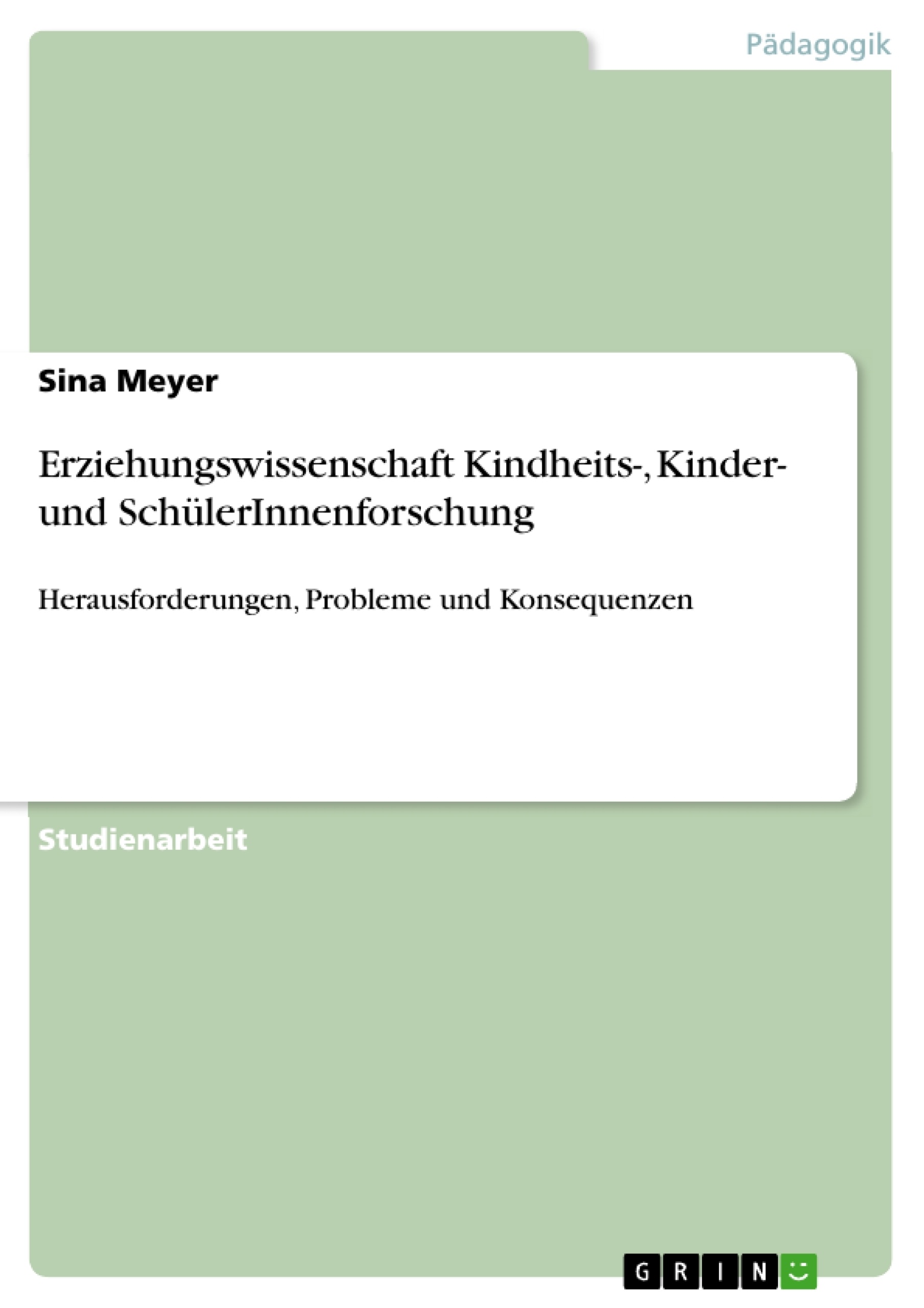In der folgenden Hausarbeit sollen die Herausforderungen an eine Forschung herausgearbeitet werden, die Kinder als Akteure beforscht. Dazu muss zunächst geklärt werden, womit sich eine Kinder- oder Kindheitsforschung beschäftigt und was es bedeutet, wenn Kinder als Akteure bezeichnet werden. Anschließend wird aufgezeigt, worin mögliche Probleme bestehen, wenn man versucht, Kinder zu beforschen.
Im zweiten Teil werden pädagogische und didaktische Konsequenzen aus den Problemen und Chancen der Kinderforschung für einen schülerorientierten Unterricht gezogen. Hierbei wird geklärt, was es heißt, schülerorientiert zu unterrichten und worauf wir als Lehrperson achten müssen, wenn wir wissen, welche Herausforderungen bei der Kinderforschung bestehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Herausforderungen an eine Kinderforschung
2.1 Begriffsklärung
2.2 Perspektive
2.3 Sprache
2.4 Differenzen/Antworten
3. Konsequenzen für einen schülerorientierten Unterricht
3.1 Schülerorientierter Unterricht
3.2 Pädagogische und didaktische Konsequenzen aus den Chancen und Problemen der Kindheitsforschung
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der folgenden Hausarbeit sollen die Herausforderungen an eine Forschung herausgearbeitet werden, die Kinder als Akteure beforscht. Dazu muss zunächst geklärt werden, womit sich eine Kinder- oder Kindheitsforschung beschäftigt und was es bedeutet, wenn Kinder als Akteure bezeichnet werden. Anschließend wird aufgezeigt, worin mögliche Probleme bestehen, wenn man versucht, Kinder zu beforschen.
Im zweiten Teil werden pädagogische und didaktische Konsequenzen aus den Problemen und Chancen der Kinderforschung für einen schülerorientierten Unterricht gezogen. Hierbei wird geklärt, was es heißt, schülerorientiert zu unterrichten und worauf wir als Lehrperson achten müssen, wenn wir wissen, welche Herausforderungen bei der Kinderforschung bestehen.
2. Herausforderungen an eine Kinderforschung
2.1 Begriffsklärung
Als Akteur bezeichnet man jemanden, der sich aktiv an einem Geschehen beteiligt. Der Handelnde erduldet nichts passiv, er wartet nicht ab oder lässt über sich bestimmen, sondern handelt selbst und wird tätig. Die Kinderforschung bezeichnet Kinder als Akteure und drückt damit aus, dass sie die Kinder den Erwachsenen gleichstellt; sie sind genauso ein „(…) vollwertiges Mitglied der Gesellschaft (…)“ (Hurrelmann 2003, S.7). Kinder werden nicht als halbe Menschen angesehen, sondern als Menschen, die zwar ihr Leben gerade erst begonnen haben, aber es trotzdem selbst gestalten.
Früher war die Erziehung der Kinder schulisch, als auch von den Eltern ausgehend, sehr streng. In heutiger Zeit werden Kinder eher frei erzogen, sie können mitbestimmen und sich selbst entfalten.
Die Kinder- oder Kindheitsforschung befasst sich mit zwei Themenschwerpunkten. Zum einen betrachtet sie die „Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit“ (ebd., S.11), zum anderen beschäftigt sie sich mit den „(…) sozialen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Gestaltung der Lebensphase Kindheit“ (ebd.). Das heißt, es wird aus psychologischer und soziologischer Sichtweise erörtert, wie Kinder ihre Persönlichkeit entwickeln und welchen Einfluss ihr Umfeld auf sie hat. Die Kindheitsforschung ist interdisziplinär; sie beinhaltet verschiedene Fachgebiete, wie zum Beispiel Psychologie, Soziologie, Verhaltensforschung oder Geisteswissenschaft. Es gibt diese Richtung der Forschung erst etwa 30 Jahre.
2.2 Perspektive
Da die Kinderforschung selbst noch sehr jung ist, gibt es nur wenige Forschungsmethoden, die direkt auf die Kinder zugeschnitten sind. Oftmals werden Methoden der Erwachsenenforschung auf die Kinderforschung übertragen. Man versucht, sie auf Kinder anzupassen, doch da die Forscher selbst erwachsen sind, gibt es perspektivische Probleme: Erwachsene sehen Kinder immer als Lebewesen, die noch erzogen werden müssen; als eher unselbstständig. Diese Sichtweise bringen sie auch in die Forschung mit ein, sie orientieren sich an ihrem eigenen Wertesystem und nehmen Kinder oft nicht ernst genug. Dies geschieht, da oft ein Unverständnis der Erwachsenen gegenüber Kindern herrscht. Es stellt sich die Frage, ob Erwachsene in der Lage sind, die Perspektive, die Ansichten und Meinungen der Kinder nachvollziehen zu können. Da die Forschungsergebnisse später Erwachsenen vorliegen und von diesen anerkannt werden müssen, orientieren sich Methoden oft zu stark an den Erwachsenen. Man muss die Forschung auf Kinder zuschneiden. Der Perspektivenwechsel wird erschwert durch die Sichtweise Erwachsener von Kindern. Sie müssen die Kinder als „gleichwertige Gesellschaftsmitglieder“ und nicht als „unfertige Erwachsene“ (vgl. Hülst in Heinzel 2000, S. 37) betrachten; sie mit sich gleichsetzen.
Des Weiteren stellt die Beeinflussung durch andere Perspektiven ein Problem dar: Erwachsene werden beeinflusst durch ihre eigenen Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht haben und durch ihre Haltung Kindern gegenüber. Fallen Erfahrungen und Haltung eher negativ aus, so erzielen sie andere Forschungsergebnisse, als Erwachsene, die eine positive Verbindung mit Kindern haben. Außerdem hat man als Erwachsener eine andere Sichtweise, wenn man selbst Kinder hat; man kann dann einiges eventuell besser nachvollziehen.
Kinder werden beeinflusst durch ihr Umfeld. In erster Linie werden sie durch ihre Eltern geformt, dann durch Kindergarten, Schule oder ihre Hobbies. Es ist also schwierig, zwischen der eigenen ehrlichen Ansicht des Kindes und der Ansicht, die sie von ihren Eltern oder anderen Menschen aus ihrem Umfeld übertragen bekommen haben, zu differenzieren. Hier vermischt sich die Erwachsenen- und Kinderperspektive.
2.3 Sprache
Das Unverständnis Erwachsener Kindern gegenüber besteht nicht nur durch die andere Sichtweise, sondern auch durch Sprache und Ausdrucksweisen.
Kinder befinden sich auf einem anderen Sprachniveau, sie können manches nicht gewählt oder konkret ausdrücken. Benutzt man eine Forschungsmethode, wie das qualitative Interview, bei dem mit den Kindern dialogisch kommuniziert wird, so müssen sich Erwachsene auf das Sprachniveau der Kinder begeben. Allerdings neigen Erwachsene dazu, zu sehr in die Sprache der Kinder zu verfallen und verniedlichen vieles. Da die Kinder die Sprache erst erlernen, muss man laut Burkhard Fuhs Kindern andere Ausdrucksformen zeigen, wie z.B. das Malen, Zeigen oder Vorspielen. (vgl. Fuhs in Heinzel 2000, S. 90) Forschern fällt es jedoch schwer, diese anderen Ausdrucksformen schließlich zu verbalisieren, da sie auf die Sprache angewiesen sind.
Außerdem stellt sich die Herausforderung, Kinder so zu befragen, dass sie gern etwas erzählen und antworten. Kinder, die unter dem Einfluss der Schule stehen, könnten solche Befragungen als Test verstehen und Druck verspüren, die richtige Antwort geben zu müssen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet es, Kinder als „Akteure“ in der Forschung zu sehen?
Es bedeutet, Kinder als vollwertige Gesellschaftsmitglieder zu betrachten, die ihr Leben aktiv mitgestalten, statt sie nur als passive Objekte der Erziehung zu sehen.
Welche Probleme gibt es bei der Forschung mit Kindern?
Herausforderungen sind das unterschiedliche Sprachniveau, die Machtasymmetrie zwischen Erwachsenen und Kindern sowie die Beeinflussung der Kinder durch ihr Umfeld.
Warum ist der Perspektivenwechsel für Forscher schwierig?
Erwachsene neigen dazu, Kinder aus ihrem eigenen Wertesystem heraus als „unfertig“ zu betrachten, was die objektive Wahrnehmung der kindlichen Sichtweise erschwert.
Was ist schülerorientierter Unterricht?
Ein Unterrichtskonzept, das die Interessen, Bedürfnisse und Perspektiven der Schüler in den Mittelpunkt stellt und sie als aktive Mitgestalter des Lernens begreift.
Warum nutzt die Kinderforschung alternative Ausdrucksformen?
Da Kinder komplexe Sachverhalte oft noch nicht perfekt verbalisieren können, werden Methoden wie Malen, Zeigen oder Vorspielen genutzt, um ihre Sichtweisen zu erfassen.
- Quote paper
- Sina Meyer (Author), 2012, Erziehungswissenschaft Kindheits-, Kinder- und SchülerInnenforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213973