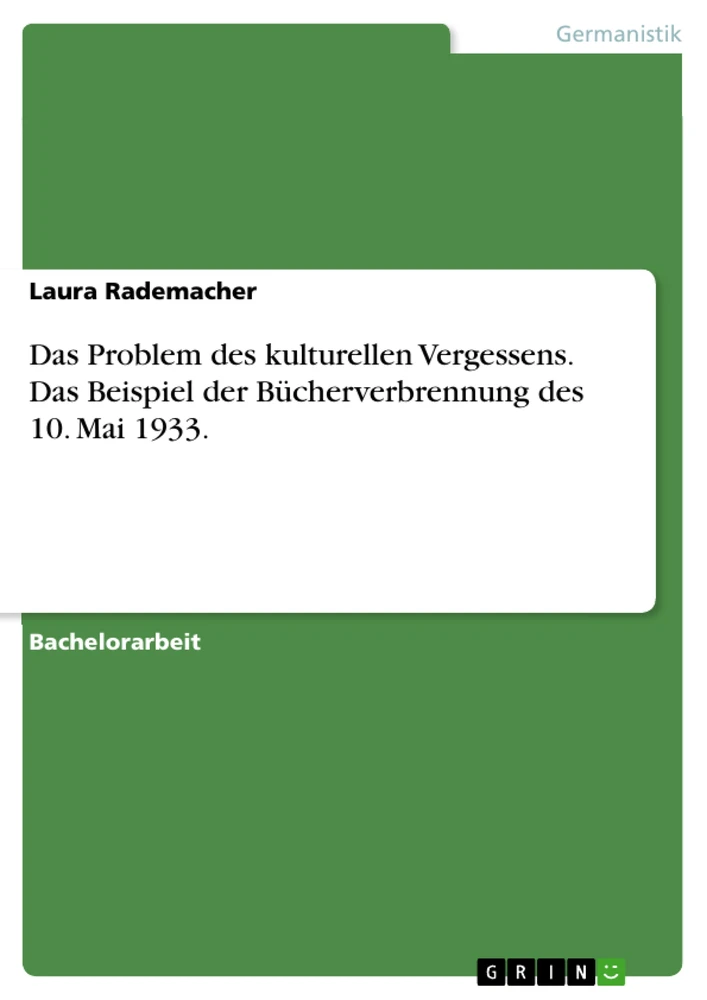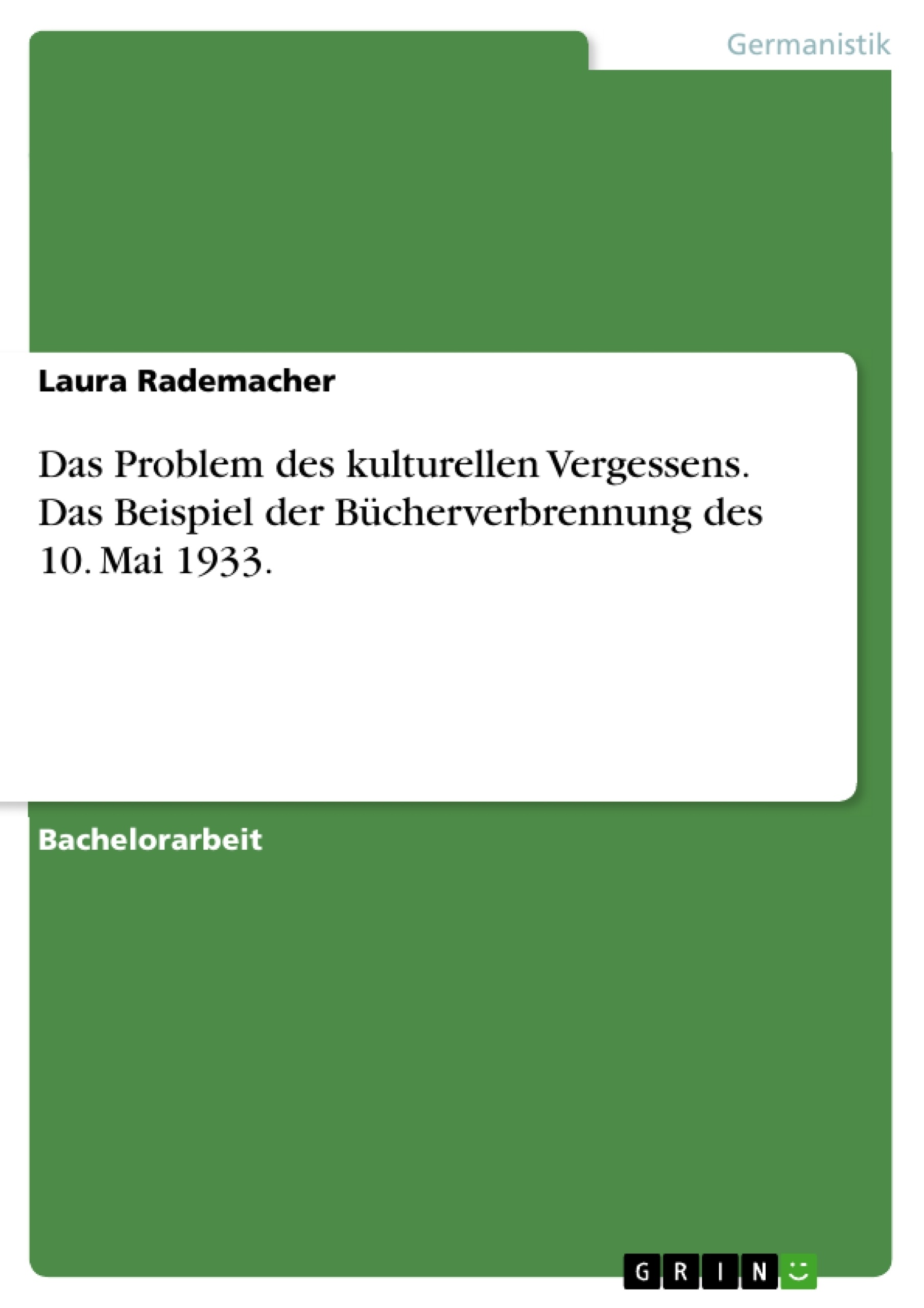Literatur ist das Fragment der Fragmente;
Das wenigste dessen, was geschah und gesprochen worden, ward geschrieben,
vom Geschriebenen ist das wenigste übrig geblieben.
Goethe
Maximen und Reflexionen No. 512
1. Einleitung
Aufgabe der Geisteswissenschaft ist es ein fortwährendes Gespräch mit der Vergangenheit zu führen.
Das Wort „vergessen“ ist im Deutschen ein aktives Verb und bezeichnet damit eine Tätigkeit, in der Regel passiert das Vergessen aber ungesteuert und unbewusst.
Können geschichtliche Ereignisse und Errungenschaften durch den Menschen aus dem kulturellen Gedächtnis gelöscht werden? Ziel dieser Arbeit soll es sein, diese zentrale Frage am Beispiel der Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 zu beantworten. Hierfür wird es nötig sein zunächst einige Begrifflichkeiten und Voraussetzungen zu erläutern. Um die Frage, ob das gewollte Eingreifen in das kulturelle Gedächtnis möglich ist, zu klären muss zunächst festgelegt werden, was unter kulturellem Gedächtnis und individuellem Gedächtnis verstanden wird. Außerdem welche Funktionen das Erinnern und das Vergessen für das Gedächtnis spielen.
Fragen: Wieso konnten die Nazis die Autoren der Bücherverbrennung nicht aus dem kulturellen Gedächtnis löschen?
Wie entsteht kulturelles Gedächtnis?
Wieso ist das Eingreifen ins kulturelle Gedächtnis nicht möglich?
Was besagen Derrida und Foucault zur Entstehung von Erinnerung und welche Rolle spielen dabei Archive und Bibliotheken?
Wieso entstehen Theorien zur Entstehung von Erinnerung besonders zu den Jahrhundertwenden? (Umbruchszeiten, kulturelle Instabilität)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kulturelles und Individuelles Gedächtnis
- Entstehung Kulturellen Gedächtnisses oder das Problem des Vergessens
- Gedächtnismetaphern
- Theorien des Archivs
- Sigmund Freud und Jacques Derrida
- Geschichte der Bücherverbrennung
- Die Bücherverbrennung von 1933
- Das Fortbestehen der verbrannten Bücher und deren Autoren
- Die Salzmann-Sammlung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, warum die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 nicht erfolgreich darin war, 76 Autoren aus dem kulturellen Gedächtnis zu löschen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie kulturelle Identität entsteht und welche Rolle das kulturelle Gedächtnis dabei spielt.
- Die Entstehung und Funktionsweise des kulturellen Gedächtnisses
- Gedächtnismetaphern und deren Rolle im Verständnis von Erinnern und Vergessen
- Theorien des Archivs und die Frage der Lösbarkeit von Spuren im kulturellen Gedächtnis
- Die Bücherverbrennung von 1933 als Eingriff in das kulturelle Gedächtnis
- Die Bedeutung der Erhaltung und Wiederbelebung verfemter Werke und Autoren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bücherverbrennung von 1933 und deren Auswirkungen auf das kulturelle Gedächtnis ein.
Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung des kulturellen Gedächtnisses und untersucht den Zusammenhang zwischen individuellem und kollektivem Erinnern. Es werden verschiedene Gedächtnismetaphern vorgestellt, die das Phänomen des Vergessens im Laufe der Geschichte erklären helfen.
Kapitel 3 befasst sich mit Theorien des Archivs und stellt die Frage, ob es möglich ist, dass der Mensch in das kulturelle Gedächtnis eingreift. Die Theorien von Sigmund Freud und Jacques Derrida werden in diesem Zusammenhang diskutiert.
Kapitel 4 analysiert die Bücherverbrennung von 1933 im Kontext der Theorien des kulturellen Gedächtnisses. Es werden die Auswirkungen dieses Eingriffs auf das kulturelle Gedächtnis sowie die Bemühungen zur Erhaltung und Wiederbelebung der verfemten Werke und Autoren beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kulturelles Gedächtnis, individuelles Gedächtnis, Bücherverbrennung, 10. Mai 1933, Nationalsozialismus, Sigmund Freud, Jacques Derrida, Gedächtnismetaphern, Archiv, Kultur, Identität, Erinnerung, Vergessen, Salzmann-Sammlung.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933?
Das Ziel der Nationalsozialisten war es, unliebsame Autoren und deren Werke physisch zu vernichten und sie damit dauerhaft aus dem kulturellen Gedächtnis zu löschen.
Warum scheiterte der Versuch, die Autoren aus dem Gedächtnis zu tilgen?
Kulturelles Gedächtnis lässt sich nicht einfach "löschen". Durch Archive, Bibliotheken (wie die Salzmann-Sammlung) und das Fortbestehen der Werke im Ausland blieben die Spuren erhalten.
Was ist der Unterschied zwischen individuellem und kulturellem Gedächtnis?
Das individuelle Gedächtnis ist an die Person gebunden, während das kulturelle Gedächtnis kollektives Wissen, Traditionen und Geschichte über Generationen hinweg speichert.
Welche Rolle spielen Archive laut Derrida und Foucault?
Archive dienen als Speicherorte für Spuren der Vergangenheit. Sie machen ein gewolltes Eingreifen in das Gedächtnis schwierig, da sie Informationen bewahren, die später wiederentdeckt werden können.
Was ist die Salzmann-Sammlung?
Die Salzmann-Sammlung ist ein Beispiel für Bemühungen zur Erhaltung verfemter Werke, die dazu beigetragen haben, die verbrannten Bücher und ihre Autoren der Nachwelt wieder zugänglich zu machen.
- Quote paper
- Laura Rademacher (Author), 2012, Das Problem des kulturellen Vergessens. Das Beispiel der Bücherverbrennung des 10. Mai 1933., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214111