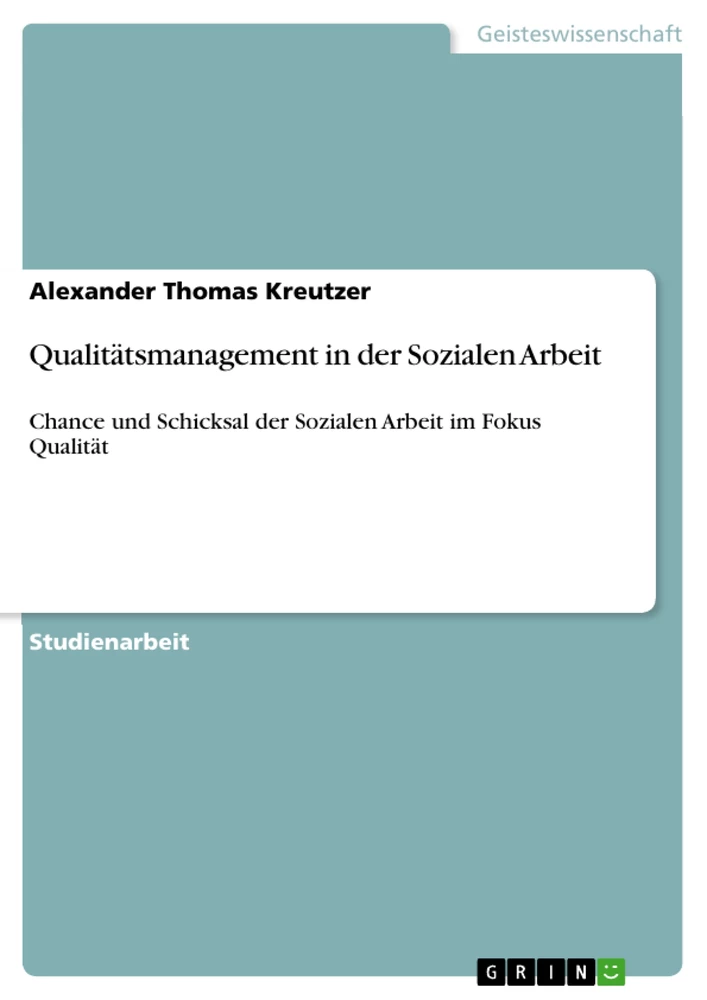Qualität ist, seit der Hochkonjunktur dieses Begriffes, nicht nur als ein bedeutungsvoller Umstand in der Sozialen Arbeit anzusehen, vielmehr hat sich jene prägend für die Einrichtungen der Sozialen Arbeit erwiesen. Im Kontext der ökonomischen Zwänge durch sozialpolitische Einsparungen auf Träger und Einrichtungen, ist Qualität aktueller denn je worden. Zudem hat sich der Druck auf jene soziale Dienstleistungsanbieter zunehmend erhöht. Marktrelevante Bedingungen fordern öffentlich legitimierte Angebote und eine höhere Leistungsqualität, denen die aktuellen Dienstleistungsanbieter im „Zeichen der Zeit“ gerecht werden müssen. Mit der Umsetzung solcher Anforderungen tun sich viele Einrichtungen der Sozialen Arbeit immer noch schwer, weil die in der Industrie entwickelten Qualitätsstandards schwer auf die Soziale Arbeit übertragbar sind. Der Entwicklungs- bzw. Erprobungsstand methodisch- fachlicher Praktiken für das Qualitätsmanagement (QM) ist noch nicht sehr weit fortgeschritten (Vgl. Merchel, S.7, 2001).
Im „Hier und Jetzt“ steht ganz klar nicht mehr die Quantität der Leistungen der Sozialen Arbeit, sondern die Qualität. Neben der geforderten staatlich kontrollierten Transparenz der Leistungen im Sinne der Dokumentation, rücken vermehrt verbindliche Qualitätsstandards in den Vordergrund. Einrichtungen mit kostenintensiveren Arbeitsfeldern, wie z.B. die Bereiche Alten-, Behinderten- und Erziehungshilfe werden dadurch, dass der Gesetzgeber konkrete Nachweise einfordert, verstärkt dokumentiert. Dadurch liegen mehr empirische Befunde über die Qualität Sozialer Arbeit vor, als in anderen Bereichen. Die Sozialarbeiterische Praxis muss mehrdimensional betrachtet werden, um überhaupt Nachweise über das Gelingen einer solchen zu erbringen. Es wird dazu angehalten die Thematisierung des Begriffes Qualität keinesfalls als neologistisch anzusehen, sondern darauf verwiesen die Entwicklung historisch zu betrachten. Die Entwicklung zeichnet sich vor allem, zeitlich eingegrenzt, in den Epochen vom Nachkriegsdeutschland bis heute ab. Die großzügig ausgestattete wohlfahrtsstaatliche Organisation wird demnach zunehmend zur wettbewerbsfähigen, vom Markt gesteuerten und effizienten Einrichtung umfunktioniert (Vgl. Flösser, 2005) In wieweit ist diese Entwicklung als schicksalhafte Begleiterscheinung anzusehen und in wie fern kann diese Entwicklung als Chance bzw. Schub für eine professionalisierte Soziale Arbeit verstanden werden?
Inhalt
EINLEITUNG
1. ZUM GRUNDVERSTÄNDNIS DER QUALITÄTSDEBATTE
2. HISTORISCHE NOTIZ/ ENTWICKLUNG DER SOZIALEN ARBEIT IN PHASEN
3. DER BEGRIFF QUALITÄT
3.1 EBENEN DER QUALITÄT
4. ZUR BEDEUTUNG VON QUALITÄTSMANAGEMENT
4.1 QM- ANLIEGEN: MESSEN VON QUALITÄT
4.2 QM-SYSTEME (BEISPIELE)
4.2.1 DIN EN ISO 9000FF
4.2.2 EFQM
4.2.3 BENCHMARKING
4.2.4 INTERNE EVALUATION / SELBSTEVALUATION
5. QM- EIN PATENTREZEPT?
6. PROFESSIONALITÄT DURCH ZUSAMMENSPIEL ORGANISATION/FACHKRAFT
7. CHANCEN UND RISIKEN VON QM FÜR DIE SOZIALE ARBEIT
7.1 CHANCEN
7.2 RISIKEN
8. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit aktuell so wichtig?
Qualitätsmanagement ist aufgrund ökonomischer Zwänge, sozialpolitischer Einsparungen und des gestiegenen Drucks auf soziale Dienstleister essenziell geworden. Es dient der öffentlichen Legitimation und der Sicherung einer hohen Leistungsqualität.
Warum lassen sich industrielle Qualitätsstandards schwer auf die Soziale Arbeit übertragen?
Industrielle Standards sind oft auf messbare Produkte ausgelegt, während soziale Arbeit komplexe, zwischenmenschliche Dienstleistungen erbringt. Die methodisch-fachlichen Praktiken für ein spezifisches QM in der Sozialen Arbeit sind laut Merchel noch in der Entwicklung.
Welche Rolle spielt die Dokumentation im Qualitätsmanagement?
Die Dokumentation dient der staatlich kontrollierten Transparenz. Besonders in kostenintensiven Bereichen wie der Alten- oder Behindertenhilfe fordert der Gesetzgeber konkrete Nachweise über die Qualität der Leistungen.
Welche QM-Systeme werden in der Arbeit als Beispiele genannt?
In der Arbeit werden unter anderem DIN EN ISO 9000ff, EFQM, Benchmarking sowie die interne Evaluation bzw. Selbstevaluation als Systeme zur Qualitätssicherung behandelt.
Ist Qualitätsmanagement ein „Patentrezept“ für soziale Einrichtungen?
Nein, QM wird kritisch hinterfragt. Es bietet zwar Chancen zur Professionalisierung, birgt aber auch Risiken, wenn die ökonomische Effizienz über die fachliche Qualität gestellt wird.
Wie hat sich die Organisation der Wohlfahrt historisch verändert?
Die Entwicklung zeigt einen Wandel von einer großzügig ausgestatteten wohlfahrtsstaatlichen Organisation hin zu wettbewerbsfähigen, marktgesteuerten und effizienzorientierten Einrichtungen.
- Quote paper
- Alexander Thomas Kreutzer (Author), 2013, Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214150