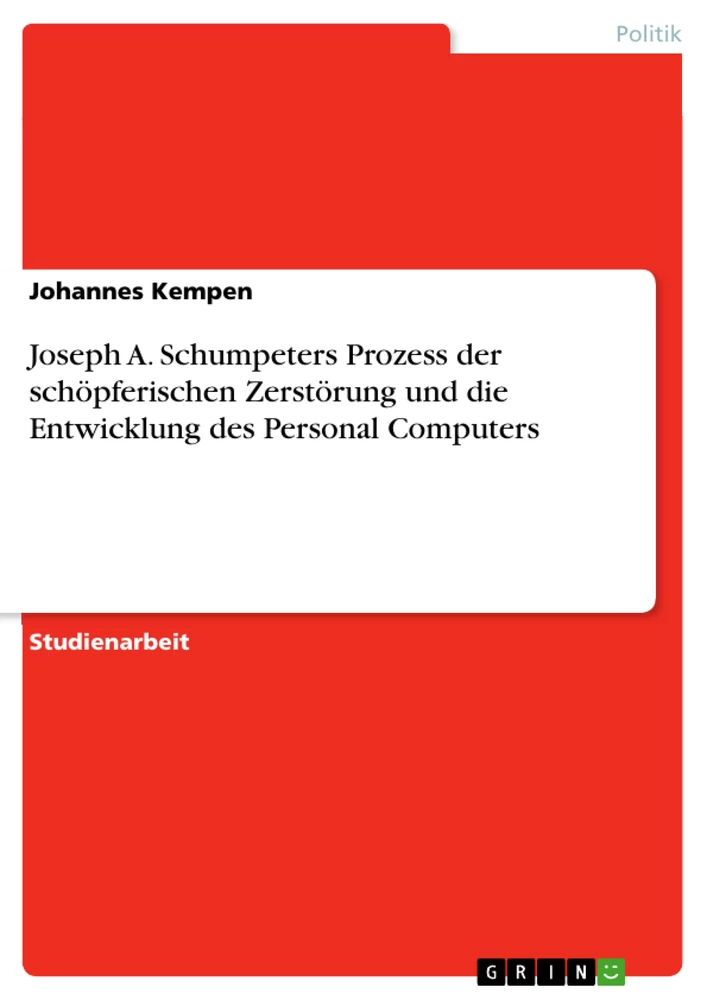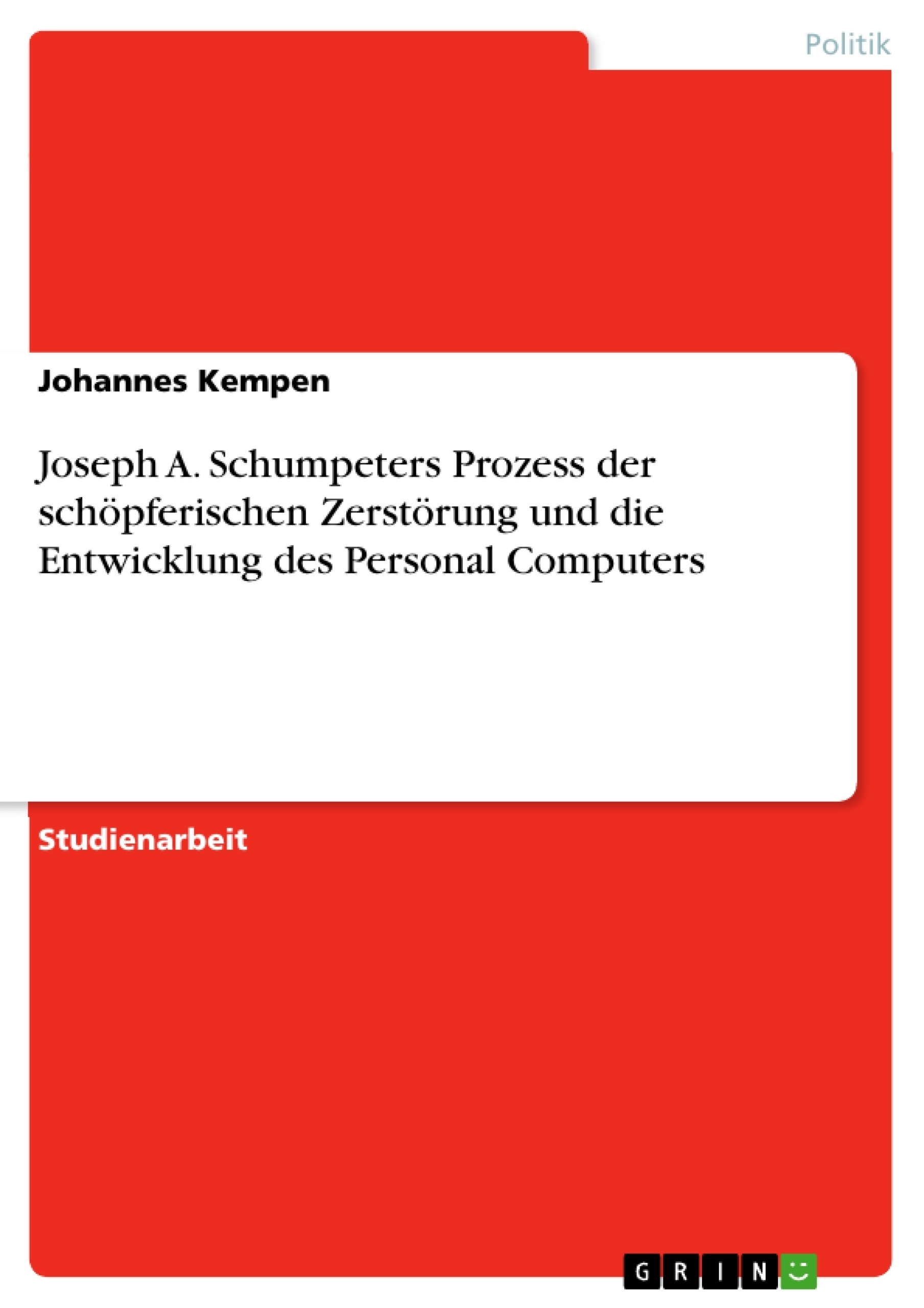Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise hat der kritischen Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus und seinen Mechanismen wieder die Türen geöffnet. Dadurch ist auch Joseph A. Schumpeters Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie erneut Teil der Diskussion. Denn wer das Werk liest, kommt zu dem Schluss, dass Schumpeter auf viele Schwächen des Kapitalismus bereits vor 60 Jahren hingewiesen hat. Seiner Theorie nach würde der Kapitalismus endogen, also wegen seiner eigenen Prozesse und Charakteristika zugrunde gehen und sich zu einem sozialistischen System wandeln. Schumpeter betonte stets, wie sehr ihm dieser Prozess selbst widerstrebte, hielt die Transformation aber für unaufhaltbar. Diese Renaissance von Schumpeters Werk nutzend, wird diese Arbeit einen Aspekt seiner Kapitalismustheorie genauer untersuchen: den Prozess der schöpferischen Zerstörung.
Der Prozess der schöpferischen Zerstörung sei zunächst als Schlüsselmechanismus des Kapitalismus zu verstehen. Da Schumpeter jedoch davon ausgeht, dass die kapitalistische Ordnung generell zugrunde gehen wird, kann jedes Charakteristikum des Kapitalismus gleichzeitig als Bedingung für den Sozialismus verstanden werden.
Diese Arbeit untersucht, ob sich der Prozess der schöpferischen Zerstörung anhand der Entwicklung des Personal Computers, schwerpunktmäßig am Beispiel des IBM-PC, empirisch belegen lässt. Wenn IBM auch nicht für die ganze Computerwirtschaft stehen kann, hat das Unternehmen doch Modellcharakter und war prägend für die Entwicklung der gesamten Sparte. Dass es zahlreiche weitere Firmen gibt, die einmal Marktführer waren – worauf nur am Rande eingegangen werden kann – ist ein Hinweis auf den schnellen Wandel dieser Industrie. Auch der Internetboom seit Mitte der 1990er Jahre hat bis heute erhebliche Auswirkungen auf die Computerwirtschaft. Zur besseren Abgrenzung erstreckt sich der Untersuchungszeitraum daher lediglich von Mitte der 1970er Jahre bis zur Jahrtausendwende. Da sich die Entwicklung des Personal Computers im Wesentlichen in den Vereinigten Staaten abspielte, beziehen sich die empirischen Bezüge entsprechend weitestgehend darauf. Die namhaften Firmen hatten und haben dort ihren Sitz, der Aufschwung der Computerwirtschaft in Südostasien geschah zu spät, um hier noch relevant zu sein.
Die Leitfrage lautet: Lässt sich Joseph A. Schumpeters Prozess der schöpferischen Zerstörung anhand der Entwicklung des Personal Computers zwischen Mitte der 1970er Jahre und der Jahrtausendwende erkennen?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Schumpeters Theorie
2.1. Entwicklung und Innovation
2.2. Unternehmen und Unternehmer
2.3. Der Prozess der schöpferischen Zerstörung
2.4. Die Theorie vom Niedergang des Kapitalismus
3. Analytischer Teil
3.1. Vorgehen
3.2. Phase I: Introducory Phase
3.2.1. Die Anfänge des Computerzeitalter
3.2.2. Erste Kommerzialisierungen
3.3. Phase II: Growth Phase
3.3.1. Der IBM-PC setzt Standards
3.3.2. Shakeout -Mechanismus
3.3.3. Implikationen für Schumpeters Modell
3.4. Phase III: Mature Phase
3.5. Zwischenfazit
4. Fazit
4.1. Zusammenfassung und Bewertung
4.2. Entwicklung in jüngerer Zeit
5. Literaturverzeichnis
5.1. Monographien und wissenschaftliche Zeitschriftenartikel
5.2. Sonstige Internetquellen
6. Anhang
6.1. Grafik 1: Anzahl von Computerfirmen im jeweiligen Jahr
6.2. Grafik 2: Lebensdauer von Computerfirmen zwischen 1969 und 2000
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Schumpeters „schöpferische Zerstörung“?
Es ist der Prozess, bei dem radikale Innovationen alte Strukturen verdrängen und zerstören, um Platz für neue, effizientere Wirtschaftsformen zu schaffen.
Wie lässt sich die Theorie am Beispiel des PCs belegen?
Die Entwicklung des IBM-PC und das Verschwinden zahlreicher früherer Marktführer zeigen den schnellen Wandel und die Verdrängung alter Technologien in dieser Branche.
Warum hielt Schumpeter den Niedergang des Kapitalismus für möglich?
Er glaubte, dass der Kapitalismus durch seinen eigenen Erfolg und die Bürokratisierung von Innovationen schließlich in ein sozialistisches System übergehen würde.
Welche Rolle spielt der Unternehmer bei Schumpeter?
Der Unternehmer ist der zentrale Akteur, der durch die Durchsetzung neuer Kombinationen (Innovationen) den Prozess der schöpferischen Zerstörung vorantreibt.
Was ist der „Shakeout-Mechanismus“?
In der Wachstumsphase einer Industrie werden weniger effiziente Firmen durch den Wettbewerb aus dem Markt gedrängt, bis nur noch wenige starke Anbieter übrig bleiben.
- Quote paper
- Johannes Kempen (Author), 2010, Joseph A. Schumpeters Prozess der schöpferischen Zerstörung und die Entwicklung des Personal Computers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214174