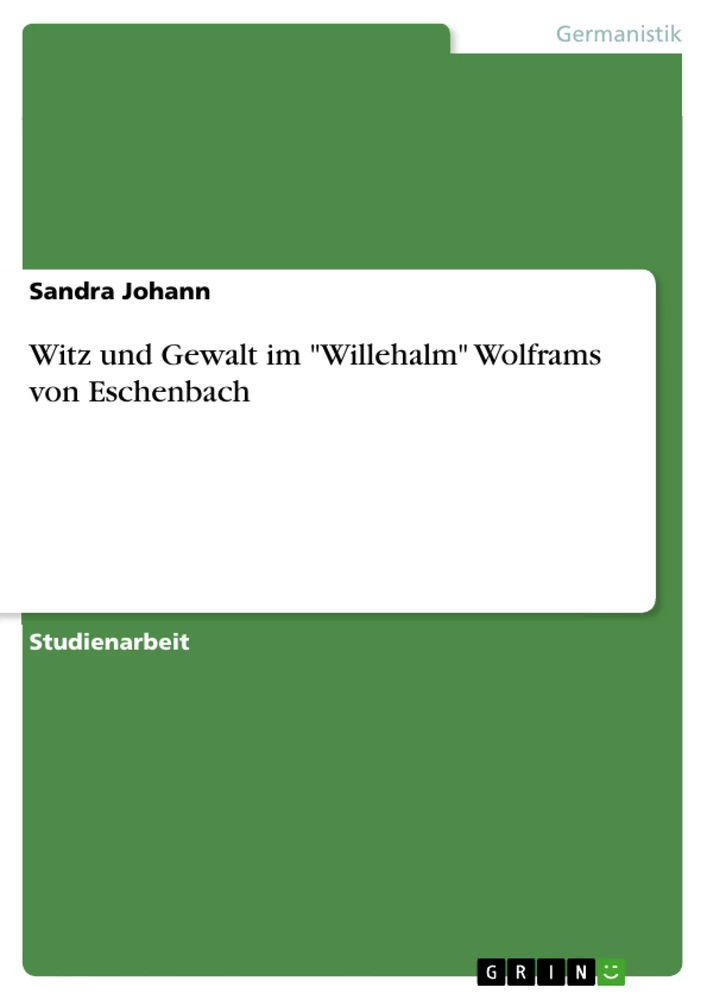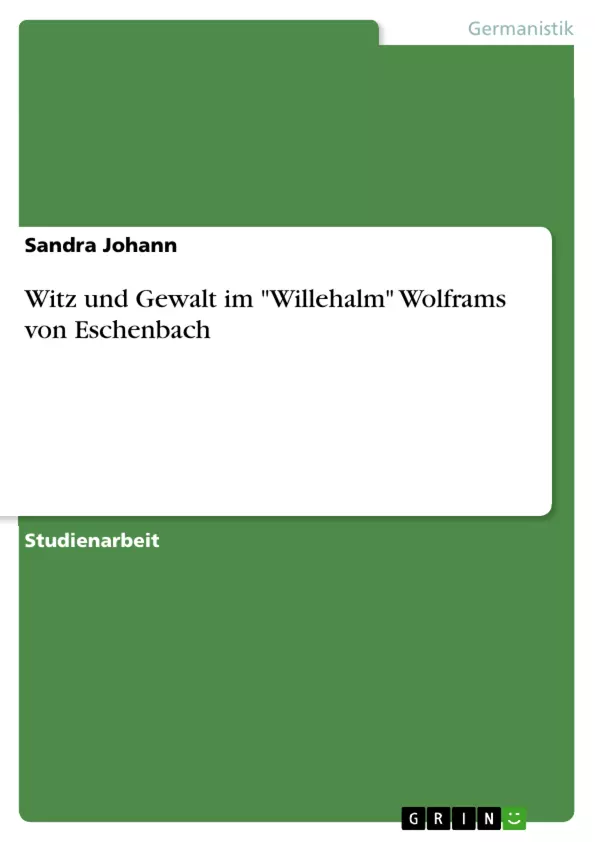Es handelt sich bei der vorliegend Arbeit um eine Abhandlung über Witz und Gewalt in Wolfram von Eschenbachs "Willehalm", die mit sehr gut (1,3) bewertet wurde. Ziel dieser Arbeit ist es, Willehalm auf Witze hin zu untersuchen, die in einer Verbindung zur Gewalt stehen. Dabei wurde vor allem auf den aktuellen Forschungsstand eingegangen und das Werk detailliert untersucht.Eine Analyse der Witztechnik sowie und das "Lachen" im Mittelalter stehen im Vordergrund.
Die Arbeit beinhaltet ein mehr als ausführliches Literaturverzeichnis und wurde mit Sorgfalt erstellt.
Auszug aus der Einleitung:
Ziel dieser Arbeit ist es , Willehalm auf Witze hin zu untersuchen, die in einer Verbindung zur Gewalt stehen. Um diese die Witztechnik Wolframs, die durch aggressive und tendenziö-se Anspielungen geprägt ist, analysieren zu können und die Gründe für das „Lachen“ des mit-telalterlichen höfischen Publikums herauszufinden, ist es wichtig zu verstehen, wie der „Witz“ überhaupt von der Komik abhängt und die Gründe des hervorgerufenen Effekt des Lachens zu begreifen. Hierzu dient der erste Teil der Arbeit, der sich dieser Auflistung widmet sowie darlegt, wie die drei genannten Formen – Komik, Witz und Lachen – voneinander abgegrenzt werden und in der Literatur des Mittelalters angewandt wurden.
Der zweite, wichtigere Teil, beschäftigt sich im Anschluss mit der eigentlichen Analyse der Witztechnik. Nachdem der allgemeine Humor Wolframs dargelegt wird, wird das Verhältnis von Witzen und Gewalt dargelegt. Im Anschluss werden verschieden vorkommende Formen des Witzes, die auf Gewalt abzielen, dargestellt und auf deren Deutung hin untersucht. Eine besondere Beachtung findet dabei die nun schon mehrfach erwähnte Szene mit der Ente, wel-che einen Diskurs in der Forschung hervorgerufen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Komik, Witz und Lachen in der mittelalterlichen Literatur und deren Differenzierung
- Komik
- Witz
- Lachen
- Analyse der Witztechnik im Willehalm und deren Verhältnis zur Gewalt
- Der Humor Wolframs
- Das Verhältnis von Witz und Gewalt
- Gedankenwitze
- Tendenziöse Witze
- Komik der Vergleichung
- Die Banalität der Ente auf dem Bodensee
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Witztechnik in Wolframs von Eschenbachs Willehalm und deren Verbindung zur Gewalt. Sie analysiert, wie Wolframs Humor durch aggressive und tendenziöse Anspielungen geprägt ist und versucht die Gründe für das Lachen des mittelalterlichen Publikums zu ergründen. Dazu wird zunächst die Abgrenzung und Anwendung von Komik, Witz und Lachen in der mittelalterlichen Literatur beleuchtet.
- Analyse der Witztechnik in Wolframs Willehalm
- Das Verhältnis von Witz und Gewalt im Werk
- Untersuchung verschiedener Formen des Witzes mit Bezug auf Gewalt
- Die Rolle des Lachens im mittelalterlichen Kontext
- Interpretation der umstrittenen „Ente auf dem Bodensee“-Szene
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Forschungsstand zur Komik und zum Witz im Willehalm, der im Gegensatz zu Wolframs Parzival bisher weniger Beachtung gefunden hat. Sie hebt die scheinbare Diskrepanz zwischen der Brutalität mancher Szenen und ihrer komischen Wirkung für das mittelalterliche Publikum hervor und benennt die Forschungsarbeiten von Bertau, Röcker und Kartschoke, die verschiedene Interpretationen der „toten Witze“ und insbesondere der Ente-am-Bodensee-Szene liefern. Das Ziel der Arbeit wird klar definiert: die Analyse der Witztechnik und ihres Verhältnisses zur Gewalt im Willehalm.
Komik, Witz und Lachen in der mittelalterlichen Literatur und deren Differenzierung: Dieses Kapitel differenziert die Begriffe Komik, Witz und Lachen im Kontext der mittelalterlichen Literatur. Es wird die Bedeutung literarischer Texte für das Verständnis von Lachen und Komik im Mittelalter herausgestellt und die Schwierigkeit für heutige Leser, die komischen Elemente zu erkennen, diskutiert. Das Kapitel beleuchtet den Unterschied zwischen Komik als „lachen erregende Eigenschaft“ und dem Witz als körperlichster Form des Lachens nach Freud, der Denkweisen und Emotionen aus dem Unterbewusstsein offenbart. Wolframs Komik wird als „Mittel eines Humors“ interpretiert, der Tiefsinn, Trauer und Rührung verbindet und über bloße Belustigung hinausgeht. Die Abgrenzung der drei Konzepte ist essentiell für das Verständnis von Wolframs Witztechnik.
Schlüsselwörter
Wolfram von Eschenbach, Willehalm, mittelalterliche Literatur, Komik, Witz, Gewalt, Humor, Lachen, Witztechnik, „tote Witze“, Ente auf dem Bodensee, höfische Epik, Forschungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu "Analyse der Witztechnik in Wolframs von Eschenbachs Willehalm und deren Verhältnis zur Gewalt"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Witztechnik in Wolfram von Eschenbachs Willehalm und deren Verbindung zur Gewalt. Sie untersucht, wie Wolframs Humor durch aggressive und tendenziöse Anspielungen geprägt ist und versucht, die Gründe für das Lachen des mittelalterlichen Publikums zu ergründen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Interpretation der umstrittenen „Ente auf dem Bodensee“-Szene.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Differenzierung von Komik, Witz und Lachen in der mittelalterlichen Literatur, die Analyse der Witztechnik in Wolframs Willehalm, das Verhältnis von Witz und Gewalt im Werk, verschiedene Formen des Witzes mit Bezug auf Gewalt, die Rolle des Lachens im mittelalterlichen Kontext und die Interpretation der „Ente auf dem Bodensee“-Szene. Der Forschungsstand zu Komik und Witz im Willehalm wird ebenfalls beleuchtet.
Wie werden Komik, Witz und Lachen in der Arbeit unterschieden?
Das Kapitel "Komik, Witz und Lachen in der mittelalterlichen Literatur und deren Differenzierung" differenziert diese Begriffe im mittelalterlichen Kontext. Es wird der Unterschied zwischen Komik als „lachen erregende Eigenschaft“ und dem Witz als körperlichster Form des Lachens nach Freud erläutert. Wolframs Komik wird als „Mittel eines Humors“ interpretiert, der Tiefsinn, Trauer und Rührung verbindet und über bloße Belustigung hinausgeht.
Welche Arten von Witz werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Formen des Witzes im Willehalm, darunter Gedankenwitze und tendenziöse Witze, sowie die Komik der Vergleichung. Es wird untersucht, wie diese Witze mit Gewalt in Verbindung stehen und wie sie beim mittelalterlichen Publikum gewirkt haben könnten.
Welche Rolle spielt Gewalt in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Witz und Gewalt im Willehalm. Sie analysiert, wie Wolframs Humor durch aggressive und tendenziöse Anspielungen geprägt ist und wie diese mit der Brutalität mancher Szenen zusammenhängen. Die scheinbare Diskrepanz zwischen Brutalität und komischer Wirkung wird thematisiert.
Welche Bedeutung hat die "Ente auf dem Bodensee"-Szene?
Die "Ente auf dem Bodensee"-Szene ist ein zentraler Punkt der Analyse. Die Arbeit untersucht verschiedene Interpretationen dieser umstrittenen Szene und versucht, ihre komische Wirkung im mittelalterlichen Kontext zu erklären.
Welche Wissenschaftler werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Forschungsarbeiten von Bertau, Röcker und Kartschoke, die verschiedene Interpretationen der „toten Witze“ und insbesondere der Ente-am-Bodensee-Szene liefern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wolfram von Eschenbach, Willehalm, mittelalterliche Literatur, Komik, Witz, Gewalt, Humor, Lachen, Witztechnik, „tote Witze“, Ente auf dem Bodensee, höfische Epik, Forschungsgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Erstes Staatsexamen Sandra Johann (Autor:in), 2011, Witz und Gewalt im "Willehalm" Wolframs von Eschenbach, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214192