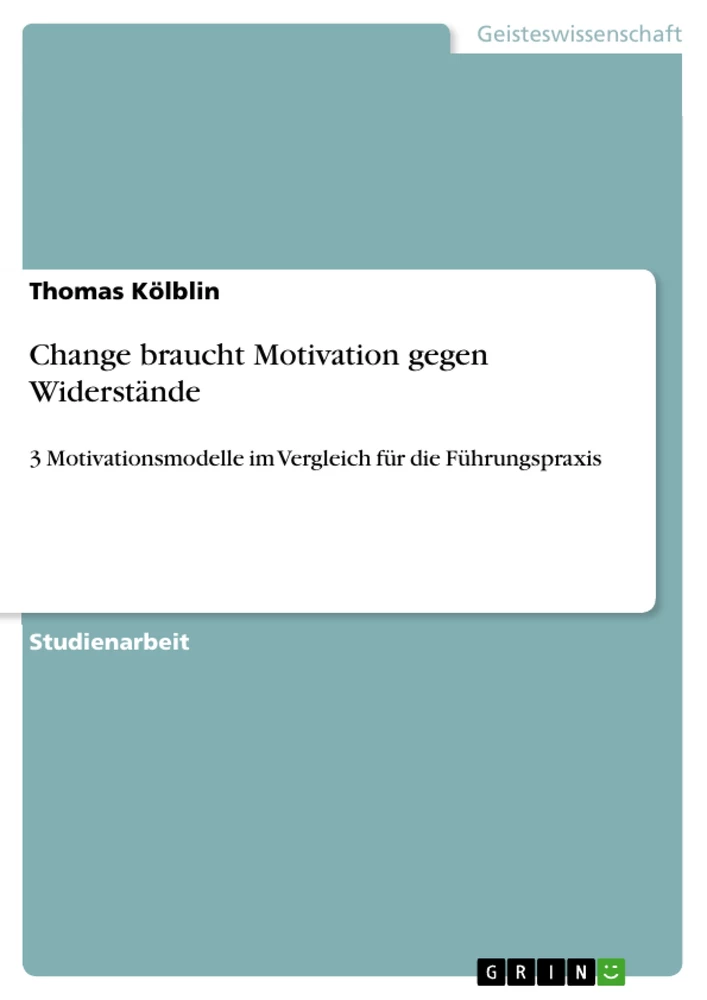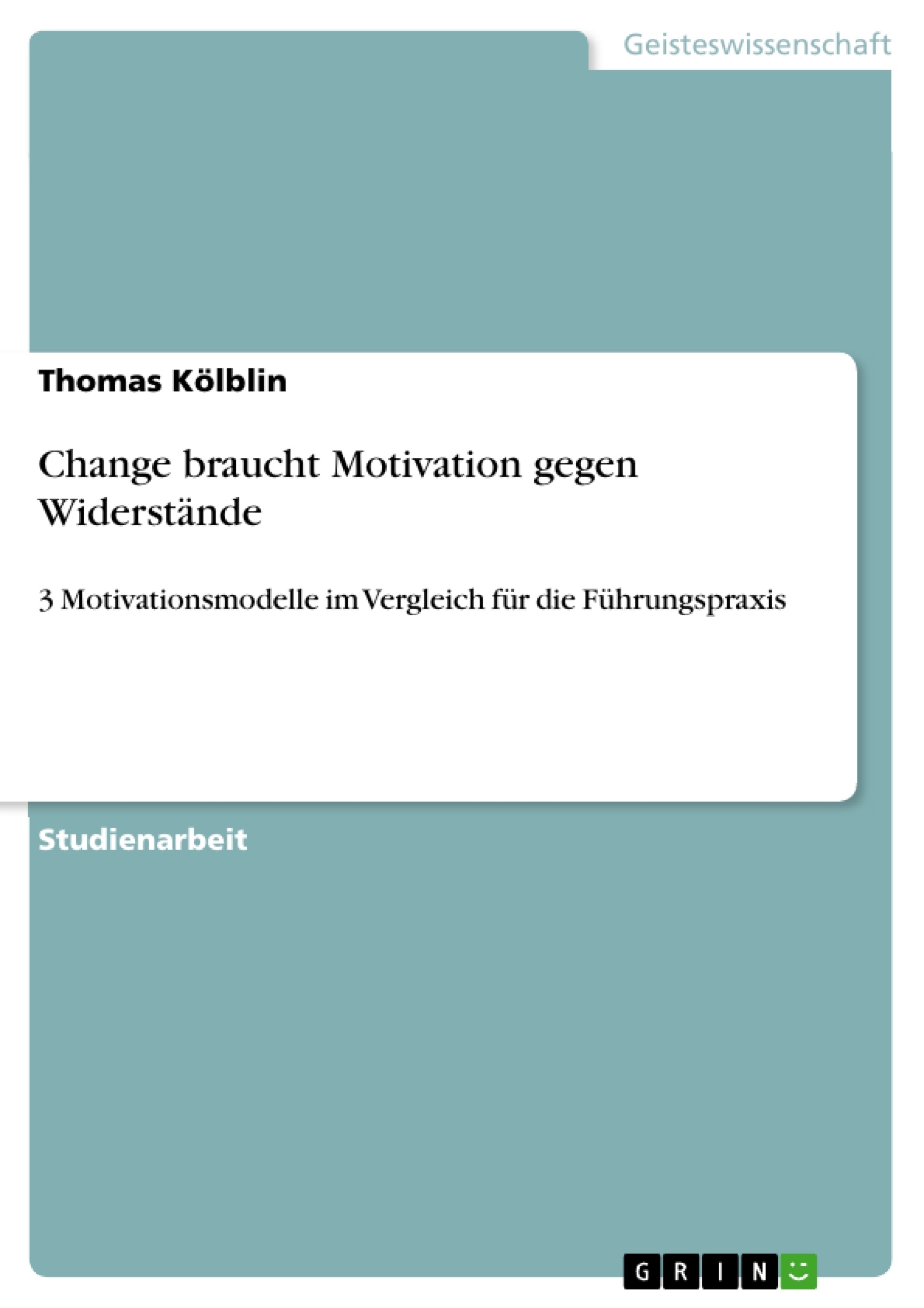Wo man heute in der Wirtschaft hinkommt, sind die Führungskräfte aller Stufen zunehmend stärker gefordert – überall wird umorganisiert. Change-Prozesse ist das zentrale Schlagwort. (U) x (V) x (E) > (W) lautet die Gleichung damit Veränderung gelingt und stattfindet.
(U)nzufriedenheit mit dem Status Quo x (V)ision auf positive Entwicklung x (E)rste Schritte in die neue Richtung > müssen größer sein als diese (W)iderstände. Für Führungskräfte ist dabei die Rechnung nicht ganz so einfach. Hilft Motivation?
Unternehmen sind gezwungen sich rasch und umfassend verändernden Bedingungen anzupassen. Diese Veränderungen müssen geplant werden. Dafür sollen Mitarbeiter gewonnen werden. Unwillkürlich partizipiert dies mit der Motivation der Mitarbeiter. Die Motivation für den Umgang mit Widerständen in Change-Prozessen ist deshalb der Fokus des Autors mit dieser Lektüre.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
3. Definition von Change, Widerstand und Motivation
4. Grundlagen der Motivationspsychologie
5. Die einzelnen Motivationsmodelle
5.1 Das 3K-Modell nach Prof. Dr. Hugo M. Kehr
5.2 Das „Flow“-Konzept nach Mihaly Csikszentmihalyi
5.3 Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE) von Albert Bandura
6. Der Anwendungsnutzen dieser Motivations-Modelle gegen Widerstände in Change-Prozessen
6.1 Führungspraxis – für das 3K-Modell von Hugo M. Kehr
6.2 Führungspraxis – für das „Flow-Erlebens“ nach Mihaly Csikszentmihalyi
6.3 Führungspraxis – für die Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE) von Albert Bandura
7. Diskussion
8. Fazit
9. Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Häufig gestellte Fragen zu Change Management und Motivation
Welche Rolle spielt Motivation in Change-Prozessen?
Motivation ist entscheidend, um Widerstände gegen Veränderungen zu überwinden. Nur wenn Unzufriedenheit, Vision und erste Schritte größer sind als der Widerstand, gelingt der Wandel.
Was ist das 3K-Modell nach Hugo Kehr?
Das Modell beschreibt das Zusammenspiel von Kopf (Kognition), Bauch (Implizite Motive) und Hand (Fähigkeiten) als Voraussetzung für nachhaltige Motivation.
Wie hilft das Flow-Konzept bei Veränderungen?
Das Erreichen eines Flow-Zustands steigert die Leistungsfreude und hilft Mitarbeitern, sich in neuen Strukturen kompetent und engagiert zu fühlen.
Was bedeutet Selbstwirksamkeitserwartung (SWE)?
SWE nach Albert Bandura ist der Glaube an die eigene Fähigkeit, Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Sie ist ein starker Puffer gegen Widerstände im Change-Management.
Wie können Führungskräfte Widerstände reduzieren?
Durch die Anwendung psychologischer Motivationsmodelle können Führungskräfte gezielt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen und deren Akzeptanz für neue Prozesse fördern.
- Citar trabajo
- Thomas Kölblin (Autor), 2013, Change braucht Motivation gegen Widerstände, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214240