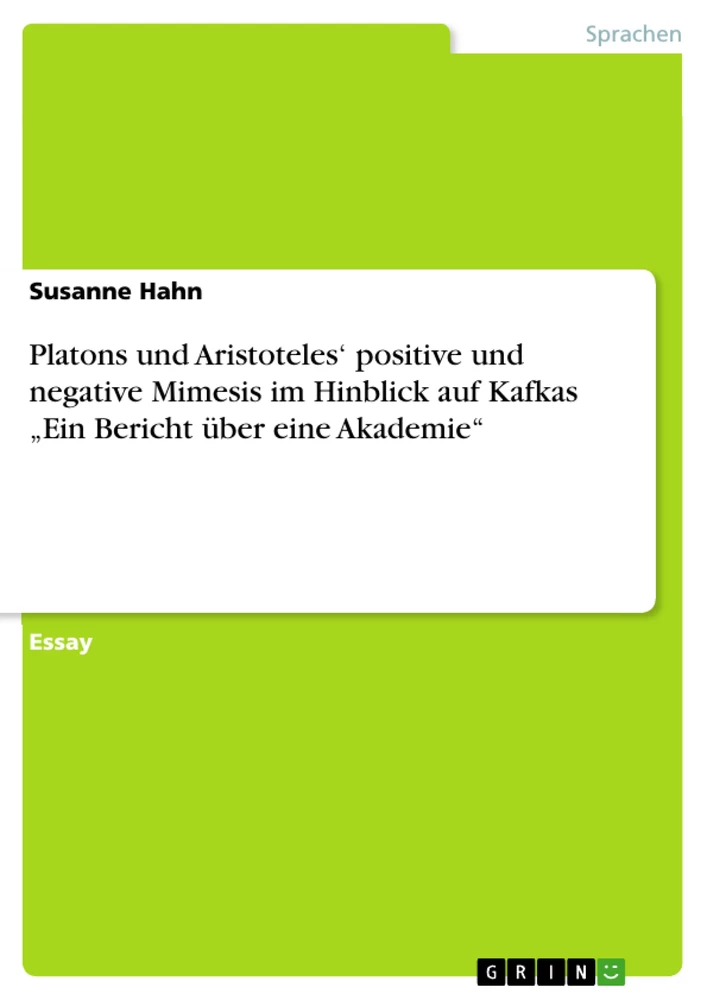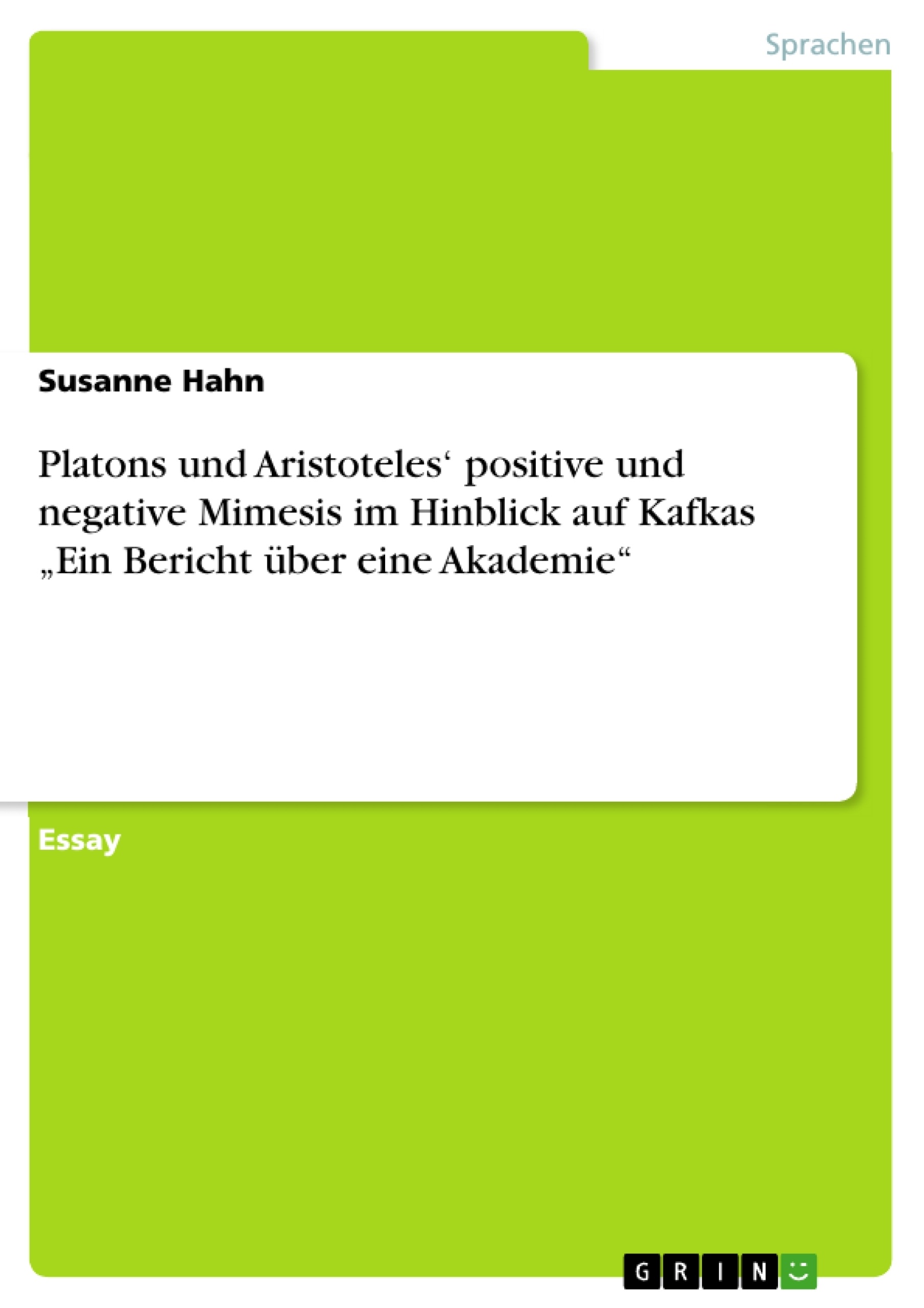Das Essay befasst sich mit der Thematik der positiven und negativen Mimesis aus der Perspektive der Philosophen Platon und Aristoteles. Diese Ansichten werden anschließend auf Kafkas "Ein Bericht über eine Akademie" angewandt.
Platons und Aristoteles‘ positive und negative Mimesis im Hinblick auf Kafkas „Ein Bericht über eine Akademie“
Im Alltag begegnen uns immer wieder mimetische Handlungen: Kleinkinder ahmen die Menschen in ihrer Umgebung nach und lernen dadurch das Gehen und Sprechen oder Teenager suchen sich Idole und versuchen diesen in Äußerlichkeiten nachzueifern. Mimesis lässt sich jedoch nicht nur im Privaten finden, sondern auch in der Öffentlichkeit, in der aktuelle Modestile nachgeahmt werden, Landschaften oder Objekte von Künstlern auf Leinwand gebannt oder Lieder komponiert werden, welche die Stimmungen und Emotionen der Komponisten nachahmen und wiederspiegeln.
Das Mimetische scheint allgegenwärtig zu sein, doch ist das nicht nur heutzutage der Fall, sondern bereits seit Jahrtausenden. Denn bereits seit der Antike befassen sich Theoretiker und Philosophen immer wieder mit dem umstrittenen Prinzip der Mimesis im Bereich der Künste.[1] Der altgriechische Begriff mímésis bezeichnet die Form der Nachahmung bzw. die Darstellung der Wirklichkeit.[2] Die Funktion der Wiedergabe des Realen bildet die Grundlage der Streitigkeiten um die Bedeutung der Mimesis, da es Befürworter gibt, die das Mimetische als etwas Natürliches und Förderndes empfinden, wohingegen Ablehner der Nachahmung eine Gefahr für die Seele in ihr sehen.
Bezug zur Mimesis nahmen in der Antike die beiden griechischen Philosophen Platon und Aristoteles, die durch ihre nacheinander publizierten Texte verdeutlichen, welche unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema bestehen. In seinem berühmten Dialog ‚Der Staat / Politeia‘, welches er um 370 v. Chr. publizierte, geht Platon auf seine Skepsis gegenüber der durch die Kunst vermittelnden Erkenntniswerte ein. Nach Platon ist jede Form der Kunst, darunter insbesondere die Dichtkunst und die Malerei, zwiespältig zu betrachten und im größeren Sinne unnötig. Er erläutert, dass ein Maler zwar eine Nachahmung eines Stuhles auf Leinwand abbilden kann, doch das nicht das Abbild der Realität ist, sondern nur das Abbild eines Abbildes. Was er damit versucht zu erklären ist, dass der Maler nur abbildet, was er wahrnehmen kann. Er selbst hat „[…] weder Wissen noch eine richtige Meinung […]“[3] über das Objekt, welches er malen möchte. Das wahrgenommene Objekt ist der Stuhl, der von einem Tischler hergestellt wurde. Dieser Tischler hat die Wirklichkeit nachgeahmt, indem er das „[…] in der Natur vorhandene […]“[4], d.h. die von Gott erschaffene Idee und Vorstellung eines Stuhles, nachgebaut hat. Der Tischler sieht demnach eine Idee und formt diese mimetisch in einen Stuhl um und spiegelt dadurch die Wahrheit nieder. Der Künstler wiederum bildet nur die Nachahmung ab, in dem sie nachgeahmt wird. Die Problematik die Platon hierbei sieht ist, dass Kunst nur noch ein Abbild eines Abbildes entwickelt, sich immer mehr von der Realität der eigentlichen Ideen entfernt und die „[…] Nachahmunskunst […] weit vom Wahren entfernt […]“[5] ist.
[...]
[1] Vgl. Brockhaus (2010), Band 14, S. 4976.
[2] Vgl. Ebenda.
[3] Platon (1961), Der Staat, S. 395.
[4] Ebenda, S. 388.
[5] Ebenda, S. 390.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff Mimesis?
Mimesis stammt aus dem Altgriechischen und bezeichnet die Nachahmung oder Darstellung der Wirklichkeit, insbesondere im Bereich der Kunst und Literatur.
Warum stand Platon der Mimesis skeptisch gegenüber?
Platon sah in der Kunst nur das „Abbild eines Abbildes“. Da die materielle Welt bereits eine Nachahmung der göttlichen Ideenwelt ist, entfernt sich die Kunst nach Platon noch weiter von der Wahrheit und ist daher potenziell täuschend.
Wie unterscheidet sich Aristoteles’ Sicht auf die Nachahmung von Platons?
Aristoteles betrachtete Mimesis als etwas Natürliches und Menschliches. Für ihn ist die Nachahmung ein Lernprozess und ein Mittel zur Erkenntnis, das dem Menschen Freude bereitet.
Wie wird Mimesis in Kafkas „Ein Bericht über eine Akademie“ thematisiert?
In Kafkas Werk ahmt der Affe Rotpeter die Menschen nach, um einen „Ausweg“ aus seinem Käfig zu finden. Diese Form der Mimesis wird als Überlebensstrategie und Prozess der (erzwungenen) Assimilation analysiert.
Gibt es Beispiele für mimetisches Verhalten im Alltag?
Ja, Kleinkinder lernen durch das Nachahmen von Erwachsenen das Sprechen und Gehen. Auch Trends in der Mode oder das Nacheifern von Idolen sind Formen alltäglicher Mimesis.
- Quote paper
- Susanne Hahn (Author), 2012, Platons und Aristoteles‘ positive und negative Mimesis im Hinblick auf Kafkas „Ein Bericht über eine Akademie“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214397