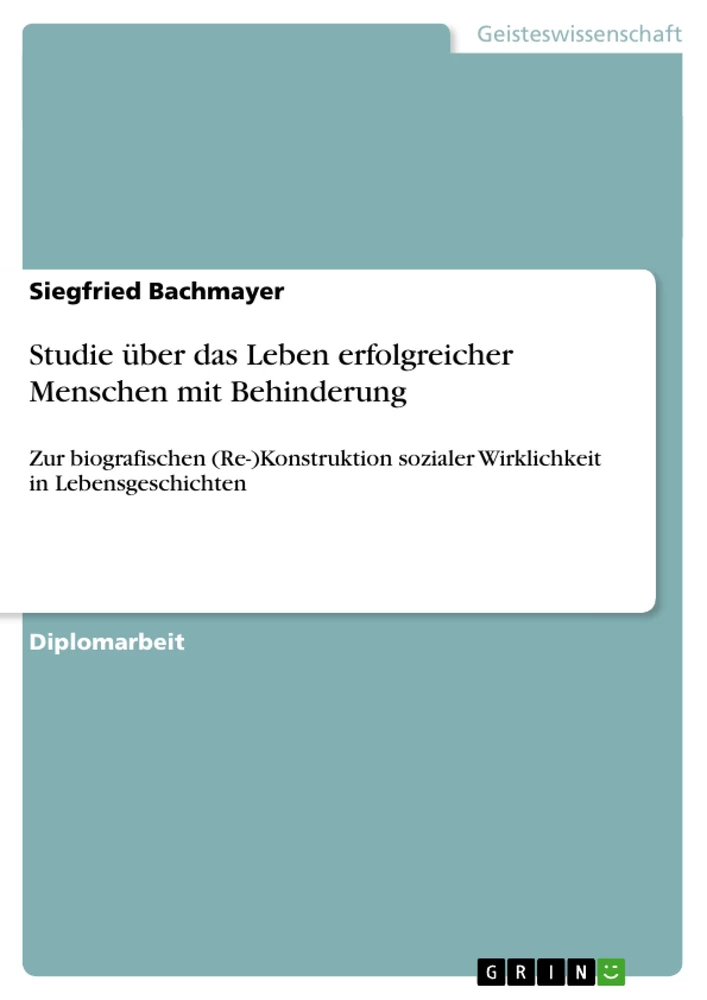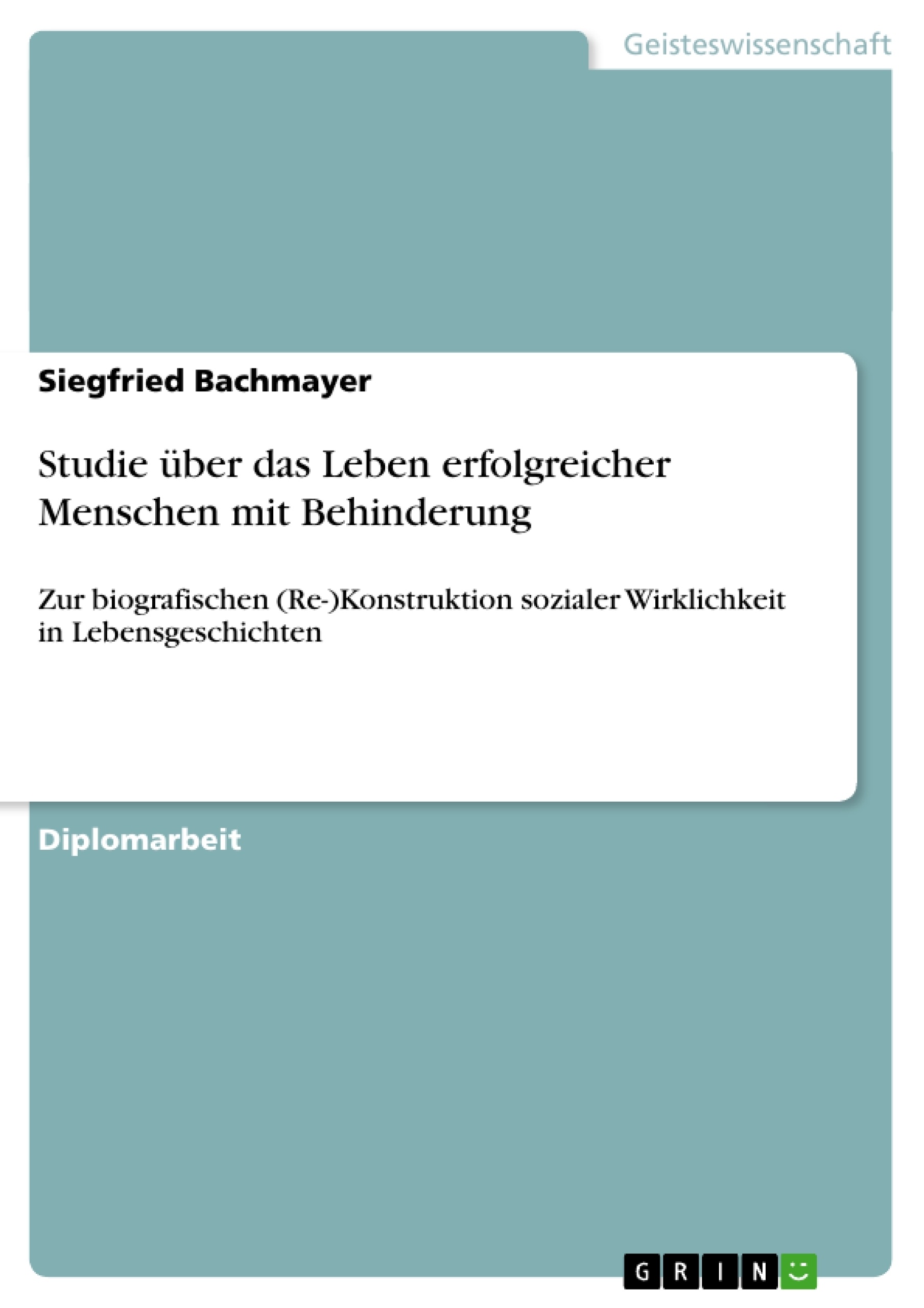Das Thema der vorliegenden Arbeit begleitet mich unbewusst schon seit meiner Kindheit. Ich sehe hier auf meine eigene Vergangenheit zurück und erarbeite daraus den roten, objektiven Faden der Diplomarbeit.Leider ist das von mir ausgewählte Thema in der wissenschaftlichen Literatur kaum bekannt und fast nicht greifbar. Doch es finden sich unzählige einzelne Themen wie Motivation, Behinderung, Sozialisation, Faktoren des Erfolgs usw.,zu denen es jeweils viele Forschungsarbeiten gibt. Die Zusammenstellung all dieser Themen in einem „Werk“ existiert hingegen in der wissenschaftlichen Literatur bislang noch nicht.Ich halte es aber für wichtig, dass die Gesellschaft über die erfolgreichen Menschen mit Behinderungen mehr erfährt und somit eventuell ein besseres, tiefer gehendes Verständnis für sie entwickeln kann. Ich möchte mehr über die im Sozialumfeld befindliche Persönlichkeit mit dem Quasi-Status und den (noch wichtigeren) sozial umgebenden Faktoren – je nach Lebensabschnitt wie Kindheit im Familienumfeld, Eintritt in den Kindergarten sowie Schul- und Berufslaufbahn – erfahren. Sie sind entscheidend im biografischen Werdegang des einzelnen Individuums. Man spricht in diesem Zusammenhang von Sozialisation. Dazu gehört die Behinderung gesellschaftlicher Akteure,die trotz „funktionaler Einschränkungen“ ihren biografischen Werdegang erfolgreich meistern.Die Behinderung ist ein sozialer Erscheinungsfaktor bzw. eine soziale Begleiterscheinung, die nicht geheilt werden kann und von der betreffenden Person als Selbstverständlichkeit angenommen wird. Diese selbstverständliche Annahme ist die einzige Chance, die eigene Behinderung zu akzeptieren.Erst durch diese Annahme kann die betreffende Person mit Behinderung sich Ziele setzen und somit den eigenen Werdegang und die Lebensgestaltung planen.Im Kontext der vorliegenden Arbeit interessiert mich also die Entstehung von erfolgreicher Selbstverwirklichung und den (sozialumgebenden) Erfolgsfaktoren.Wenn man das genauer betrachtet, glaubt man, dass die Person mit Behinderung eine besondere Form der Anerkennung für ihre Leistung verlangen würde.Darum geht es aber nicht,sondern darum, dass die Behinderung an sich als Unsicherheitsfaktor für viele ohne Behinderung schwer zu akzeptieren ist;das ist in der Gesellschaft fest verankert. Die Diplomarbeit versucht nun,auch die Hintergründe für diese Tatsache zu untersuchen und die Frage zu beantworten, warum diese Vorurteile noch immer so stark in der Gesellschaft verankert sind.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Einleitung
Problemstellung
Beschreibung methodischer Ausführungen
Teil I
Theoretischer Rahmen
Kapitel
Sozialisation
Kapitel
Behinderung
2.1 traditionelles Begriffsverständnis
2.2 Empowerment
2.3 Inklusion
2.4 Kompensation
2.4.1 Medizinische und psychologische Aspekte/Dimensionen
2.4.2 Kompensationsstrategie
2.5 Einstellung der Menschen mit Behinderung gegenüber den Behinderten
2.6 Zusammenfassung und Abwehr gegen den gesellschaftlichen Status als
Behinderte
Kapitel
Eigenschaften der Selbstverwirklichung
3.1 Unabhängigkeit, Wille
3.2 Selbstverwirklichung
3.3 Fazit
Kapitel
Realisierung der Ziele
Teil II
Methodische Überlegungen
Kapitel
Qualitative und interpretative Sozialforschung
5.1 Einführung
5.2 Charakteristika qualitativ-interpretativer Forschung
5.3 Explorative Studie
5.3.1 Höhere Validität in der explorativen Studie
5.4 Methodenauswahl
5.4.1 Spezifisch biografische Perspektive
5.4.2 Soziologisches Verstehen
5.4.3 (Re-)Konstruktion von Handlungsmustern zur sozialen Wirklichkeit
Kapitel
Der Forschungsprozess
6.1 Organisation für die Forschungsgespräche
6.2 Umgang mit dem Material
6.3 Kodieren
6.3.1 Offenes Kodieren
6.3.2 Vorgehensweise des offenen Kodierens
6.4 Auswertungen der Daten
6.4.1 Unterschied zwischen der wissenschaftlichen und alltäglichen Interpretation
6.5 Eisbergmodell nach den hermeneutischen Prinzipien
6.6 Validierung
Teil III
Fallgeschichten
Kapitel
Fallgeschichte 1: F.H
7.1 Lebensgeschichte
7.2 Sozialisationsprozess
7.3 Umgang mit der Bewältigungsstrategie
7.4 Selbstverwirklichung
7.5 Fazit / Falltypisierung
Kapitel
Fallgeschichte 2: H.J
8.1 Lebensgeschichte
8.2 Sozialisationsprozess
8.3 Historische Entwicklung
8.4 Fazit / Falltypisierung
Kapitel
Fallgeschichte 3: J.H
9.1 Lebensgeschichte
9.2 Sozialisationsprozess
9.3 Kompensationsstrategien gegen Barrieren
9.4 Lebenswandel
9.5 Fazit / Falltypisierung
Teil IV
Resumé
Kapitel
Auswertung
10.1 Zusammenstellung der zentralen Aspekte erfolgreicher Zielrealisierung behinderter Menschen
10.1.1 Bildung des gesellschaftlichen Status
10.2 Persönlichkeit und ihre Entwicklung in der Sozialisation
10.2.1 Zusammenfassung und Tabellenaufstellung der persönlichen
Merkmale aller Fälle
10.2.2 Umgang mit sich selbst und mit anderen
10.2.3 Ein modernes Begriffsverständnis von Behinderung
10.2.4 Stigmatisierungsgefahr
10.2.5 Entstehung einer Beziehungsform in der Situation
10.3 Befriedigung der Bedürfnisse und Selbstakzeptanz
10.4 Individuelle Anpassung und Entwicklung
10.4.1 Erziehungsstile der Eltern
10.4.2 Willensbildung und Kampfbereitschaft
10.5 Realisierung der Ziele
10.6 Inklusion und Teilhabe an der Gesellschaft
10.7 Erfolgreiche Strategien der interviewten Persönlichkeiten mit
Behinderungen
10.8 Antworten auf die Forschungsfragen
Kapitel
Zusammenfassung und Ausblick
11.1 Zusammenfassung
11.2 Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Phasen der Sozialisationsprozesse
Abbildung 2: Einflusssphären und Ebenen
Abbildung 3: Kompensation
Abbildung 4: Zusammenstellung der zentralen Aspekte erfolgreicher Zielrealisierung behinderten Menschen
Abbildung 5: Lebens(aufgaben)gestaltung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Ursachen für ein Ungleichgewicht
Tabelle 2: Tabellenaufstellung der persönlichen Merkmale aller Fälle
Tabelle 3: Umgang mit sich selbst und mit den Anderen
Tabelle 4: Merkmale der Realisierung der Ziele
Tabelle 5: Aspekte bei der Situation des schulischen Aufnahme-Verfahrens
Tabelle 6: Ermöglichende Umstände im sozialen Umfeld und Handlungsstrategien erfolgreicher Menschen mit Behinderung
Tabelle 7: Die Bedeutung innerer Haltungen für die Realisierung selbst
gesetzter Ziele
Tabelle 8: Umgang mit Kritik und Ablehnung
Mein Körper ist das genaue Gegenteil einer Utopie,
das kleine Stück Raum, mit dem ich buchstäblich eins bin.
Mein Körper ist eine gnadenlose Topie.
(Foucault 2005: 25)
Vorwort
Ausgangspunkt für mein Thema war der Gedanke, dass es verwunderlich ist, wie viele Menschen ohne Behinderung mit behinderten Menschen in einer Weise umgehen, die nicht anerkennt, dass behinderte Menschen keine Besonderheit darstellen, sondern ebenfalls ein selbstbestimmtes Leben führen können. Denn für die behinderten Menschen ist das eine Selbstverständlichkeit. Sie empfinden ihre Behinderung nicht als ein Hindernis und wissen genau, was sie wollen.
Allerdings besagt das Gesetz[1], dass Menschen mit Behinderung oder besser gesagt behinderte Menschen einer speziellen Gruppe zugeordnet werden sollen. Sie werden vom Land und vom Staat in fürsorglicher Tradition versorgt, weil sie den gesellschaftlichen Standards, die aus der Zeit des Faschismus stammen und noch heute prägend sind, nicht entsprechen würden und deshalb benachteiligt seien. Von diesen Zuwendungen abhängig lebt die Gruppe der Behinderten auf Lebenszeit. Das ist ein sozial- bzw. behindertenpolitischer und fürsorglicher Aspekt, der allerdings auch seine Nachteile hat, wie zum Beispiel die Nicht-Anerkennung und Bevormundung der Behinderten als gleichberechtigte Menschen durch die Menschen ohne Behinderung. In der vorliegenden Arbeit werde ich jedoch nicht näher auf diese Gegebenheiten eingehen. Stattdessen konzentriere ich mich auf die Menschen mit Behinderungen, die ihre Unabhängigkeit wahren und ihr Leben erfolgreich und unabhängig meistern. Unter der gesetzlichen Zuordnung verstehe ich, dass der Staat Gesetze gemacht und dafür die Kategorie der Behindertengruppe eingeführt hat. Alle, die eine Behinderung vorweisen, haben gesetzliche Ansprüche auf diverse Unterstützungen. Darum geht es um die selbstständigen Personen, die keiner sozial oder kulturell bedingten Statuszugehörigkeit dieser Behindertengruppe zugeordnet sind. Das behaupten zumindest die erfolgreichen Menschen mit Behinderungen. Sie agieren unabhängig von den Unterstützungsmaßnahmen und haben klare Vorstellungen von ihrer Lebensgestaltung. Jedermann steht in der normalen, (un)auffälligen, demokratischen und bürgerlich-freien Gesellschaft auf gleicher Augenhöhe. Aus diesem Grund haben erfolgreiche Personen mit unterschiedlichen Behinderungen ein gesellschaftliches Ansehen erworben. Ein Ziel meiner Arbeit ist es, den biografischen Hintergrund ihrer an Lebenserfahrung reichen Geschichten auszuleuchten und herauszufinden, wie und wann diese Personen erkannt haben, Chancen zu nutzen und etwas verändern zu wollen.
Jede Biografie wird geprägt durch die sozialen Bedingungen, die Menschen vorfinden, und den Umgang, den sie selbst damit entwickeln können. In dieser Wechselwirkung entstehen alle Biografien. So lässt sich auch das Leben der fallbezogenen Person nicht allein durch die äußeren Umstände oder ihre Behinderung erklären, da all diese Faktoren sich wechselseitig bedingen. Beispielhaft für die sehr unterschiedlichen Faktoren, die eine Rolle spielen, greife ich drei Dinge heraus: Erstens ist Interviewmaterial der interviewten Personen, in dem sie ihre Situationen beschreiben und über ihren Werdegang erzählen, zu beachten. Zweitens ist das Einbeziehen der sozialen Hintergründe der gesellschaftlichen Situation von den Menschen mit Behinderungen von Bedeutung und drittens ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Belege von der faktischen Welt in der Biografie eingebettet sind – sie zu verstehen und zu erklären ist mein Ziel. In diesen drei Bereichen werden Faktoren gefunden, die für das fallbezogene Leben und die Lebensgestaltung, den Umgang des Menschen mit seiner Behinderung, mit seinen Mitmenschen und der Arbeit wie z. B. der Realisierung der Ziele wichtig waren. Um das näher zu verstehen und zu erklären, sind die sozialwissenschaftlichen Dimensionen und Aspekte wichtig. Vor diesem Hintergrund der wechselseitigen Bedingungen komme ich zur folgenden Diplomarbeits- und Forschungsfrage:
Wie haben die Menschen mit Behinderungen,
die sich Ziele gesetzt hatten, diese erreicht?
Ausgehend von dieser Frage werde ich versuchen, die Hintergründe, den biografischen Werdegang (die primäre, sekundäre und tertiäre Sozialisation) sowie die persönliche Haltung dieser erfolgreichen Menschen mit Behinderungen (Welche Durchsetzungsstrategien verwenden sie und wie gehen sie mit sich selbst und den anderen um?) mittels qualitativ-interpretativer Methode soziologisch zu verstehen und zu erklären.
Linz, März 2013
Einleitung
Das Thema der vorliegenden Arbeit begleitet mich unbewusst schon seit meiner Kindheit. Ich sehe hier auf meine eigene Vergangenheit zurück und erarbeite daraus den roten, objektiven Faden der Diplomarbeit.
Leider ist das von mir ausgewählte Thema in der wissenschaftlichen Literatur kaum bekannt und fast nicht greifbar. Doch es finden sich unzählige einzelne Themen wie Motivation, Behinderung, Sozialisation, Faktoren des Erfolgs usw., zu denen es jeweils viele Forschungsarbeiten gibt. Die Zusammenstellung all dieser Themen in einem „Werk“ existiert hingegen in der wissenschaftlichen Literatur bislang noch nicht. Ich halte es aber für wichtig, dass die Gesellschaft über die erfolgreichen Menschen mit Behinderungen mehr erfährt und somit eventuell ein besseres, tiefer gehendes Verständnis für sie entwickeln kann.
Ich möchte mehr über die im Sozialumfeld befindliche Persönlichkeit mit dem Quasi-Status[2] und den (noch wichtigeren) sozial umgebenden Faktoren – je nach Lebensabschnitt wie Kindheit im Familienumfeld, Eintritt in den Kindergarten sowie Schul- und Berufslaufbahn – erfahren. Sie sind entscheidend im biografischen Werdegang des einzelnen Individuums. Man spricht in diesem Zusammenhang von Sozialisation. Dazu gehört die Behinderung gesellschaftlicher Akteure, die trotz „funktionaler Einschränkungen“ ihren biografischen Werdegang erfolgreich meistern. Die Behinderung ist ein sozialer Erscheinungsfaktor bzw. eine soziale Begleiterscheinung, die nicht geheilt werden kann und von der betreffenden Person als Selbstverständlichkeit angenommen wird. Diese selbstverständliche Annahme ist die einzige Chance, die eigene Behinderung zu akzeptieren. Erst durch diese Annahme kann die betreffende Person mit Behinderung sich Ziele setzen und somit den eigenen Werdegang und die Lebensgestaltung planen. Im Kontext der vorliegenden Arbeit interessiert mich also die Entstehung von erfolgreicher Selbstverwirklichung und den (sozialumgebenden) Erfolgsfaktoren. Wenn man das genauer betrachtet, glaubt man, dass die Person mit Behinderung eine besondere Form der Anerkennung für ihre Leistung verlangen würde. Darum geht es aber nicht, sondern darum, dass die Behinderung an sich als Unsicherheitsfaktor für viele ohne Behinderung schwer zu akzeptieren ist; das ist in der Gesellschaft fest verankert. Die Diplomarbeit versucht nun, auch die Hintergründe für diese Tatsache zu untersuchen und die Frage zu beantworten, warum diese Vorurteile noch immer so stark in der Gesellschaft verankert sind.
Problemstellung
Im Folgenden möchte ich knapp die gesellschaftspolitischen und sozialen Hintergründe, die für die Problemstellung dieser Diplomarbeit wichtig sind, vorstellen. Ein großes Problem sind nach wie vor die Schwierigkeiten mit den Nichtbetroffenen, die gar keine oder nur sehr wenig Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen haben oder unter persönlichen Ängsten aufgrund fehlender Erfahrungs- bzw. Klarstellungsinformationen leiden. Es gibt drei Gruppen von Nichtbetroffenen:
1. Die Nichtbetroffenen, die Zugang zur Behindertenszene haben und dort ihre Ängste überwinden oder lernen, wie sie damit umgehen (und so mit der Zeit lernen, die behinderten Menschen zu akzeptieren).
2. In der zweiten Gruppe nehme ich an, dass es zwei Untergruppen gibt: Eine der beiden Subgruppen verschließt ihre Augen und die andere Subgruppe hat niemals mit behinderten Menschen zu tun (vielleicht unbewusst). Diese Beobachtung führt mich zur Frage, ob der Grund dafür in erster Linie Angst, ein öffentliches Informationsdefizit oder vielleicht beides ist, Darauf werde ich später noch zurückkommen.
3. Die Nichtbetroffenen, die berufliche oder familiäre Erfahrungen haben und mit den behinderten Menschen (oder auch Menschen mit Behinderungen)[3] tätig sind. Sie beschäftigen sich mit den behinderten Menschen von der mikro- bis zur mesogesellschaftlichen Ebene, auch mit denjenigen, die pflegebedürftig sind und/oder über keine bzw. nur wenig individuelle Autonomie verfügen und in Heimen oder zuhause leben. Ihnen wurde und wird scheinbar nur ein begrenzter Grad an Selbstbestimmung[4] zugesprochen.
Neben den Grund- und Alltagsbedürfnissen ist die Selbstbestimmung, die individuelle Auswahl und Entscheidung des Betroffenen, mit der persönlichen Entscheidungsfreiheit und dem persönlichen Interesse verbunden. Ist dies nicht der Fall, ist er durch äußere und soziale Einflüsse fremdbestimmt. Damit meine ich, dass er ein Recht auf Leben unabhängig von den Einrichtungen haben sollte. Die andere Gruppe – das sind sehr wenige Menschen mit Behinderungen – verfügt über einen hohen Grad an Selbstbestimmung und ist (nicht) auf die persönliche Assistenz oder andere Dinge angewiesen, die sie unabhängig von der Gesellschaft agieren lassen. Sie handelt autonom und teilt der persönlichen Assistenz mit, wenn sie etwas benötigt. Die sogenannten Bittstellungen bzw. Aufforderungen entsprechen der ausdrücklichen Auftragsanweisung an die persönliche Assistenz, die ausgeführt wird, da die persönliche Assistenz eben vom Staat finanziert wird.
Vor über 30 Jahren hatten die Eltern entweder wenig rechtliche Mittel für ihr behindertes Kind zu erkämpfen oder mussten tatenlos zusehen, wie ihr behindertes Kind zu einem bildungs- und lebenserfahrungsarmen, andersartigen – geschlechtsneutralen – Erwachsenen mit wenigen sozialen Beziehungen heranwächst und durch entsprechend mangelhafte, arme oder perspektivenlose Vorstellungen geformt wird.
Erst ab den frühen 1990er Jahren wurde diese Einstellung durch den Kampf der Eltern behinderter Kinder bzw. von Kindern mit Behinderung im Laufe der Zeit zunehmend verändert, sodass die schulische Integration für diese Kinder als Pilotversuch zum ersten Mal ab 1984/85[5] eingeführt wurde. Hingegen wurde Gebärdensprache als eigenständige Unterrichtssprache nicht erwähnt.
Heute, insbesondere seit dem Jahr 2000, beteiligen sich immer mehr Menschen mit Behinderungen an der gesellschaftlichen Gestaltung und ihrer persönlichen Selbstbestimmung[6]. Immer mehr üben sie ihre angelernten und erworbenen Berufe aus. Interessant ist zu sehen, wie sie trotz Hürden und Problemen in der heutigen Zeit zurechtkommen und das Gesellschaftsbild mit der Zeit sanft verändern.
Die Definition „Einstellung gegenüber behinderten Menschen“[7] änderte sich mit steigender Tendenz zusehends zur „Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung“ und setzte damit teilweise die Re-Formulierung sowie die erweiterte Vertiefungsdefinition und sinngerechte Trennung der Behindertenbegriffe, die in der heutigen Zeit gelten und hier im angeführten theoretischen Rahmen der Diplomarbeit (erster Teil) ein wenig erläutert werden, durch. Außerdem werden die Realisierung der Ziele und teilweise der Lebensaufgabe unter die Lupe genommen. In der Diplomarbeit geht es also um den an Bildung und Lebenserfahrung reichen Erwachsenen mit Behinderung und darum, wie er seine (Lebens-)Ziele realisiert hat.
Beschreibung methodischer Ausführungen
Die methodische Vorgangsweise legt den Grundstein[8] der Diplomarbeit fest, der vorsieht, die Abduktion im Forschungsprozess anzuwenden. Die Abduktion wird in der vorliegenden Arbeit nach Charles Peirce[9] und Gabriele Rosenthal[10] (2008) verwendet, der abduktive Schluss angesetzt, wenn Unbekanntes in der Forschungsarbeit vorgefunden wird. Der abduktive Schluss besteht darin, eine neue Regel zu finden bzw. zu erfinden, die klar macht, was der Fall ist bzw. wie er entstanden ist. Dieser Vorgang ist nicht zwingend für die Aufstellung der Hypothesen am Ende der Forschungsarbeit, weil der abduktive Vorgang, den ich betreiben werde, immer wieder in einem ständig umlaufenden Kreis bzw. im zirkulären Verfahren unbekannter Herkünfte aus dem biografischen Werdegang aller Fallpersonen herausgearbeitet wird. 1. Welche günstigen Maßnahmen bzw. Bedingungen der Eltern waren entscheidend für das Kind mit Behinderung? 2. Welche langfristige Haltung haben die Eltern bzw. Akteure erlangt? 3. Wie beeinflusst die neue Sichtweise der Eltern die Haltung des Kindes nachhaltig?
Teil I
Theoretischer Rahmen
Kapitel 1 Sozialisation
Ich beginne mit der Sozialisation, weil sie den biografischen Verlauf des Individuums erklärt. Sie ist wichtig für die vorliegende Diplomarbeit, in der ich die biografische Methode anwenden werde. Die Sozialisation beginnt mit der Geburt eines Menschen. Der Mensch wird in das soziale Umfeld hineingeboren und wächst dort im Allgemeinen im familiären Bereich auf. Während der Sozialisation, die durch das soziale Umfeld mitbestimmt wird, entscheiden sich gewisse Faktoren, die sich auf die Persönlichkeitsentfaltung und deren Entwicklung auswirken.
Denn tatsächlich könnte eine grobe Definition wie folgt lauten: „Sozialisation meint […] die Gesamtheit der gesellschaftlichen Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen“ (Tillmann 1989: 9). Diese Definition von Sozialisation trifft auch auf behinderte Menschen zu. Das soziale Umfeld ist schlicht alles, was Menschen umgibt, wie Familie, Schule, Nachbarschaft, Dorfgemeinschaft, Nation usw., je nachdem, wo Menschen sich bewegen. Die soziale Umwelt prägt das Sozialverhalten von Menschen auf unterschiedliche Weise, sei es, dass hier bestimmte Werte und Normen vermittelt werden, die ein Mensch internalisiert und sich folglich entsprechend verhält, oder sei es, dass ein Mensch sich von diesen Normen und Werten bewusst abgrenzt. Hier gibt es eine unendliche Fülle, d. h., wahrscheinlich so viele Verhaltensweisen wie Menschen, wobei es ja möglich ist, bestimmte Muster zu erkennen und mit Strukturen zu erklären.
Im Umkehrschluss erklärt die oben angeführte Definition, dass ohne Haltung, ohne familiäre Förderung und insbesondere ohne die mütterliche Liebe die heranwachsenden Menschen möglicherweise hilflos den gesellschaftlichen Konventionen und Strategien ausgeliefert sind und dadurch kein persönliches Ziel verfolgen. Aus diesem Grund ist die primäre Sozialisation das Grundlegende, das Wesentlichste und der entscheidende Kern, der das geistig gesunde Wachstum fördert oder vernachlässigt, der den Menschen zu einem eigenständigen gesellschaftlichen Akteur formt. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Mensch eine Behinderung hat. Es ist wichtig festzuhalten, dass das einfach auf jeden von uns zutrifft.
Persönlichkeit. Im wissenschaftlichen Sinn bedeutet der Begriff Sozialisation, dass eine Korrelation (d. h. eine Wechselwirkung) zwischen Subjekt – sprich der Persönlichkeit – und sozialer Umwelt (= Umgebung, in der die Persönlichkeit heranreift) existiert. Die anerkannte Definition von Sozialisation lautet: „Sozialisation ist begrifflich zu fassen als der Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt […] [sie beschreibt], wie sich der Mensch zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt bildet“ (Tillmann 1989: 10). Tatsächlich beinhaltet diese Formulierung so ziemlich alles, was auf den Menschen in irgendeiner Form Einfluss nimmt. Ein Beispiel: Ein Kleinkind wird von seinen Eltern beeinflusst, ohne dass die Eltern auf die Behinderung ihres Kindes besonders eingehen. Allerdings werden die Eltern und auch das Kind von Nachbarn und Freunden immer wieder auf die Behinderung aufmerksam gemacht, etwa durch das Anbieten von Unterstützung. Die (Erziehungs-)Arbeit der Eltern und die gesellschaftlichen Konventionen der jeweiligen Kultur beeinflussen die Eltern und damit in vermittelter Weise ebenso das Kind. Auch die Spielsachen, also durchaus materielle Dinge, die von der organisierten Gesellschaft produziert wurden, beeinflussen das Kind. Die sozialen Faktoren, die mich schwerpunktmäßig interessieren, stammen im Allgemeinen aus dem familiären und außerfamiliären Sozialumfeld, das den heranwachsenden Mensch beeinflusst. Dabei ist auch die Frage, wie das Kind und die Eltern miteinander umgehen, von Bedeutung. Der Mensch erwirbt die „sozialen Zustände“, um die ihn umgebende Welt beim Erlernen der sozialen Anpassungsfähigkeiten kennenzulernen und dort die Überlebenswerkzeuge für sein Alltagsleben zu erarbeiten. Daraus wird der soziale Zustand im Kind „produziert“. Das untersucht die Sozialisationsforschung. Die Sozialisation beschäftigt sich also mit der Entwicklung des Menschen und den Prozessen dieser Entwicklung, wie sie in Abbildung 1 („Sozialisationsprozesse“) dargestellt sind. Die Sozialisationsforschung selbst fokussiert aber bei der wissenschaftlichen Untersuchung der Einflussfaktoren nur auf Teilbereiche von jenen, die in der Persönlichkeit verankert sind. Die Persönlichkeit hat die sozialen Zustände und Merkmale mit den oben gegebenen Beispielen beim Heranwachsen im Laufe der Zeit verinnerlicht. Schlussfolgernd kann man also festhalten: Der Sozialisationsprozess beschäftigt sich mit den Menschen, mit den einzelnen Individuen, mit den Persönlichkeiten. Was aber macht eine Persönlichkeit aus? Keiner wird leugnen, dass eine Persönlichkeit sich aus mehr als den nur nach außen hin sichtbaren Äußerungen und ideologisch sozial genormten oder persönlich entschiedenen Handlungen konstituiert. Keiner wird leugnen, dass eine Persönlichkeit in erster Linie durch inneres Empfinden und Denken (geprägt durch die gesammelte Lebenserfahrung) sowie durch die sozialumgebenden Faktoren entsteht. Wissenschaftlich definiert sich der Begriff Persönlichkeit wie folgt: „Mit Persönlichkeit wird das einem Menschen […]“ (dabei spielt eine Behinderung keine Rolle) „[…] spezifische organisierte Gefüge von Merkmalen, Eigenschaften, Einstellungen und Handlungskompetenzen bezeichnet, das sich auf der Grundlage der biologischen Ausstattung als Ergebnis der Bewältigung von Lebensaufgaben jeweils lebensgeschichtlich ergibt“ (Hurrelmann 1990: 14). D. h., alle Einflüsse, die der Persönlichkeit zukommen, können nicht erfasst werden, weil die Wissenschaft nicht allen auf die Spur kommen kann, weil sie nach z. B. sozialen Einflüssen nur innerhalb des theoretischen Rahmens, den sie sich vorzugeben behauptet, suchen kann. Die Einflüsse werden wortbegrifflich in einem Forschungsfeld aufgestellt und sichtbar gemacht.
Erziehung. Die Erziehung, nicht die Behinderung, wiederum ist der zweite große Part, der in der Sozialisationsforschung immer wieder berücksichtigt wird. „Erziehung bezeichnet nur einen Teil derjenigen gesellschaftlich vermittelten Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung, die unter den Begriff Sozialisation fallen, nämlich die bewussten und geplanten Einflussnahmen“ (Hurrelmann 1990: 14). Die Erziehung ist sozusagen der gesellschaftlich abgesteckte oder der familiär gestaltete Rahmen von Sozialisation, der auf die Persönlichkeit mit Behinderung einwirkt und dadurch den Sozialisationsprozess wesentlich prägen soll. Im Rahmen der Erziehungsthematik möchte ich auch darauf hinweisen, dass es verschiedene Phasen der Sozialisationsprozesse gibt, wie man anhand von Abbildung 1 (siehe unten) sehen kann.
Abbildung 1: Phasen der Sozialisationsprozesse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine graphische Darstellung, in der die verschiedenen Einflusssphären genannt und nach Ebenen eingeteilt werden, sieht folgendermaßen aus:
Abbildung 2: Einflusssphären und Ebenen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
All diese Bereiche (mit beiden Spalten je Ebene) in Abbildung 2 stehen in Korrelation zueinander. Meiner Meinung nach ist das so bedeutend, weil die verschiedenen Ebenen als Lebensabschnittsphasen (wie bereits in Abbildung 1erläutert und dargestellt) im Sozialisationsprozess vom Subjekt wegführen, was das die hohe Relevanz der individuellen Erfahrung und Verarbeitung von Dingen anzeigt. Jede Ebene korreliert mit den jeweiligen Komponenten, Subjekte sind einzelne Individuen und erwerben Erfahrungen und Einstellungen wie oben dargestellt. Wenn beispielsweise zwei Menschen genau dasselbe erleben, werden sie es jeweils anders wahrnehmen, es auch anders wiedergeben und es wird ihre Entwicklung auch anders beeinflussen, da Erfahrungen eben eine hochgradig individuelle Angelegenheit sind. Jede Ebene versucht, die Verbindungen zwischen Gesellschaft und Persönlichkeit darzulegen. Sie beschäftigt sich somit mit der Komplexität der Makro- (Gesamtgesellschaft) und der Mikroebene (Individuum). Die „Sozialisation ist ein real existierender, aber in der Realität nicht dinghaft greifbarer Untersuchungsgegenstand. Eine Modellvorstellung, die als Kristallisationspunkt für erkenntnisleitende Orientierungen und Annahmen dient, macht diesen komplexen Untersuchungsgegenstand gewissermaßen begrifflich verfügbar“ (Hurrelmann 1990: 18).
Fazit. Nachdem mir die Sozialisation in ihrer theoretischen Weise erklärt wurde, weiß ich, dass das Individuum drei Sozialisationsabschnitte durchmacht: Während der primären Sozialisationsphase wird das Individuum in das familiäre Umfeld hineingeboren; dort lernt es seine soziale Umgebung innerhalb der Familie kennen und erlernt die grundlegenden Überlebenswerkzeuge, um zu kommunizieren, sich anziehen, essen oder spielen zu können. In der sekundären Sozialisationsphase geht es in den Kindergarten und schließlich zur der Schule. Diese beiden öffentlich anerkannten Institutionen der österreichischen Gesellschaft erfüllen die Unterrichtspflichten für den heranwachsenden Akteur und vermitteln ihm die notwendigen Lern-, Instrument- und Umgangstechniken sowie Normen und Werte innerhalb der Institution. Dort werden dem Akteur die Unterrichtsabläufe und Aufgaben unter Berücksichtigung der dort vorherrschenden Regeln beigebracht, die erfüllt werden müssen. Während des letzten Sozialisationsabschnitts, der sogenannten tertiären Sozialisation, steigt der Akteur zur Erlernung des Berufs bzw. der Berufsbildung auf. Es findet also jede Sozialisationsstufe des Menschen in einer Mikrogesellschaft statt, sodass der zukunftsweisende, entscheidungsfindungs- und lebensgestaltungsorientierte Weg jedes handlungs- und lernfähigen Individuums durch das Sozialumfeld der Familie und der Bildungsinstitutionen „gesteuert“ bzw. beeinflusst wird. Die Reaktion und Wahrnehmung einzelner Individuen sind recht unterschiedlich. Im Folgenden möchte ich mich auf die Behinderung und ihre sozialen Einflüsse auf die Umgebung in der Außenwelt und umgekehrt konzentrieren.
Kapitel 2 Behinderung
Was ist Behinderung eigentlich? Für manche Nichtbehinderte erscheint Behinderung als eine Strafe Gottes, andere wiederum ekeln sich oder empfinden Mitleid.
J.H.: „[…] Ähm, Behinderung war damals noch zum Teil eine Strafe Gottes, […] ähm, der wurde damals von seinen Eltern weggesperrt als blindes Kind. […]“
Meiner Ansicht nach ist Behinderung weder eine Strafe noch ekelhaft, diese Meinungen sind vielmehr eine „schief geratene“ Perspektive der Nichtbehinderten, die die Behinderung gesellschaftshistorisch einfach „leugnen“. Behinderungen werden aus zwei Perspektiven wahrgenommen, einerseits als Grad misslungener Funktionalität am/im Körper des Menschen und andererseits als eine „fundierte grundlegende Lehre“, die manchmal als gesellschaftliche Ideologie vorkommt. Diese zweite Ansicht soll in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt werden, da dieser Begriff von Behinderung zu meinem Forschungsgegenstand eigentlich nicht dazugehört.
Im folgenden Unterkapitel wird der traditionelle Begriff „Behinderung“ kurz dargestellt. Danach folgen verschiedene Begrifflichkeiten von Umgangs- und Einsatzformen im sozialen Umfeld, in dem das einzelfallbezogene Individuum lebt, seine Aufgaben bewältigt und seine (situationsbedingte) Haltung aufrechterhält sowie verteidigt.
Das Kapitel „Behinderung“ wird hier nur sehr grob umrissen, weil es nicht der Schwerpunkt der Diplomarbeit ist. Mich interessieren aber die mikrogesellschaftlichen Effekte auf die Behinderung des Akteurs (mit gesundem Verstand) im sozialen Umfeld, ebenfalls die weiteren Effekte auf die Außenstehenden aus der Perspektive des Menschen mit Behinderung, also wie die (Nicht-)Behinderten mit der Behinderung umgehen. Die modernen Begriffe wie etwa Empowerment, Kompensation, Inklusion und Teilhabe an der Gesellschaft entsprechen dem internationalen Standard. In der internationalen Behindertenszene sind sie praxisrelevant.
2.1 traditionelles Begriffsverständnis
In der vorliegenden Arbeit gehe ich vom traditionellen Begriffsverständnis aus, da dieses der materiellen Gesellschaftstheorie[11] von Marx und Engels entstammt. Nach ihm wurde ein Rehabilitations- bzw. Behindertenkonzept (vgl. Bundesministerium f. Arbeit und Soziales 1993[12]) entwickelt. Dieses Konzept verfolgt das Ziel, Maßnahme und Institution – und somit Bestandteil einer sozial vrpflichteten Gesellschaft – zu sein; damit wird es zum Prüfstein des Sozialstaates (vgl. Steiner et al. 2006: 5). Das Ziel der Rehabilitation ist, die Folgen von Erkrankungen, Störungen oder Schädigungen zu bewältigen und die vollwertige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird auf Maßnahmen im medizinischen, beruflichen, pädagogischen und sozialen Bereich zurückgegriffen (ebd.). Mit der Forderung einer verstärkten Integration der „sozialen Rehabilitation“ wird bereits zu Beginn der rehabilitativen Maßnahmen die Bedeutung der Sozialen Arbeit und ihrer Profession verstärkt in das Zentrum der Rehabilitation gerückt. „Soziale Arbeit in der Rehabilitation hat […] die Aufgabe, persönliche, familiäre, berufliche und soziale Probleme von Rehabilitanden, die im Zusammenanhang mit der Erkrankung bzw. Behinderung stehen und das Leben erschweren, aufzugreifen und zu einer Verbesserung der Gesamtsituation und des Wohlergehens der Betroffenen beizutragen“ (Mühlum und Gödecker-Geenen 2003: 42).
Freckmann (2006) definiert zitierend nach Jäger (2002): „Die Erscheinung Behinderung umfasst sowohl eine Schädigung (= impairment) als auch funktionelle Beeinträchtigungen (= disability), die sich drittens als Lebenserschwerung (= handicap) im sozialen Feld auswirken“ (Freckmann 2006: 7). Man geht also davon aus, dass es entscheidend ist, ob und ggf. welche positiven und negativen Folgen der Verlust oder die Einschränkung von Körper- und Sinnesfunktionen bzw. die Selbstfindung oder Entwicklung der für die Behinderung geeigneten Kompensationsstrategien auf die Begabungs- bzw. Persönlichkeitsentfaltung hat oder voraussichtlich haben wird (vgl. ebd.). Im traditionellen von Bach (1997) entwickelten Begriffsverständnis von Behinderung sind bestimmte Kinder und Erwachsene gemeint, die folgende Beeinträchtigungen aufweisen: 1. Behinderungen im sprachlichen Bereich, z. B. Dysgrammatismus[13], Sprachentwicklungsverzögerungen; 2. Behinderungen im sozial-emotionalen Bereich, z. B. Aggressionen, Ängstlichkeit; 3. Behinderungen im kognitiven Bereich, z. B. Auffassungs- und Merkschwächen; 4. Behinderungen im sensorischen Bereich, z. B. Schwerhörigkeit, Sehschwächen; 5. Behinderungen im motorischen Bereich, z. B. fein- oder grobmotorische Probleme.
An dieser Stelle wird nun aber auf die Schädigungsfunktionen der Behinderung nicht mehr näher eingegangen, sondern der Schwerpunkt auf die folgenden Themen gelegt, die zwar in der österreichischen Makrogesellschaft nur wenig bekannt, aber in der internationalen Behindertenszene hochaktuell sind.
2.2 Empowerment
Der Begriff Empowerment stammt aus den USA (Simon 1994). Übersetzt werden könnte er mit „Selbst-Bemächtigung“ oder „Selbstbefähigung“. Hinter dem Begriff Empowerment verbergen sich eine Philosophie, theoretische Annahmen und Leitideen wie auch Prozesse, Programme, Konzepte oder Ansätze, die mit Blick auf die Arbeit im sozialen und gesellschaftlichen Bereich auf die „Gewinnung […] von Stärke, Energie und Fantasie zur Gestaltung eigener Lebensverhältnisse“ (Lenz 2009: 13) hinauslaufen oder „vorhandene Stärken von Menschen in gesellschaftlich marginaler Position (z. B. soziokulturell Benachteiligte, ethnische Minderheiten, allein erziehende Frauen, Menschen mit einer psychischen Krankheit oder mit einer Behinderung, Familien mit behinderten Angehörigen) zu ihrem Ausgangspunkt machen, zu tragfähigen Formen kollektiver und autonomer Selbsthilfe-Zusammenschlüsse wie sozialer Netzwerke anstiften“ (Simon 1994: 13f.) und die „Gewinnung von Selbstbestimmungsfähigkeiten und Kompetenzen (Zuständigkeiten) zur Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebenszustände zum Ziel haben“ (Simon 1994: 13f.). Für die Menschen mit Behinderungen, die ihre Ziele realisiert haben, ist es eine Voraussetzung, ein gewisses Empowerment zu gewährleisten und dieses innezuhaben, um das eigene Leben zugänglich und unabhängig best- und nächstmöglich zu bewältigen, sodass die unten erwähnte Inklusion laut Luhmann (1994) gewährleistet sein muss. Mithilfe Luhmanns[14] Systemtheorie[15] möchte ich ein wenig auf die Inklusion, die die Teilhabe an Systemen bezeichnet, eingehen, d. h. auf die persönlichen Systeme zwischen Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen und wie diese funktionieren. Bei der „Entkopplung“ fern von der Inklusion und der Teilhabe an der Gesellschaft ist festzustellen, dass die Belastungs- und Bewältigungskonstellation bei den Klienten selbst in schwierigen Lebenssituationen negativ besetzt ist (vgl. Scheipl 2005: 9[16]). Der Verlust der Handlungsfähigkeit ist oft mit der Einbuße des Selbstwertes verbunden (vgl. ebd.). Erst durch das Erkennen der eigenen Fähigkeiten zur Bewältigung von Krisen kann eine positive (Um-)Bewertung der Situation erfolgen. An diesen Aspekt schließt das Empowerment an, wobei hier betont werden muss, dass erst in dieser prekären Spannung(ssituation) die Möglichkeit zur Entstigmatisierung sichtbar wird und somit die Perspektive des Empowerment erst eine ernstzunehmende Komponente erhält. „Dieses Grundprinzip setzt bei den Professionisten[17] Empathie und professionelle Risikobereitschaft voraus, dies berührt auch – neben der professionellen Methodenkompetenz und Motivierfähigkeit – die persönliche Sphäre der Professionisten. Das Empowerment ist aber auch als Leitperspektive des biografischen Lebensbewältigungs- bzw. Interventionsansatzes zu sehen“ (Böhnisch 1999: 273). Weiters: „Beide Ansätze präferieren ein Vorgehen, welches direkt in der Lebenswelt, in den alltäglichen Lebensvollzügen der KlientInnen angesiedelt ist. Die Kompetenz der Lebensbewältigung ist nicht allein als private Angelegenheit der KlientInnen, sondern als soziale Angelegenheit zu verstehen“ (Steiner et al. 2006: 38). Diesem Zitat kann ich mich nicht ganz anschließen; Die Kompetenz der Lebensbewältigung sei demnach also eine soziale Angelegenheit, bei der die Experten (Professionisten) entscheidend beteiligt sind. Das klingt aber nicht nach der Persönlichkeitsautonomie, über die der Akteur eigentlich verfügen sollte. Ich fühle mich als Betroffener in dieser Angelegenheit, als wäre mir mein eigenes Recht entzogen worden. Daher ist die Förderung der Kompetenz der Lebensbewältigung sehr wichtig, aber nicht die Kompetenz der Intervention durch Experten und das familiäre Sozialumfeld. Der Akteur ist immer lern- und willensfähig, das eigene Leben selbst von Anfang an zu entfalten und die unterstützende Hand wie z. B. die Gebärdensprachdolmetscher bzw. die persönliche Assistenz zu beauftragen. Diese Services haben die Aufgabe, die Bedürfnisse und Vorkommnisse im Leben des Akteurs gerade in diesen Situationen zu erfüllen. Meiner Ansicht nach ist es keine soziale (interventionsbasierte) Angelegenheit gemäß dem traditionellen Begriffsverständnis, sondern es ist eine soziale bzw. professionelle Dienst- bzw. Arbeitsleistungsangelegenheit (Kundenservice-Angelegenheit) nach modernem Begriffsverständnis. Das Menschenbild und Sozialumfeld des lern- und willensfähigen Akteurs mit Behinderung in Zusammenhang mit seiner erfolgsorientierten Biografie aufzuzeigen, ist das Ziel der Diplomarbeit.
2.3 Inklusion
Luhmann knüpft die personale Teilhabe an Gesellschaft an die Bedingungen der Funktionssysteme und ersetzt vor diesem Hintergrund den Integrationsbegriff durch den Begriff der Inklusion. Die Inklusion[18] bezieht sich auf das spezifische Verhältnis von Gesellschaft als funktionsspezifische Kommunikation und Mensch als (organische, neuronale und psychische) Umwelt von Gesellschaft. „Inklusion […] kann sich nur auf die Art und Weise beziehen, in der im Kommunikationszusammenhang Menschen bezeichnet, also für relevant gehalten werden. Man kann, an eine traditionelle Bedeutung des Terminus anschließend, auch sagen: die Art und Weise, in der sie als ‚Personen‘ bezeichnet werden“ (Luhmann 1994: 20). Die Menschen mit Behinderungen sind bereits Mitglieder der Gesellschaft, in der sie leben, jedoch sind sie miteinbezogen, weil sie Kommunikation praktizieren. Durch Kommunikation haben die beiden Seiten der Akteure (mit und ohne Behinderung) eine Gelegenheit, sich besser kennenzulernen und dadurch die Umgangsfähigkeiten zu vertiefen. Das nenne ich die doppelte oder integrale Inklusion.
2.4 Kompensation
Unter Kompensation verstehe ich die Einsatzmittel, die unmittelbar und mittelbar angewendet werden, um Behinderungen auszugleichen. Die Kompensation lässt sich wie folgt definieren: Die „[...] Kompensation liegt dann vor, wenn eine objektive oder wahrgenommene Ungleichheit zwischen verfügbaren Fähigkeiten und Umweltanforderungen ausgeglichen wird“ (Bäckman & Dixon 1992: 272). Das Ausgleichen des Ungleichgewichtes kann aktiv oder passiv durch den Betroffenen und entweder ohne fremde medizinische Beteiligung oder mit fremder Hilfe unter Experten erfolgen. Experten oder Nichtexperten fassen die Menschen mit Behinderung – von der Selbstwahrnehmung der behinderten Menschen her – verschieden auf und sehen sie nur dann als gleichwertig an, wenn die situativen und sozialen Bedingungen für die beiden Gruppen gegeben sind. Es handelt sich um Bedingungen, die nur dann erfüllt werden, wenn die betroffene Person weiß, was für sie geeignet ist, welche Kompensationen im sozialen Umfeld je nach Bedarf passen, und sie auch bereit ist, das ohne Wenn und Aber der Behörden durchzusetzen. Diese Bedingungen werden im Laufe der Diplomarbeit herausgearbeitet. Das Einsetzen der Fähigkeiten muss dementsprechend kompensatorisch für die Lebensgestaltung sein. Die selbstbestimmt kompensatorische Lebensgestaltung entspricht den minimalen Anforderungen in der gesellschaftlichen Teilhabe.
2.4.1 Medizinische und psychologische Aspekte/Dimensionen
Die Kompensation wird in medizinischen und psychologischen Begriffen näher erläutert. Im medizinischen Sinn wird sie bezeichnet als der „Ausgleich einer mangelhaften Organfunktion durch Mobilisierung eigener funktioneller Reserven oder durch Steigerung der Tätigkeit anderer Funktionspartner“ (vgl. Gauggel 2008: 670). Im Gegensatz dazu „bezieht sich die Kompensation aber primär auf das Verhalten und Erleben von Menschen. Es werden Fähigkeiten herausgebildet, aufgrund derer sensorische, motorische oder kognitive Defizite ausgeglichen werden“ (ebd.). Ich gebrauche den Begriff der Kompensation im Sinne von Unterstützung, z. B. durch Hörgeräte, um in Kommunikation mit anderen treten zu können. Auf diese Weise kann beispielsweise ein hörbeeinträchtigter[19] Mensch einen Dialog mit einem Interaktionspartner erleben, allerdings nicht mit einer Gruppe. In diesem Sinne zählt auch die Brille, die man zum Sehen und Lesen gebraucht, zur Kompensation, nämlich einer Sehschädigung[20].
2.4.2 Kompensationsstrategie
Die Kompensationsstrategie erfolgt durch den in der folgenden Abbildung 3 nach Gauggel (2008) erwähnten Prozess und wurde vom Individuum mit Behinderung durch die Lebenserfahrung seit den Kindesbeinen ständig entwickelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der dargestellte Prozess dient dazu, die Kompensationsstrategien aufzufinden und diese in verschiedensten Sozialsituationen innerhalb und außerhalb des familiären Feldes kennenzulernen.
Die Ursachen für ein Ungleichgewicht zwischen den eigenen Fähigkeiten sind wie in Tabelle 1 ersichtlich unterschiedlich (Gauggel 2008: 671 zit. nach Dixon & Bäckman (1995, 1999)):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein Grund für eine Behinderung ist beispielsweise ein Geburtsfehler. Daraus kann ein Ungleichgewicht für die Familie des Akteurs entstehen. Um dieses Ungleichgewicht herauszufinden, um das Leben leichter führen zu können bzw. besser miteinander auszukommen, ist die richtige Beratung durch Selbstbetroffene und professionelle Einrichtungen zu empfehlen. Nur so kann Einsicht in das Leben des Menschen mit Behinderungen und das bestehende Ungleichgewicht innerhalb der Familie oder im sozialen Umfeld gewonnen und daraus resultierend aktive Kompensationen gefunden werden. Nur wenn das Ungleichgewicht im Leben dieses Betroffenen erkannt wird, können in weiterer Folge bewusst Strategien oder Hilfsmittel zum Ausgleich eingesetzt werden. Das Bewusstsein für das Ungleichgewicht und die notwendigen Strategien werden im Rahmen der erfolgreich umgesetzten Ziele ersichtlich (vgl. ebd.: 673); es werden verschiedenste Strategien wie Hörgeräte usw. eingesetzt. Die Brille ist z. B. auch eine Kompensationsstrategie, wenn man verschwommen sieht bzw. sehbehindert ist (Ursache). So wird einem bewusst, dass man die Brille braucht. Die betroffene Person muss zum Ausgleich des Defizits Einsatzfähigkeiten verwenden. Solche Einsatzfähigkeiten entstammen entweder dem normalen Verhaltensrepertoire (z. B. Greifen mit Zehen) und/oder müssen neu (z. B. Gebärdensprache, Brailleschrift) gelernt werden (vgl. ebd.: 673ff.). Sobald die Kompensationsstrategien auf Dauer eingesetzt werden, agiert man ausgeglichen in sozialen Situationen. Kompensation kann sowohl positive als auch negative Konsequenzen für die persönliche Umgebung und/oder das soziale Umfeld haben. Der Mensch mit Behinderung ist gewohnt, die Handlungen je nach Situation im Alltag ohne und/oder mit den Kompensationsstrategien (die ihm durch staatliche Finanzierungen ermöglicht wurden) selbstbestimmt und entscheidungsfähig auszuführen.
2.5 Einstellung der Menschen mit Behinderung gegenüber den Behinderten
Festzuhalten ist, dass sich Menschen mit Behinderung an den gleichen Wertmaßstäben wie Nichtbehinderte orientieren. Sie unterliegen den gleichen Sozialisationsmechanismen, die sie mittels Bewältigungshilfsmittel, Kompensationen genannt, erleben. Man kann beobachten, dass die engagierten und autonom orientierten Menschen mit Behinderungen sich häufig sehr deutlich von anderen behinderten Menschen distanzieren. Ich persönlich hege Distanz gegenüber jenen gehörlosen Personen, die unzureichende Bildung erworben haben, weil für mich der interaktive Austausch somit auf bestimmte Themen eingeschränkt ist. Es ist zwar einerseits widersprüchlich, dass ich sie gerne in Zusammenhang mit der Gemeinschaft der Gehörlosen unterstütze, andererseits pflege ich jedoch kaum Kontakte mit ihnen in meinem privaten Umfeld, ich respektiere aber diese, die handwerkliche oder sonstige Fertigkeiten haben bzw. ihr Leben meistern. Es gibt aber auch Ausnahmen, so z. B. wenn gehörlose Personen im Erwachsenenalter bzw. mitten im Berufsleben einen eigenen Willen entwickeln und sich fortan bemühen, ihre allgemeine bzw. berufliche Bildung auf eigene Faust ohne Kompensationsmöglichkeiten zu erwerben. (Diese Fälle möchte die Diplomarbeit behandeln.) Ein anderes Beispiel ist etwa, dass Menschen mit Behinderungen, indem sie sich nicht mit den anderen behinderten Menschen identifizieren, ihr Selbstwertgefühl aufwerten. Sie behaupten, dass es für sie die Gruppe „Behinderte“ in der sozialen, fürsorglichen Kategoriendenkweise gar nicht gibt und dass sie sich nicht unbedingt anders als die Nichtbehinderten (vgl. Cloerkes 2001: 85) erleben. Meiner Auffassung nach ist diese Selbstbestimmung bei den Menschen mit Behinderungen sehr wichtig und trägt entscheidend zu ihrem Erfolg bei, sie leben lieber autonom und gestalten ihr Leben aktiv. Neben der autonomen Lebensführung ist die Anwendung der Einsatzmittel als ständige Begleiterscheinung ein weiteres Charakteristikum erfolgreicher behinderter Menschen.
2.6 Zusammenfassung und Abwehr gegen den gesellschaftlichen Status als Behinderte
Die Begriffe Sozialisation und Behinderung prägen den gesellschaftlichen Status der „Behinderten“. Dieser Status wird den Menschen mit Behinderungen aufgrund der a sozialen (Kategorien-)Normen zugeteilt. Mit der Realisierung ihrer Ziele bzw. durch bereits realisierte Ziele versuchen die erfolgreichen Menschen mit Behinderungen, sich einen besseren Status zu erkämpfen und nehmen somit eine besondere Stellung zwischen den Behinderten und den Nichtbehinderten ein. Sie sehen sich dabei als Brückengeher oder/und -bauer in den beiden bzw. in mehreren Gruppen. Leider sind nicht alle Menschen mit Behinderungen Brückengeher bzw. -bauer. Eine Voraussetzung für die Fähigkeit, derartige Brücken zu bauen, ist, dass man die geistige Stabilität dazu besitzt. Man spricht wie erwähnt von der „doppelten bzw. integralen Inklusion“. Die doppelte bzw. integrale Inklusion bezeichnet die abstrakt interaktiv-gesellschaftliche Brücke zwischen den Menschen, bei der es keine Rolle spielt, ob man behindert ist oder nicht, weil in ihr einerseits keine Zugehörigkeit in der Behindertenszene zu finden ist und andererseits eine Abwehr gegen die von den Nichtbehinderten kategorisierte Denkweise der Gruppenzugehörigkeit stattfindet. Der Grund, weshalb sie sich wehren, findet sich in ihrer Kindheit, er charakterisiert sich durch ihre spezifische persönliche Einstellung gegenüber den diskriminierenden Zuschreibungen von Nicht-Behinderten gegenüber Menschen mit Behinderungen. Auf dieser Brücke begegnen sich die Menschen kommunikativ und interaktiv. Die persönliche Einstellung fördert die Eigenschaften der Selbstverwirklichung, die im nächsten Kapitel offenbart werden. Der entscheidende Grund für den Widerstand, den die erfolgreichen Menschen mit Behinderung leisten, liegt im Unterschied zwischen ihnen und den anderen behinderten Menschen: Sie haben einerseits festgestellt, dass das „Behindert-Sein“, sprich das „Abnormal-Sein“, von der Denkweise der Nichtbehinderten stammt; andererseits haben die Menschen mit Behinderungen das „Wirken“ (mehr dazu später) entdeckt und in ihrem Kleinkindalter fest verankert. Nicht alle Menschen, die andersartig aussehen, entdecken diese Gestaltung des Wirkens. Das Wirken ist immer latent[21] bezogen auf das Sozialumfeld. Das Sein vermittelt das Erkennen in der Situation durch das bereits erworbene Wissen oder durch die Erfahrung, dass latente Werkzeuge als Handlung (materiell) oder Kommunikation (immateriell) für das entscheidende (wechselwirkende) Wirken bereitstehen und genutzt werden, die beim Außenstehenden bzw. Nichtbehinderten ankommen oder fehlschlagen. Dieses Wirken ist eine Arbeit, eine harte Arbeit, die von den Menschen mit Behinderungen, nicht von den Nichtbehinderten bzw. Außenstehenden, investiert werden muss. Die Investition für das Wirken verlangt die Kampfeinstellung und die Willensbildung, um damit den gesellschaftlichen Status umformen zu können.
[...]
[1] Unter „Gesetz“ verstehe ich die ganz bestimmten Paragrafen (BIZEPS 2003b. Online verfügbar unter http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=4349, zuletzt geprüft am 10.09.2011), die sich als Barrieren in Österreich darstellen. Ich beziehe hiermit die Sozialisationshintergründe im Bildungs- und Berufswerdegang jener Menschen mit Behinderungen ein. Ein diskriminierender Paragraf befindet sich zum Beispiel in der Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport. Bei Aufnahme- und Eignungsprüfungen (AufEiPVO) muss noch heute neben der geistigen auch die körperliche Eignung mittels ärztlichem Attest nachgewiesen werden (Bundesministerium für Unterricht, Kultur und Sport, Online verfügbar unter http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=601, zuletzt geprüft am 12.09.2011). Neben der Eignungsvorschrift gibt es hierzulande noch viele Berufe, die behinderte Menschen nicht ausführen dürfen. Eine kleine Auswahl: Pflegehelfer, Diplomkrankenschwester und -pfleger, selbständiger Apotheker, Dentist, Fleischbeschauer, Forstaufseher, Kindergärtner und Erzieher, Volks-, Haupt- und Sonderschullehrer, Richter und Staatsanwalt (BIZEPS 2003a) Online verfügbar unter http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=4091, dl: 14.09.2011). „Eine wirkliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung wird allerdings auch dann noch lange nicht in Sicht sein. Der derzeitige Entwurf des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes enttäuscht uns sehr und verdient seinen Namen noch nicht“, erklärt Martin Ladstätter 2005 (BIZEPS (2005b): Online verfügbar unter http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=5782, zuletzt geprüft am 10.09.2011).
[2] Als „Quasi-Status“ bezeichne ich die Tatsache, dass der betreffende Mensch mit Behinderung den „ungewollten“ Status laut Gesetz zugewiesen bekommen hat.
[3] Der Unterschied zwischen beiden Begriffen (behinderte Menschen vs. Menschen mit Behinderung) liegt darin, dass der erste Begriff eine negative Konnotation hat und somit auch leicht stigmatisierend wirkt. Man kann ja sagen, dass der behinderte Mensch nicht eben ein gleichwertiger Mensch sei wie etwa ein Ausländer, der genauso ein Mensch ist, aber eventuell eine andere Hautfarbe oder andere Sittenvorstellungen hat. Ausländer sind hingegen Menschen mit Migrationshintergrund. Genauso nach diesem Prinzip wird der zweite Begriff (Mensch mit Behinderung) verwendet: Der Begriff sagt also aus, dass die Person ein Mensch ist und eine Behinderung hat. Die Wörter „Mensch“ und „Behinderung“ zu verbinden kann schnell zur Stigmatisierung führen, aus diesem Grund werden in dieser Diplomarbeit die Begriffe „Mensch“ und „Behinderung“ strikt getrennt.
[4] Begrenzte Selbstbestimmung heißt „Kontrolle über das eigene Leben zu haben, basierend auf einer Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen Alternativen, die die Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer bei der Bewältigung des Alltags minimieren. Das schließt das Recht ein, seine eigenen Angelegenheiten selbst regeln zu können, an dem öffentlichen Leben der Gemeinde teilzuhaben, verschiedenste soziale Rollen wahrnehmen und Entscheidungen fällen zu können, ohne dabei in psychologische oder körperliche Abhängigkeiten zu geraten“ (Frehe 1990 zit. nach Schönwiese 2003). Selbstbestimmung heißt mit anderen Worten, das eigene Leben zu gestalten und in Bezug auf die eigene Lebensqualität frei von institutionalisierten Zwängen und bevormundender Fachlichkeit Wahlmöglichkeiten zu haben und Entscheidungen treffen zu können. Selbstbestimmung ist nicht das gleiche wie Selbständigkeit. Unter Selbständigkeit ist zu verstehen, ein Leben ohne fremde Hilfe führen zu können. Wenn jemand selbständig ist, heißt das nicht gleich automatisch, dass jemand selbstbestimmt lebt und andererseits muss ein hohes Maß an Hilfsbedürftigkeit nicht zwangsläufig ein hohes Maß an Fremdbestimmung bedeuten. Assista. Online verfügbar unter http://www.assista.org/files/Selbsbestimmung.pdf, zuletzt geprüft am 25.09.2011.
[5] Erste Schulversuche begannen in Oberwart (Burgenland). Nach und nach breiten sich diese Versuche in ganz Österreich aus. Rutte, V. (1998): Schulische Integration. Online verfügbar unter http://info-h.org/d/oesterreich.htm, zuletzt geprüft am 10.09.2011. Hafner, M. (2003): Schulische Integration im europäischen Vergleich. Online-Zeitung der Universität Wien. Online verfügbar unter http://www.dieuniversitaet-online.at/dossiers/beitrag/news/schulische-integration-im-europaischen-vergleich/83.html, zuletzt geprüft am 10.09.2011.
Persönliche Selbstbestimmung bezeichnet die Unabhängigkeit des bzw. der Einzelnen von jeder Art und Form der Fremdbestimmung (z. B. durch gesellschaftliche und institutionelle Zwänge, aber auch durch staatliche Gewalt). Somit ist die Unabhängigkeit des Individuums von eigenen Trieben und Begierden gemeint (vgl. Duden 2011). Im demokratischen Prinzip sind „alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich“ gemäß (Art. 7 Bundesverfassungsgesetz (B-VG) und Art. 2 Staatsgrundgesetz vom 1867 (StGG) ( Bundeskanzleramt (1867): Staatsgrundgesetz vom 1867. RGBl. 142 / BGBl.684/1988, vom 15.09.2011. Online verfügbar unter http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10000006/StGG%2c%20Fassung%20vom%2015.09.2011.pdf zuletzt geprüft am 15.09.2011. Auch ist der Art. 14 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) vom 04.11.1950 (BGBl. I 1958/210) (Bundeskanzleramt (24.09.1958): 210. Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 04.11.1950. BGBl. I 1958/210 (EMRK), vom 15.09.2011 1958 (210), S. 1927–1958. Online verfügbar unter http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1958_210_0/1958_210_0.pdf, zuletzt geprüft am 15.09.2011): Der Verbot der Diskriminierung ist vorgegeben. „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten “. (Art. 7 Abs. 1 B-VG). Dieser Artikel stellt als Staatsziel- und Verfassungsbestimmung als Bundesauftrag fest, die der besonderen Bedeutung verliehen wurde. BIZEPS (2005a). Online verfügbar unter http://www.bizeps.or.at/links.php?nr=78 , zuletzt geprüft am 14.09.2011).
[7] Siehe Kapitel 2.5 Einstellung der Menschen mit Behinderung gegenüber den Behinderten, S. 31.
[8] Siehe Kapitel 6.5 Eisbergmodell nach den hermeneutischen Prinzipien, S. 54.
[9] Charles Sanders Peirce (1839–1914) beschäftigte sich mit logischen Schlussfolgerungen und führte neben der bekannten Induktion und Deduktion die Abduktion als dritte Schlussfolgerungsweise in die Logik ein. Aus der Abfolge von Abduktion, Deduktion und Induktion entwickelte er einen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Ansatz (vgl. Hillmann 2007: 1). Weiters definierte er die Abduktion als „Methode […] zur Rekonstruktion von Handlungen, die mit einem inneren Vorgang, ähnlich der Intuition zu vergleichen ist. Die Kritik am Pragmatismus besagt, daß sich dieser nicht um Werte, Ideen, Ideale kümmere, alles hinge nur vom Nutzen und Erfolg der Handlung des Einzelnen ab. Die Wahrheit bestimmt sich nach der Praxis, in der es darum geht, erfolgreich eine Situation zu bewältigen“. Geli W. et al. Online verfügbar unter http://www.aurora-magazin.at/wissenschaft/soz_frm.htm, zuletzt geprüft am 28.10.2011.
[10] Gabrielle Rosenthal (*1954) beschäftigt sich hauptsächlich mit den qualitativen Forschungsmethoden der Sozialwissenschaften (Lebenslauf auf der Homepage online verfügbar unter http://www.uni-goettingen.de/de/34269.html, zuletzt geprüft am 29.10.2011.
[11] Die materialistische Gesellschaftstheorie geht auf Karl Marx (1818–1883) und Friedrich Engels (1820–1895) zurück und besagt, dass es, um zu leben, nötig ist, die Mittel zu erzeugen, die wir zur Befriedigung unserer Bedürfnisse brauchen – „Produktion des materiellen Lebens“ (Tillmann 2000: 162). Weiters ist die „Reproduktion durch Arbeit“ ein wesentlicher Bestandteil, um menschliche Existenz zu gewährleisten.
[12] Bundesministerium für Arbeit und Soziales (1993): Das Behindertenkonzept der österreichischen Bundesregierung. Unter Mitarbeit von Dr. Max Rubisch. Hg. v. Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sektion IV. Wien. Online verfügbar unter https://broschuerenservice.bmask.gv.at/PubAttachments/behindertenkonzept.pdf, zuletzt geprüft am 14.09.2011.
[13] Spracherwerbsstörung, bes. bei Kindern.
[14] Niklas Luhmann (1927–1998) war ein deutscher Soziologe, Philosoph und Gesellschaftstheoretiker. Als einer der Begründer der soziologischen Systemtheorie gilt Luhmann als transdisziplinärer Sozialwissenschaftler (Hillmann 2007: 512f.).
[15] Systemtheorie ist ein Denkansatz, in dem es um Ganzheiten geht. Systemisches Denken ist somit eine Betrachtungsweise. Ein System wird als eine Einheit verstanden, die zwar bestimmte Elemente als Voraussetzung hat, aber nicht als bloße Summe dieser Elemente zu verstehen ist. Durch die Beziehungen der Elemente untereinander und die daraus entstehenden Wechselwirkungen ergibt sich etwas Neues, das nicht ausschließlich auf die Eigenschaften der Elemente zurückführbar ist. Hier in der Diplomarbeit geht es um soziale Systeme (Kommunikationssysteme). Das Kommunikationssystem liegt zwischen den Personen und nicht in den Personen (vgl. Wansing 2005: 25).
Scheipl, J. (WS 2005/2006): Reflektiv-Interaktive Modelle der Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation. Menschliche Entwicklung und Entwicklung des Sozialen. 4. VO. Karl-Franzens-Universität Graz. Online verfügbar unter http://emile.uni-graz.at/pub/05w/2005-11-0062.DOC, zuletzt geprüft am 10.09.2011.
[17] Cloerkes (2001: 116–117) unterteilt Professionisten in pädagogischen, medizinischen und sozialen Bereichen. Im pädagogischen Bereich sind sie als Sonderpädagogen tätig und im medizinischen Bereich sind sie als Ärzte beschäftigt. In den beiden Bereichen sind sie nicht frei von negativen Einstellungen gegenüber den Menschen mit Behinderungen. Im sozialen Bereich, etwa in Werkstätten, zeigen Rehabilitationsbetreuer und andere Betreuer. vergleichsweise positivere Einstellungen auf.
[18] Die Inklusion erfolgt nur dann, wenn Personen in Kommunikation berücksichtigt werden. Offen bleibt allerdings, wie sich dieser Inklusionsmechanismus gestaltet, wie sich den Personen der Zugang zur sozialen Kommunikation erschließt (vgl. Wansing 2005: 40).
[19] Hörbeeinträchtigung ist meiner Ansicht nach ein Oberbegriff, der alle Kategorien beinhaltet: Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit, Spätertaubung usw. Das Wort stammt aus dem medizinischen und fürsorglichen Modell.
[20] Brille ist ein selbstverständliches und akzeptiertes Hilfsmittel in der Gesellschaft.
[21] Mit „latent“ bezeichne ich einen „Summenindex“ bestehend aus verschiedenen Faktoren, die im Sozialumfeld, in dem sich der Akteur mit Behinderung aufhält, ausgebildet werden. Die verschiedenen Faktoren werden in der Diplomarbeit zugänglich herausgearbeitet.
Häufig gestellte Fragen
Wie definieren erfolgreiche Menschen mit Behinderung ihren Erfolg?
Erfolg wird oft als die Fähigkeit zur Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit von staatlicher Bevormundung und die Realisierung selbst gesetzter Ziele verstanden.
Warum sind Vorurteile gegenüber Behinderten noch immer so stark?
Die Arbeit untersucht gesellschaftliche Hintergründe und Wurzeln, die teilweise noch in historischen Standards verankert sind und Behinderung als Unsicherheitsfaktor sehen.
Was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Empowerment?
Inklusion beschreibt die Teilhabe an der Gesellschaft, während Empowerment die Stärkung der Eigenmacht und Selbstbestimmung behinderter Menschen bedeutet.
Welche Rolle spielt die Sozialisation im biografischen Werdegang?
Die primäre (Familie), sekundäre (Schule) und tertiäre Sozialisation (Beruf) sind entscheidend dafür, wie ein Individuum lernt, mit Barrieren umzugehen und Ziele zu erreichen.
Welche Kompensationsstrategien nutzen Menschen mit Behinderungen?
Dazu gehören Willensbildung, Kampfbereitschaft und die Entwicklung spezifischer Handlungs- und Durchsetzungsstrategien gegen gesellschaftliche Barrieren.
- Quote paper
- Mag. Siegfried Bachmayer (Author), 2013, Studie über das Leben erfolgreicher Menschen mit Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214549