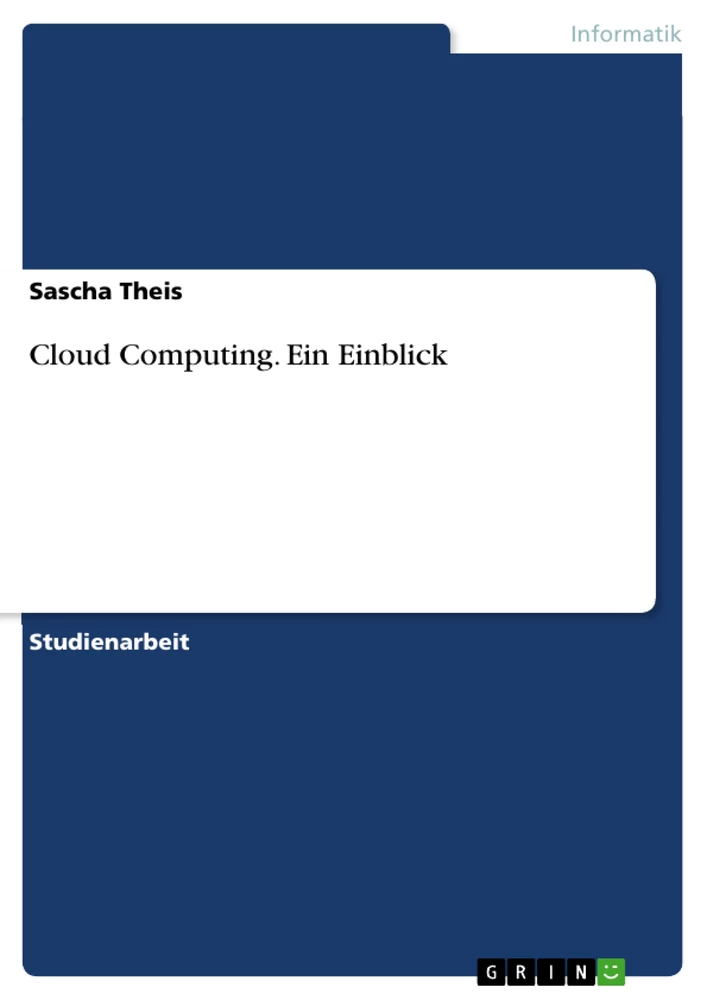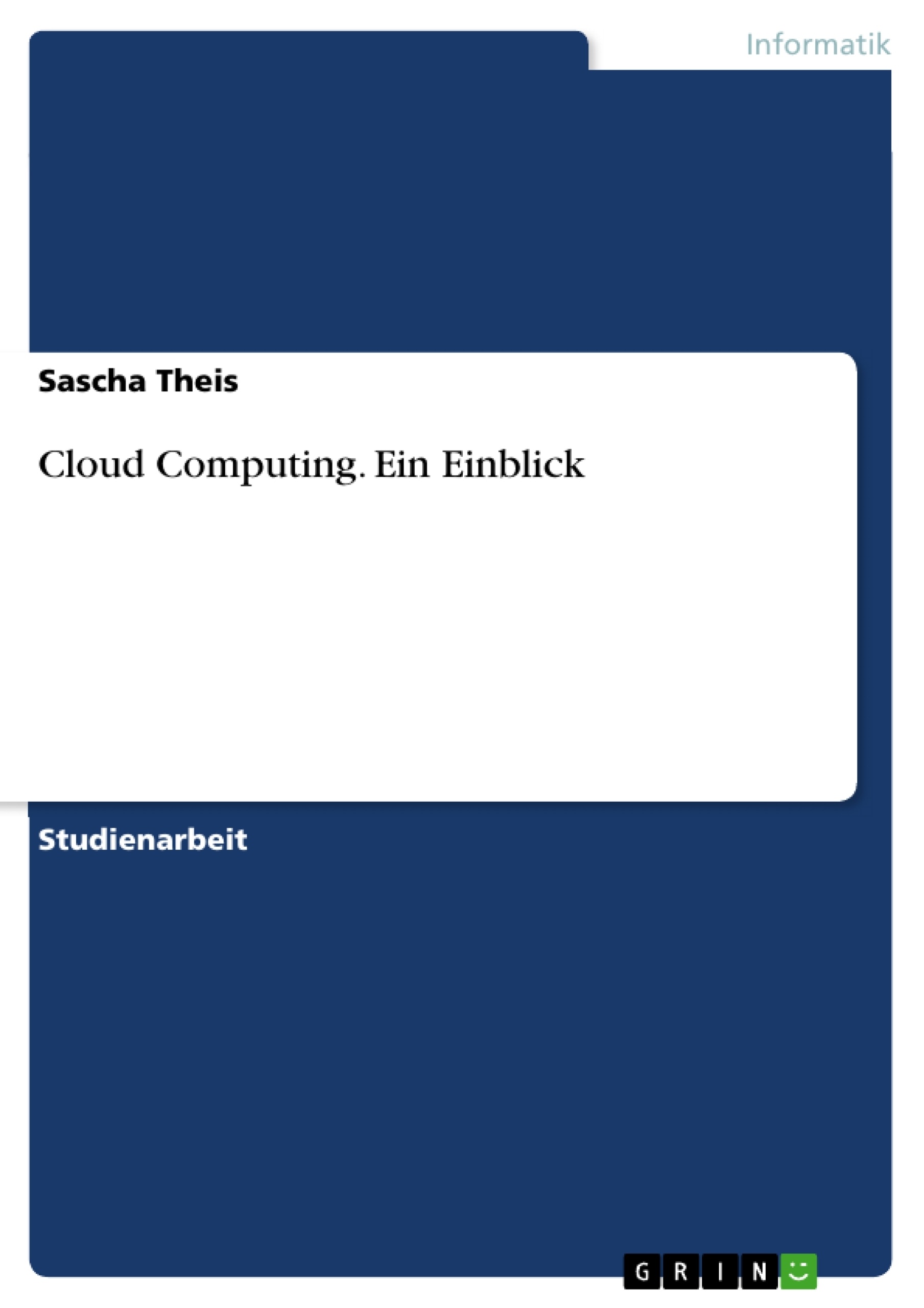1. Geschichte
2. Was ist Cloud Computing?
2.1 Merkmale eines Cloud-Dienstes
2.1.1 On-demand self-service
2.1.2 Broad network access
2.1.3 Resource pooling
2.1.4 Rapid elasticity
2.1.5 Measured services
2.2 Einteilung nach technischen Modellen
2.2.1 Infrastructure as a Service (IaaS)
2.2.2 Platform as a Service (PaaS)
2.2.3 Software as a Service (SaaS)
2.3 Einteilung nach Zielgruppen
2.3.1 Public Cloud
2.3.2 Private Cloud
2.3.3 Community Cloud
2.3.4 Hybrid Cloud
3. Ökonomische Betrachtung
3.1 Chancen
3.2 Risiken
3.2.1 Zugriff auf Daten durch Unberechtigte
3.2.2 Hardwarebedingte Risiken
3.2.3 Diebstahl von Benutzerkonten
3.2.4 Korrupte Mitarbeiter
4. Sicherheitsmaßnahmen
4.1 Zugriffsrechte und Wichtigkeit der Daten
4.2 Speicherung der Daten
4.3 Datentransfer
5. Umfrage des Frauenhofer Instituts
5.1 Erwartungen
5.2 Ziele
5.3 Bedenken
6. Wie finde ich den passenden Anbieter?
6.1 Anforderungen eines Cloud Anwenders
6.1.1 Sicherheit
6.1.2 Kontrollmöglichkeiten
6.2 Euro-Cloud Zertifizierung
7. Zusammenfassung
Inhaltsverzeichnis
1. Geschichte
2. Was ist Cloud Computing?
2.1 Merkmale eines Cloud-Dienstes
2.1.1 On-demand self-service
2.1.2 Broad network access
2.1.3 Resource pooling
2.1.4 Rapid elasticity
2.1.5 Measured services
2.2 Einteilung nach technischen Modellen
2.2.1 Infrastructure as a Service (IaaS)
2.2.2 Platform as a Service (PaaS)
2.2.3 Software as a Service (SaaS)
2.3 Einteilung nach Zielgruppen
2.3.1 Public Cloud
2.3.2 Private Cloud
2.3.3 Community Cloud
2.3.4 Hybrid Cloud
3. Ökonomische Betrachtung
3.1 Chancen
3.2 Risiken
3.2.1 Zugriff auf Daten durch Unberechtigte
3.2.2 Hardwarebedingte Risiken
3.2.3 Diebstahl von Benutzerkonten
3.2.4 Korrupte Mitarbeiter
4. Sicherheitsmaßnahmen
4.1 Zugriffsrechte und Wichtigkeit der Daten
4.2 Speicherung der Daten
4.3 Datentransfer
5. Umfrage des Frauenhofer Instituts
5.1 Erwartungen
5.2 Ziele
5.3 Bedenken
6. Wie finde ich den passenden Anbieter?
6.1 Anforderungen eines Cloud Anwenders
6.1.1 Sicherheit
6.1.2 Kontrollmöglichkeiten
6.2 Euro-Cloud Zertifizierung
7. Zusammenfassung
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kernmerkmale von Cloud Computing?
Zu den wesentlichen Merkmalen gehören On-demand self-service, breiter Netzwerkzugriff, Ressourcen-Pooling, schnelle Elastizität und messbare Dienstleistungen.
Was ist der Unterschied zwischen IaaS, PaaS und SaaS?
IaaS bietet Infrastruktur, PaaS stellt eine Plattform für Entwickler bereit, und SaaS liefert fertige Softwareanwendungen über das Internet.
Welche Cloud-Modelle gibt es für verschiedene Zielgruppen?
Man unterscheidet zwischen Public Cloud (öffentlich), Private Cloud (unternehmensintern), Community Cloud (für spezifische Gruppen) und Hybrid Cloud (Mischform).
Welche Risiken bestehen beim Einsatz von Cloud-Diensten?
Zentrale Risiken sind unberechtigter Datenzugriff, Hardwareausfälle, Diebstahl von Benutzerkonten und Fehlverhalten durch korrupte Mitarbeiter.
Wie findet man den passenden Cloud-Anbieter?
Wichtige Kriterien sind Sicherheitsstandards, Kontrollmöglichkeiten für den Anwender sowie Zertifizierungen wie die Euro-Cloud Zertifizierung.
- Arbeit zitieren
- Sascha Theis (Autor:in), 2013, Cloud Computing. Ein Einblick, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214844