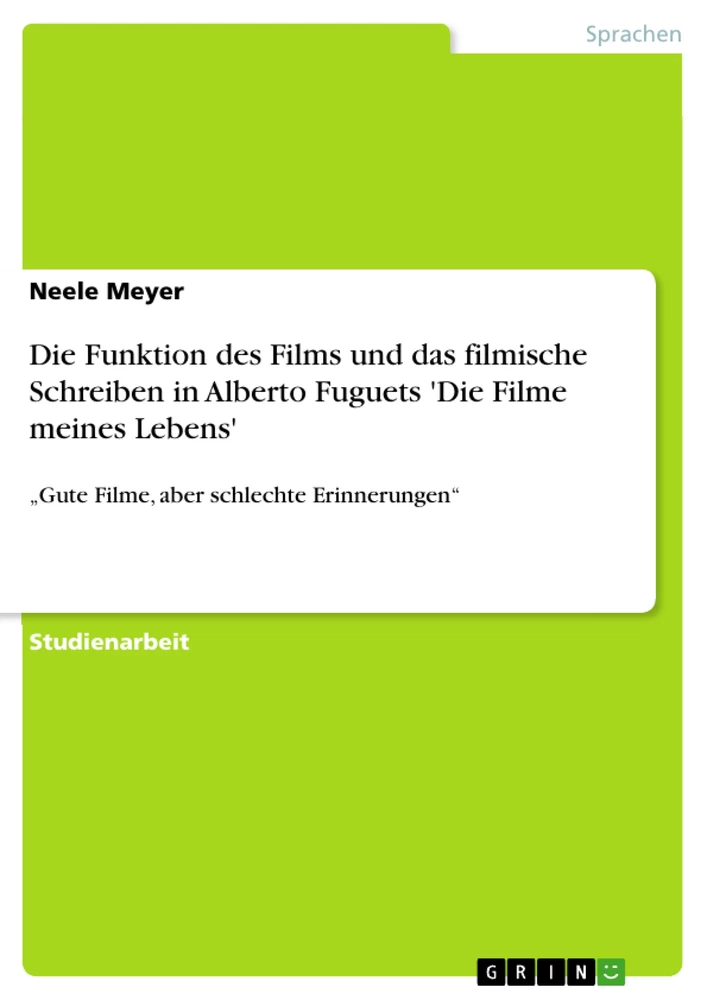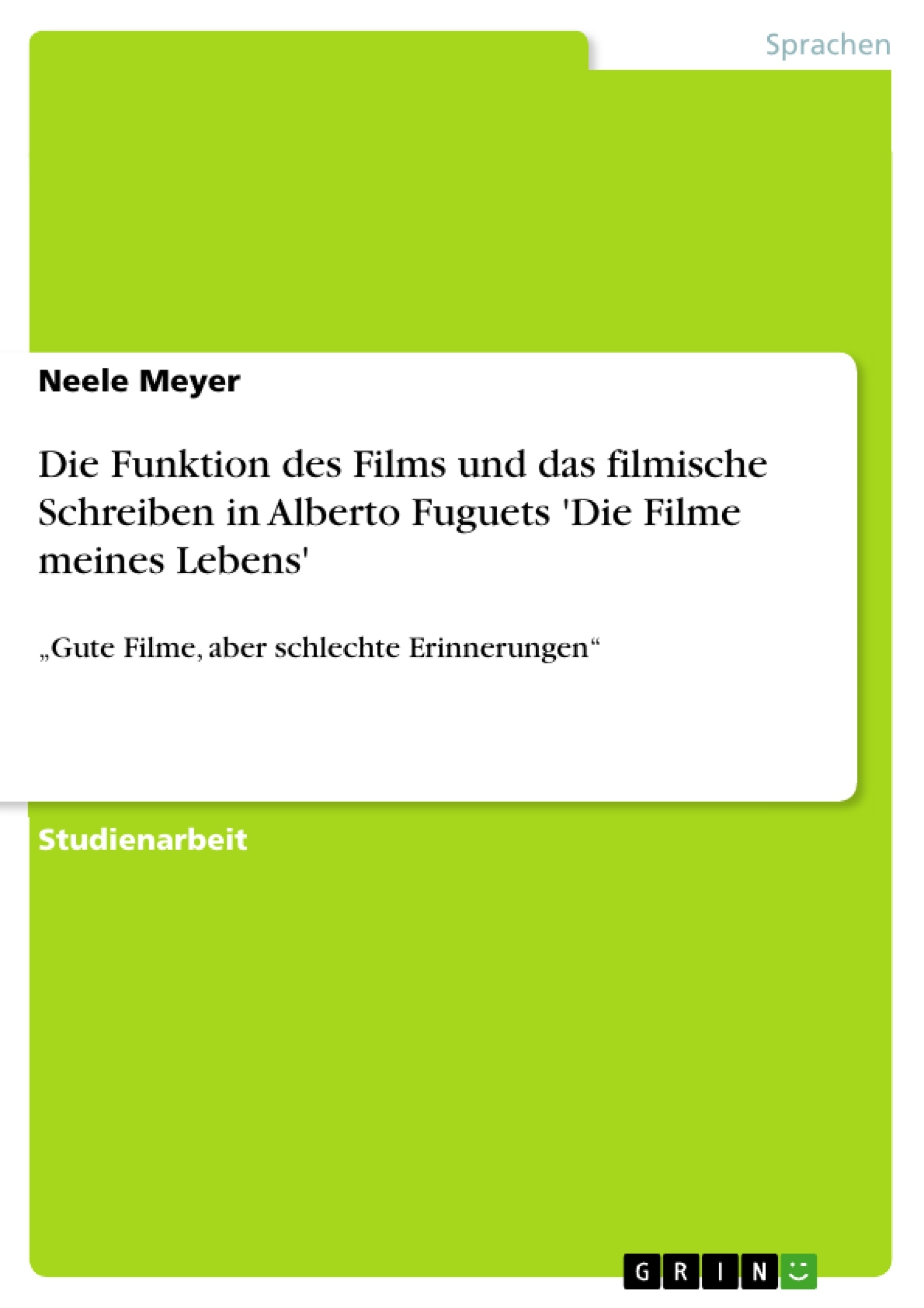Welche Spuren hinterlassen Filme im Leben eines Menschen? Wir befinden uns im multimedialen Zeitalter, in dem Filme überall auf der Welt gleichzeitig zugänglich sind, in der das allabendliche Fernsehprogramm das Hauptunterhaltungsprogramm vieler Menschen darstellt und viele derart in den Bann zieht, dass sie Film und Realität nicht mehr unterscheiden können. Bei dieser Omnipräsenz des Films scheint es durchaus legitim, die Frage zu stellen, in welcher Form die Masse an durch Film und Fernsehen aufgenommenen Informationen längerfristig Spuren hinterlässt - an welche Elemente eines Films man sich auch Jahre später noch erinnert. Das Werk Die Filme meines Lebens des chilenischen Autors Alberto Fuguet, lädt geradezu dazu ein, das Werk auf diese Fragestellungen hin zu analysieren, da sich der Protagonist und Erzähler des Werks eine Liste seiner 50 Lieblingsfilme aufstellt und daran seine Kindheit rekapituliert. Fuguet selbst gehört zu einer Generation zeitgenössischer chilenischer Schriftsteller, die um die Modernisierung der lateinamerikanischen Kulturlandschaft bemüht sind und dabei gerade den Massenmedien eine große Bedeutung beimessen, die in vielen seiner Werke explizit deutlich wird. Interessant ist es daher, weiterhin der Fragestellung nachzugehen, ob der Film auch einen Einfluss auf die strukturelle und erzählerische Gestaltung des Textes ausübt und dem Text somit eine filmische Schreibweise nachgewiesen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff des filmischen Schreibens
- Einordnung von Autor und Werk
- Alberto Fuguet und die Bewegung McOndo
- Inhalt des Werkes
- Die Struktur des Werkes
- Die Binnenhandlung
- Der Erzähler
- Zeitstruktur
- Inhaltliche Bezüge zum Film
- Filmische Elemente in der Lebenswelt des jungen Beltrán
- Gelebte Rollenschemata
- Beeinflussung der Wahrnehmung durch den Film
- Die Bedeutung der Filme für Beltrán
- Zusammenfassung der Analyse der Binnenhandlung
- Die Rahmenhandlung
- Erzähler
- Zeitgestaltung
- Subjektive Wahrnehmung und Live-Charakter
- Inhaltliche Bezüge zum Film in der Rahmenhandlung
- Anlass der Erstellung der Filmliste
- Distanzierung vom Film und Hinwendung zur Wissenschaft
- Der Film als gemeinsamer Erfahrungsschatz
- Die Verwendung filmischer Fachsprache
- Zusammenfassung Analyse der Rahmenhandlung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss des Films auf das Leben des Protagonisten und die narrative Struktur in Alberto Fuguets "Die Filme meines Lebens". Die Arbeit analysiert, wie filmische Elemente in den Text integriert sind und welche Bedeutung sie für die Charakterentwicklung und die Gesamtinterpretation des Werkes haben. Dabei wird auch der Begriff des "filmischen Schreibens" kritisch beleuchtet.
- Der Einfluss von Filmen auf die Persönlichkeitsentwicklung des Protagonisten
- Analyse des "filmischen Schreibens" in Fuguets Werk
- Die Beziehung zwischen Film und Realität im Text
- Untersuchung der narrativen Struktur und ihrer filmischen Elemente
- Die Rolle der McOndo-Bewegung im Kontext des Werkes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss von Filmen auf das Leben eines Menschen und die narrative Gestaltung eines Textes. Sie führt in das Werk "Die Filme meines Lebens" von Alberto Fuguet ein, dessen Protagonist eine Liste seiner 50 Lieblingsfilme erstellt und seine Kindheit anhand dieser rekapituliert. Die Einleitung skizziert den Forschungsansatz und die methodische Vorgehensweise der Arbeit, indem sie den Begriff des filmischen Schreibens einführt und die Bedeutung des Autors und seiner Zugehörigkeit zur McOndo-Bewegung hervorhebt. Der Fokus liegt auf der Analyse der filmischen Bezüge des Werkes auf Inhalts- und Diskursebene.
Zum Begriff des filmischen Schreibens: Dieses Kapitel befasst sich mit der schwierigen Definition des "filmischen Schreibens". Es beleuchtet die Problematik einer eindeutigen Abgrenzung zwischen literarischen und filmischen Ausdrucksmitteln und die Herausforderungen, die sich aus der Entwicklung des Mediums Film ergeben. Der Text analysiert verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs, unter Berücksichtigung der medialen Unterschiede zwischen Literatur und Film. Die Arbeit hebt die Bedeutung subjektiver Kinowahrnehmungen des Autors hervor und betont die sprachliche Umsetzung filmischer Elemente in der Literatur.
Einordnung von Autor und Werk: Dieses Kapitel ordnet den Autor Alberto Fuguet und sein Werk "Die Filme meines Lebens" in den literarischen Kontext ein. Es beschreibt Fuguets Zugehörigkeit zur McOndo-Bewegung und deren Einfluss auf seine Schreibweise. Es gibt einen Überblick über den Inhalt des Werkes und bereitet den Weg zur Analyse der strukturellen und erzählerischen Elemente. Die Einordnung dient als Grundlage für das Verständnis des Werkes und seiner filmischen Bezüge.
Die Struktur des Werkes: Dieser Abschnitt analysiert die übergreifende Struktur des Werkes "Die Filme meines Lebens", die die Grundlage für die weitere Untersuchung der filmischen Elemente bildet. Es beschreibt die verschiedenen Ebenen der Erzählung und ihre Interdependenzen.
Die Binnenhandlung: Die Zusammenfassung dieses Kapitels analysiert die Binnenhandlung des Romans, fokussierend auf den Erzähler, die Zeitstruktur und die inhaltlichen Bezüge zum Film. Sie untersucht, wie filmische Elemente in die Lebenswelt des jungen Beltrán integriert sind und welche Rolle die gelebten Rollenschemata und die Beeinflussung der Wahrnehmung durch den Film spielen. Die Analyse der Bedeutung der Filme für Beltrán wird im Zusammenhang mit seiner persönlichen Entwicklung beleuchtet.
Die Rahmenhandlung: Die Zusammenfassung dieses Kapitels konzentriert sich auf die Rahmenhandlung, die den Kontext für die Binnenhandlung liefert. Sie analysiert die Rolle des Erzählers, die Zeitgestaltung, die subjektive Wahrnehmung und die inhaltlichen Bezüge zum Film. Es untersucht den Anlass der Erstellung der Filmliste, die Distanzierung vom Film und die Hinwendung zur Wissenschaft. Die Verwendung filmischer Fachsprache wird ebenfalls in Relation zur Gesamtgestaltung gesetzt. Der Film wird als gemeinsamer Erfahrungsschatz betrachtet und seine Bedeutung für die narrative Konstruktion untersucht.
Schlüsselwörter
Alberto Fuguet, Die Filme meines Lebens, filmisches Schreiben, McOndo, Film und Realität, Narrative Struktur, Erinnerung, Identität, chilenische Literatur, Intermedialität.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Filme meines Lebens" von Alberto Fuguet
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert den Einfluss von Filmen auf das Leben des Protagonisten und die narrative Struktur in Alberto Fuguets Roman "Die Filme meines Lebens". Im Fokus steht die Untersuchung, wie filmische Elemente in den Text integriert sind und welche Bedeutung sie für die Charakterentwicklung und die Gesamtinterpretation des Werkes haben. Der Begriff des "filmischen Schreibens" wird dabei kritisch beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Einfluss von Filmen auf die Persönlichkeitsentwicklung des Protagonisten, die Analyse des "filmischen Schreibens" in Fuguets Werk, die Beziehung zwischen Film und Realität im Text, die Untersuchung der narrativen Struktur und ihrer filmischen Elemente sowie die Rolle der McOndo-Bewegung im Kontext des Werkes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, dem Begriff des filmischen Schreibens, der Einordnung von Autor und Werk, der Struktur des Werkes, der Binnenhandlung (inkl. Erzähler, Zeitstruktur und filmischen Elementen in Beltráns Leben), der Rahmenhandlung (inkl. Erzähler, Zeitgestaltung, subjektiver Wahrnehmung und filmischen Bezügen), und einem Fazit. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss von Filmen auf das Leben und die narrative Gestaltung eines Textes. Sie führt in Fuguets Werk ein und skizziert den Forschungsansatz und die methodische Vorgehensweise, wobei der Begriff des filmischen Schreibens und die Bedeutung von Fuguets Zugehörigkeit zur McOndo-Bewegung hervorgehoben werden.
Was ist der Fokus des Kapitels "Zum Begriff des filmischen Schreibens"?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von "filmischem Schreiben", der Abgrenzung literarischer und filmischer Ausdrucksmittel und den Herausforderungen, die sich aus der Entwicklung des Mediums Film ergeben. Es analysiert verschiedene Ansätze zur Definition und hebt die Bedeutung subjektiver Kinowahrnehmungen und der sprachlichen Umsetzung filmischer Elemente in der Literatur hervor.
Wie wird der Autor und sein Werk eingeordnet?
Das Kapitel "Einordnung von Autor und Werk" ordnet Alberto Fuguet und sein Werk in den literarischen Kontext ein, beschreibt seine Zugehörigkeit zur McOndo-Bewegung und deren Einfluss auf seine Schreibweise. Es gibt einen Überblick über den Inhalt und bereitet die Analyse der strukturellen und erzählerischen Elemente vor.
Was wird in der Analyse der Binnen- und Rahmenhandlung untersucht?
Die Analyse der Binnenhandlung konzentriert sich auf den Erzähler, die Zeitstruktur und die inhaltlichen Bezüge zum Film, insbesondere wie filmische Elemente in Beltráns Leben integriert sind und welche Rolle Rollenschemata und die Beeinflussung der Wahrnehmung durch den Film spielen. Die Analyse der Rahmenhandlung konzentriert sich auf den Erzähler, die Zeitgestaltung, die subjektive Wahrnehmung und die inhaltlichen Bezüge zum Film, den Anlass der Filmliste, die Distanzierung vom Film und die Hinwendung zur Wissenschaft, sowie die Verwendung filmischer Fachsprache.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alberto Fuguet, Die Filme meines Lebens, filmisches Schreiben, McOndo, Film und Realität, Narrative Struktur, Erinnerung, Identität, chilenische Literatur, Intermedialität.
- Citar trabajo
- Neele Meyer (Autor), 2010, Die Funktion des Films und das filmische Schreiben in Alberto Fuguets 'Die Filme meines Lebens', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214902