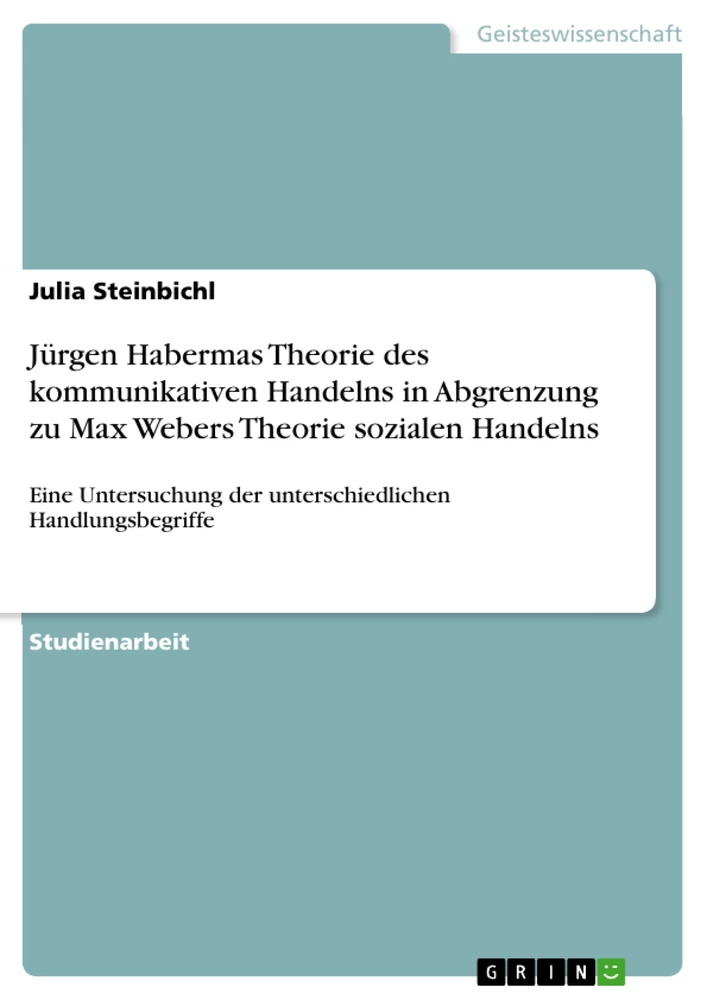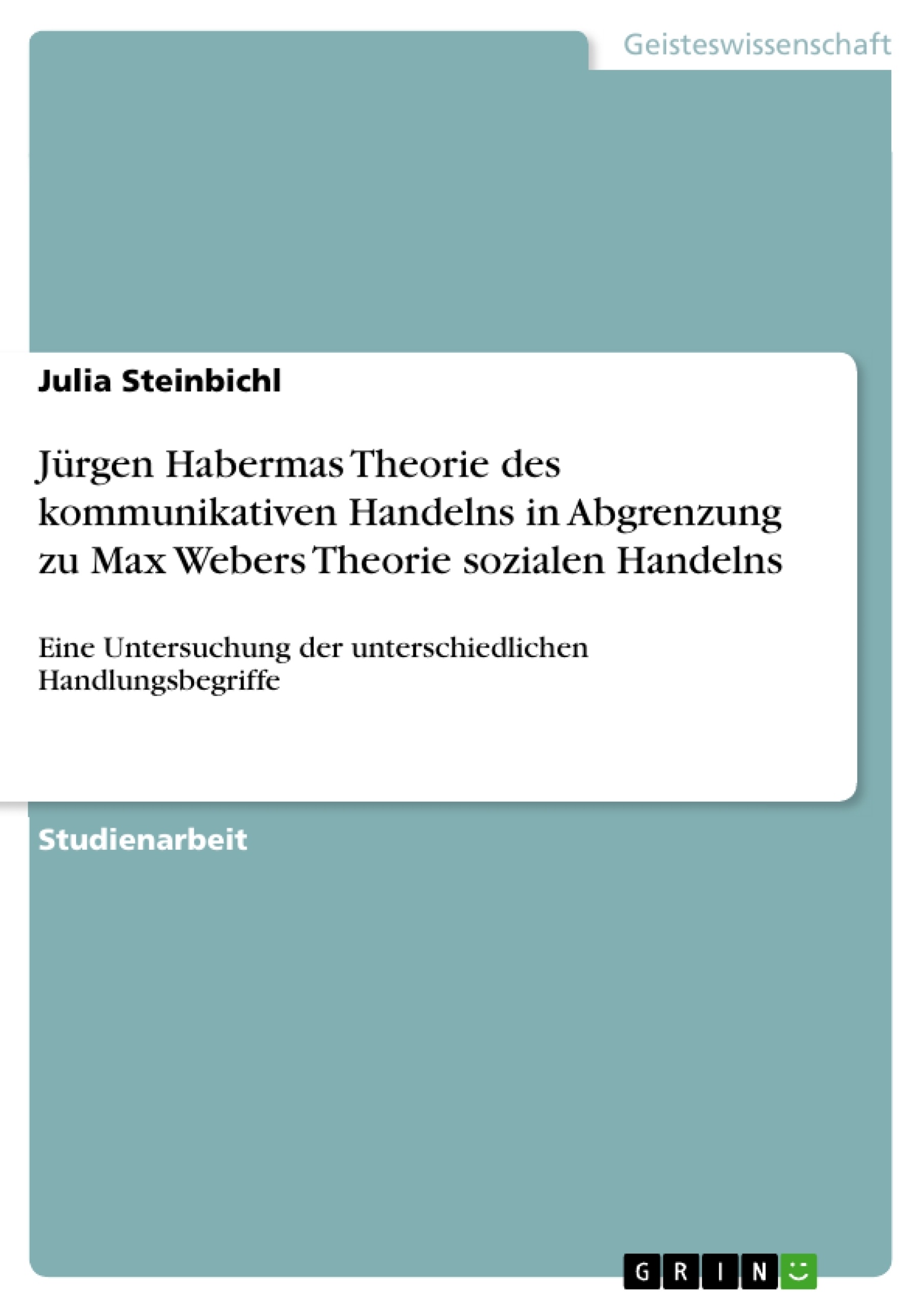Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, durch welche Spezifika sich die seitens Jürgen Habermas´ und Max Webers verwendeten Handlungsbegriffe auf der mikrotheoretischen Ebene jeweils voneinander abgrenzen lassen. Zuerst soll hierfür auf ein paar wenige bezüglich der Theorie kommunikativen Handelns grundlegende Punkte eingegangen werden (2) – es werden Jürgen Habermas´ Wissenschaftsauffassung und seine kritische Theorie näher beleuchtet, was dem weiteren Verständnis seiner Entwicklung der Theorie kommunikativen Handelns und seiner ihm hierbei vertretenen Denkweise dienen soll, bevor der Weg von seiner Universalpragmatik hin zu seiner Theorie kommunikativen Handelns kurz überblicksartig dargestellt wird (3). Daran anschließend wird der bei Habermas verwendete Begriff kommunikativen Handelns Webers Begriff sozialen Handelns gegenübergestellt (4), um die jeweiligen Spezifika der seitens der Autoren verwendeten Handlungsbegriffe näher zu beleuchten und sie systematisch voneinander abzugrenzen. Abschließend sollen dann im Fazit nochmals alle Ergebnisse dieser Arbeit kurz subsumiert werden (5), um der Frage nachzugehen, wo die spezifischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der verschiedenen Handlungsorientierungen von Habermas und Weber liegen.
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
2 GRUNDLEGENDES
2.1 HABERMAS´ WISSENSCHAFTSAUFFASSUNG
2.2 DIE ENTSTEHUNG DES BEGRIFFS KOMMUNIKATIVEN HANDELNS AUS DER KRITISCHEN THEORIE
3 VON DER UNIVERSALPRAGMATIK ZUR THEORIE KOMMUNIKATIVEN HANDELNS IM KURZEN ÜBERBLICK
4 HABERMAS´ BEGRIFF KOMMUNIKATIVEN HANDELNS IN ABGRENZUNG ZU WEBERS BEGRIFF SOZIALEN HANDELNS
4.1 HABERMAS´ HANDLUNGSORIENTIERUNGEN
4.1.1 TELEOLOGISCHES HANDELN
4.1.2 NORMENGELEITETES HANDELN
4.1.3 DRAMATURGISCHES HANDELN
4.2 WEBERS HANDLUNGSORIENTIERUNGEN
4.2.1 ZWECKRATIONALES HANDELN
4.2.2 WERTRATIONALES HANDELN
4.2.3 AFFEKTUELLES HANDELN UND TRADITIONALES
5 FAZIT
6 LITERATURVERZEICHNIS
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Habermas und Weber?
Die Arbeit untersucht die Abgrenzung von Habermas' Begriff des "kommunikativen Handelns" zu Webers Begriff des "sozialen Handelns" auf mikrotheoretischer Ebene.
Welche Handlungsorientierungen unterscheidet Jürgen Habermas?
Habermas unterscheidet zwischen teleologischem Handeln, normengeleitetem Handeln und dramaturgischem Handeln.
Wie definiert Max Weber soziales Handeln?
Weber unterteilt Handeln in zweckrationales, wertrationales, affektuelles und traditionales Handeln.
Was versteht man unter Universalpragmatik bei Habermas?
Die Universalpragmatik ist die theoretische Vorstufe zur Theorie des kommunikativen Handelns und befasst sich mit den allgemeinen Voraussetzungen sprachlicher Verständigung.
Welche Rolle spielt die "Kritische Theorie" für diese Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Entstehung des Begriffs des kommunikativen Handelns aus der Tradition der Kritischen Theorie heraus.
Was ist das Ziel des systematischen Vergleichs?
Es sollen die spezifischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der verschiedenen Handlungsorientierungen beider Soziologen herausgearbeitet werden.
- Arbeit zitieren
- Julia Steinbichl (Autor:in), 2013, Jürgen Habermas Theorie des kommunikativen Handelns in Abgrenzung zu Max Webers Theorie sozialen Handelns, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214930