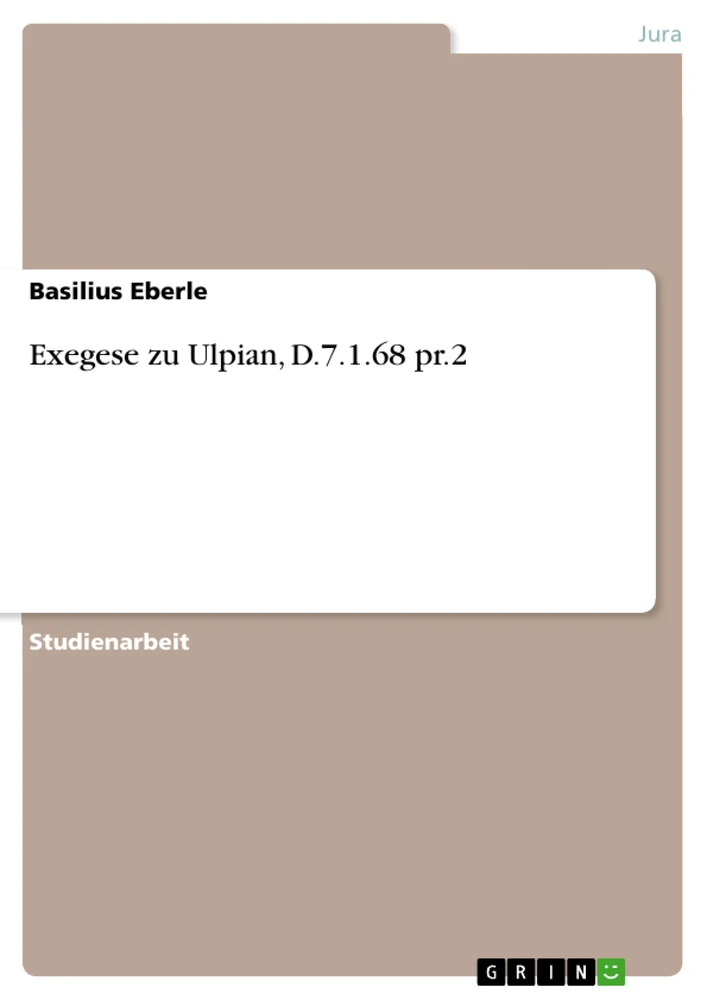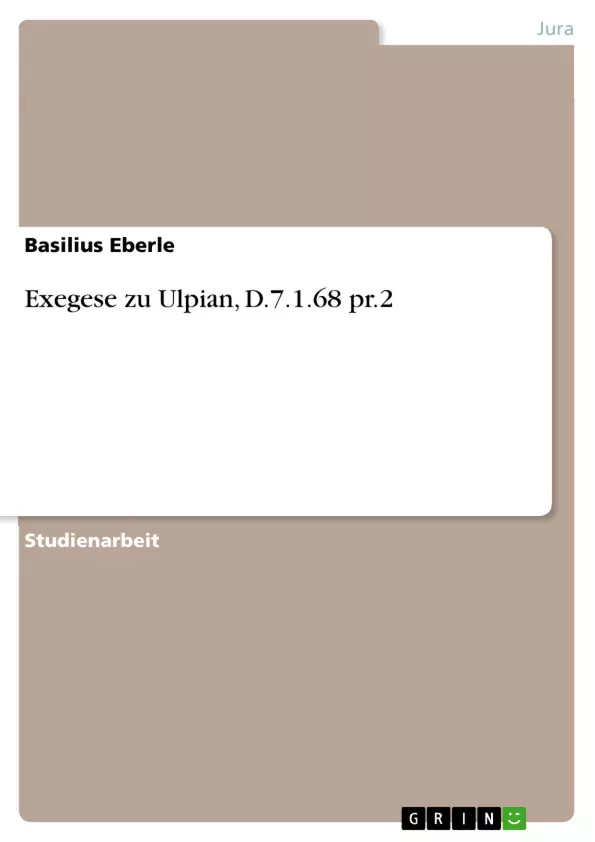Ulpianus libro septimo decimo ad Sabinum
Vetus fuit questio, an partus ad fructuarium pertineret: sed Bruti sententia optinuit fructuarium in eo locum non habere: neque enim in fructu hominis homo esse potest. Hac ratione nec usum fructum in eo fructuarius habebit. Quid tamen si fuerit etiam partus usus fructus relictus, an habeat in eo usum fructum? Et cum possit partus leagri, poterit et usus fructus eius. 1. Fetus tamen pecorum Sabinus et Cassius opinati sunt ad fructuarium pertinere. 2. Plane si gregis vel armenti sit usus fructus legatus, debebit ex adgnatis gregem supplere, id est in locum capitum defunctorum.
Domitius Ulpian
Domitius Ulpian war ein römischer Jurist und Prätorianerpräfekt. Er wurde etwa 170 n. Chr. geboren . Wie Paulus war er unter Severus und Caracalla Assessor (Beisitzer) des Prätorianerpräfekten Papinian . Was seine Herkunft angeht, so geht sie aus den Quellen nicht klar hervor. Ulpian selbst beschreibt sie in D.50.15.1 pr.: Er nennt hier die Provinzialstadt Tyros in Phönizien (dem heutigen Südlibanon) als einen möglichen Geburtsort . Unter Elagabal musste er ebenso wie Paulus in die Verbannung . Über die nächsten Stufen seiner Laufbahn besteht ebenso Uneinigkeit . Oft wird die folgende Reihenfolge angenommen: Zuerst wurde Ulpian von Severus Alexander zum procurator a libellis (Leiter für Privatanfragen in der kaiserlichen Kanzlei), dann zum praefectus annonae (Getreidepräfekt) und letztendlich zum praefectus preatorio (Prätorianerpräfekt) befördert . In diesem Amt hatte Ulpian großen Einfluss auf den jungen Kaiser Severus. Er wurde aufgrund wiederkehrender Differenzen mit den Prätorianern bei einem nächtlichen Aufruhr 228 n. Chr. ermordet. Andere Quellen sprechen schon von einer früheren Ermordung im Jahr 223 n. Chr. .
Inhaltsverzeichnis
- Übersetzung D.7.1.68 pr.2
- Inskription
- Domitius Ulpian
- Bedeutung seiner Digesten
- Masurius Sabinus
- Cassius Longinus
- M. Junius Brutus
- Inhalt von Buch 17, Fundstelle in den Digesten
- Erörterung des juristischen Problems
- Sachverhalt der Stelle 7.1.68 pr.: partus ancillae in fructu non est
- Die Begründung des Brutus
- Die Gegenmeinung des P. Mucius Scaevola und des Manius Manilius
- Die Begründungen des Ulpian
- Die Begründung des Gaius
- Das Vermächtnis an der Leibesfrucht und am Nießbrauch
- Der Sachverhalt der Stelle 7.1.68.1: Nießbrauch an Tierjungen
- Der Sachverhalt der Stelle 7.1.68.2: Der Herdennießbrauch
- Die Summissionspflicht des Herdennießbrauchers
- Dogmatische Begründung der Summissionspflicht
- Der Umfang der Summissionspflicht beim Herdennießbrauch
- Sachverhalt der Stelle 7.1.68 pr.: partus ancillae in fructu non est
- Vergleich mit deutschem Recht
- Sachverhalt 1: Partus ancillae
- Sachverhalt 2: Der Nießbrauch an Tierjungen
- Bildung eines Vergleichsfalles
- Lösung des Vergleichsfalles nach BGB
- Dogmatische Betrachtung
- Sachverhalt 3: Der Herdennießbrauch
- Bildung eines Vergleichsfalles nach BGB
- Lösung des Vergleichsfalles
- Dogmatische Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Exegese zu Ulpian, D.7.1.68 pr.2 im Rahmen des Grundlagenseminars Digestenexegese im Wintersemester 2012/2013 befasst sich mit der Frage der Leibesfrucht im römischen Recht. Die Arbeit untersucht die verschiedenen juristischen Ansichten zu diesem Thema, insbesondere die Meinung des Brutus, die die gängige Praxis widerspiegelte. Dabei wird der Fokus auf die Definition der Leibesfrucht als Rechtsobjekt, den Nießbrauch an der Leibesfrucht und die Summissionspflicht des Nießbrauchers gelegt.
- Definition der Leibesfrucht im römischen Recht
- Nießbrauch an der Leibesfrucht
- Summissionspflicht des Nießbrauchers
- Vergleich mit deutschem Recht
- Dogmatische Analyse der römischen und deutschen Rechtsprechung
Zusammenfassung der Kapitel
- **Übersetzung D.7.1.68 pr.2**: Die Übersetzung des Textes von Ulpian beleuchtet die bestehende Streitfrage, ob die Leibesfrucht dem Nießbraucher zusteht, und präsentiert die Argumentation des Brutus, der die gängige Meinung vertritt, dass die Leibesfrucht nicht dem Nießbraucher gehört. Der Text verweist auf die Übertragbarkeit von Nießbrauch auf die Leibesfrucht, obwohl sie nicht der Frucht des Nießbrauchers entspricht.
- **Inskription**: Dieser Abschnitt stellt Domitius Ulpian als bedeutenden römischen Juristen und Prätorianerpräfekt vor. Die Bedeutung seiner Werke für die Digesten wird hervorgehoben, ebenso wie die Rolle von Sabinus und Cassius. Der Text beleuchtet die Bedeutung von Ulpians Schriften und seinen Einfluss auf die Entwicklung des römischen Rechts.
- **Erörterung des juristischen Problems**: Dieser Abschnitt untersucht die unterschiedlichen juristischen Meinungen zum Thema Leibesfrucht im Nießbrauch. Es werden die Argumente des Brutus, die Gegenmeinungen von Scaevola und Manilius sowie die Begründungen des Ulpian vorgestellt. Der Text analysiert die Rechtsfrage anhand verschiedener Sachverhalte, um die unterschiedlichen Argumentationen der Juristen zu verdeutlichen.
- **Vergleich mit deutschem Recht**: Dieser Abschnitt vergleicht die römischen Rechtsauffassungen zur Leibesfrucht mit dem deutschen Recht. Es werden anhand von Vergleichsfällen die jeweiligen Rechtsnormen analysiert und die dogmatischen Unterschiede zwischen den beiden Rechtssystemen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Exegese zu Ulpian, D.7.1.68 pr.2 befasst sich mit zentralen Themen des römischen Rechts, insbesondere im Bereich des Sachenrechts und des Nießbrauchs. Die Arbeit fokussiert auf die juristische Definition der Leibesfrucht als Rechtsobjekt, die Übertragbarkeit des Nießbrauchs auf die Leibesfrucht sowie die dogmatische Begründung der Summissionspflicht des Nießbrauchers. Die Analyse von verschiedenen Sachverhaltskonstellationen ermöglicht einen Vergleich mit deutschem Recht und liefert einen tieferen Einblick in die komplexen Strukturen der römischen Rechtsordnung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war der römische Jurist Domitius Ulpian?
Ulpian (ca. 170–228 n. Chr.) war ein bedeutender römischer Jurist und Prätorianerpräfekt, dessen Schriften einen großen Teil der Digesten des Kaisers Justinian ausmachen.
Was war die "Vetus questio" bezüglich der Leibesfrucht (partus)?
Es war die alte Streitfrage, ob die Nachkommen einer Sklavin (partus ancillae) dem Nießbraucher als "Frucht" zustehen oder dem Eigentümer verbleiben.
Warum gehört die Leibesfrucht laut Brutus nicht zum Nießbraucher?
Brutus vertrat die Ansicht, dass ein Mensch nicht die Frucht eines anderen Menschen sein kann ("neque enim in fructu hominis homo esse potest").
Was versteht man unter der Summissionspflicht beim Herdennießbrauch?
Der Nießbraucher einer Herde ist verpflichtet, verendete Tiere durch Jungtiere aus der Herde zu ersetzen, um den Bestand für den Eigentümer zu erhalten.
Wie unterscheidet sich das römische Recht zum Nießbrauch vom BGB?
Die Arbeit vergleicht die antiken Regelungen mit dem modernen deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und analysiert dogmatische Unterschiede bei Tierjungen und Sachfrüchten.
Welche Rolle spielten Sabinus und Cassius in dieser Rechtsfrage?
Sabinus und Cassius vertraten die Meinung, dass Jungtiere (fetus pecorum) im Gegensatz zu Menschenkindern dem Nießbraucher als Früchte zustehen.
- Quote paper
- Dipl. Kaufmann Basilius Eberle (Author), 2013, Exegese zu Ulpian, D.7.1.68 pr.2, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214989