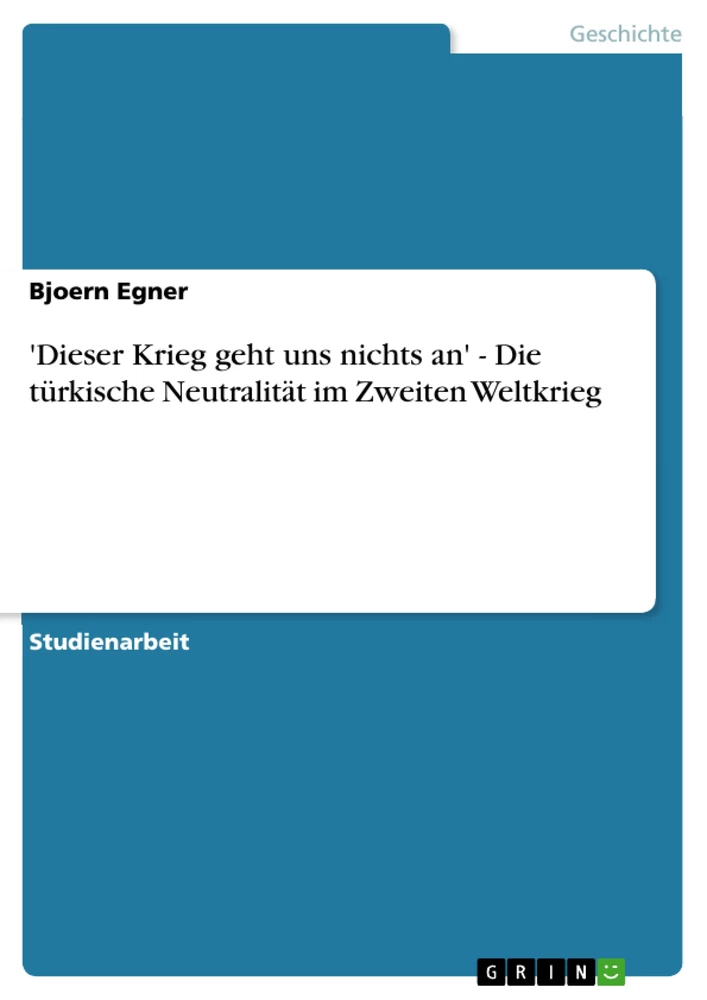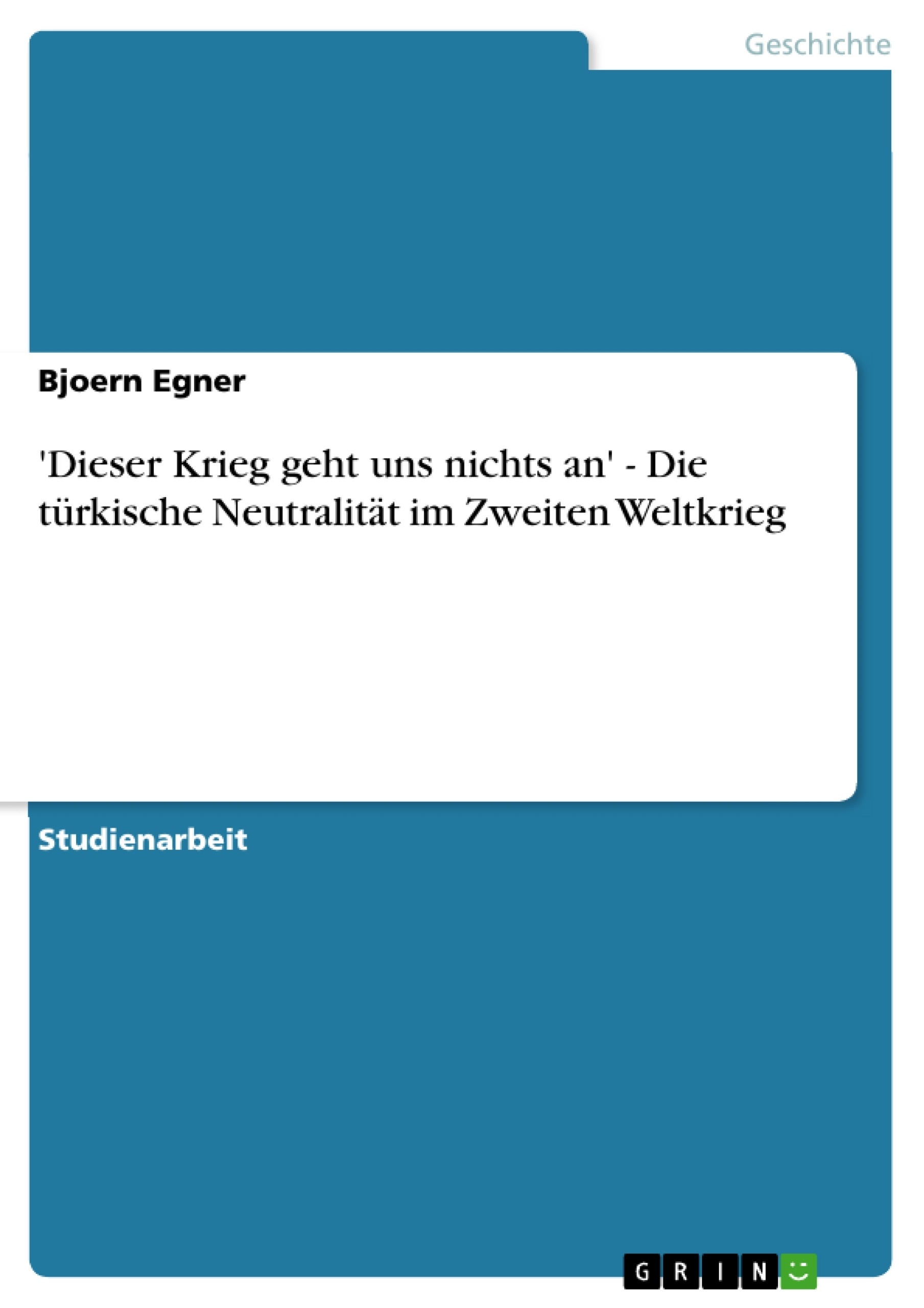Die vorliegende Arbeit behandelt die Außenpolitik des Deutschen Reiches gegenüber der Türkei zwischen dem Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 und dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im Dezember 1941, wobei der Schwerpunkt der
Betrachtung auf dem Jahr 1941 liegt. Der Arbeit liegen folgende Fragen zugrunde: Wie hat es die Türkei bewerkstelligt, im gesamten Verlauf des Zweiten Weltkrieges nicht in militärische Auseinandersetzungen verwickelt zu werden? Welchen Strategien sind die kriegsführenden Mächte bezüglich der Türkei gefolgt? Kann die Position der Türkei im
Krieg als „neutral“ bezeichnet werden?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE JUNGE TÜRKISCHE REPUBLIK
- KEMALISMUS UND AUBENPOLITIK.
- SICHERUNG DURCH VERTRÄGE
- ITALIEN AUF DEM BALKAN
- DAS DIPLOMATISCHE RINGEN UM NEUTRALITÄT...
- DEUTSCHE INTERESSEN IN KLEINASIEN
- DIE DARDANELLENFRAGE
- ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DER SOWJETUNION
- BULGARIEN, JUGOSLAWIEN UND DER BALKANPAKT
- DAS VERHÄLTNIS ZU DEN WESTMÄCHTEN.
- DER HANDEL MIT DEN KRIEGSPARTEIEN.
- DIE TÜRKISCHE NEUTRALITÄT IM SPIEGEL DES VÖLKERRECHTS.
- KRIEGSEINTRITT KURZ VOR ZWÖLF.
- SCHLUBFOLGERUNG....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Außenpolitik des Deutschen Reiches gegenüber der Türkei während des Zweiten Weltkrieges, insbesondere im Jahr 1941. Sie analysiert die Strategien der Kriegsführenden Mächte in Bezug auf die Türkei und untersucht, wie die Türkei ihre Neutralität während des gesamten Krieges aufrechterhalten konnte. Die Arbeit widmet sich auch der Frage, ob die Position der Türkei als „neutral“ bezeichnet werden kann.
- Die innen- und außenpolitische Situation der Türkei nach der Republikgründung
- Die Neutralitätsstrategie der Türkei während der „heißen Phase“ des Zweiten Weltkrieges
- Die deutschen Interessen in Kleinasien und die Dardanellenfrage
- Das Verhältnis der Türkei zu den Kriegsführenden Mächten (Deutschland, Sowjetunion, Westmächte)
- Die völkerrechtliche Dimension der türkischen Neutralität
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die allgemeine innen- und außenpolitische Lage der Türkei nach der Republikgründung dar, mit besonderem Augenmerk auf die Situation am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Es erläutert die Prinzipien des Kemalismus, die die türkische Politik in dieser Zeit prägten.
Das dritte Kapitel untersucht die Neutralitätsstrategie der Türkei während der „heißen Phase“ des Weltkriegs. Es analysiert die deutschen Interessen in Kleinasien, die Dardanellenfrage, den deutsch-sowjetischen Konflikt, den Balkankonflikt und die Beziehungen der Türkei zu den Westmächten. Es beleuchtet auch die Handelspolitik der Türkei gegenüber den Kriegsführenden Parteien und die völkerrechtliche Dimension der türkischen Neutralität.
Das vierte Kapitel befasst sich kurz mit der türkischen Außenpolitik nach dem Scheitern der deutschen Expansionspläne.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: türkische Außenpolitik, Zweiter Weltkrieg, Neutralität, Kemalismus, deutsche Interessen in Kleinasien, Dardanellenfrage, deutsch-sowjetischer Konflikt, Balkankonflikt, Beziehungen zu den Westmächten, Handelspolitik, Völkerrecht.
- Quote paper
- Bjoern Egner (Author), 2000, 'Dieser Krieg geht uns nichts an' - Die türkische Neutralität im Zweiten Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2150