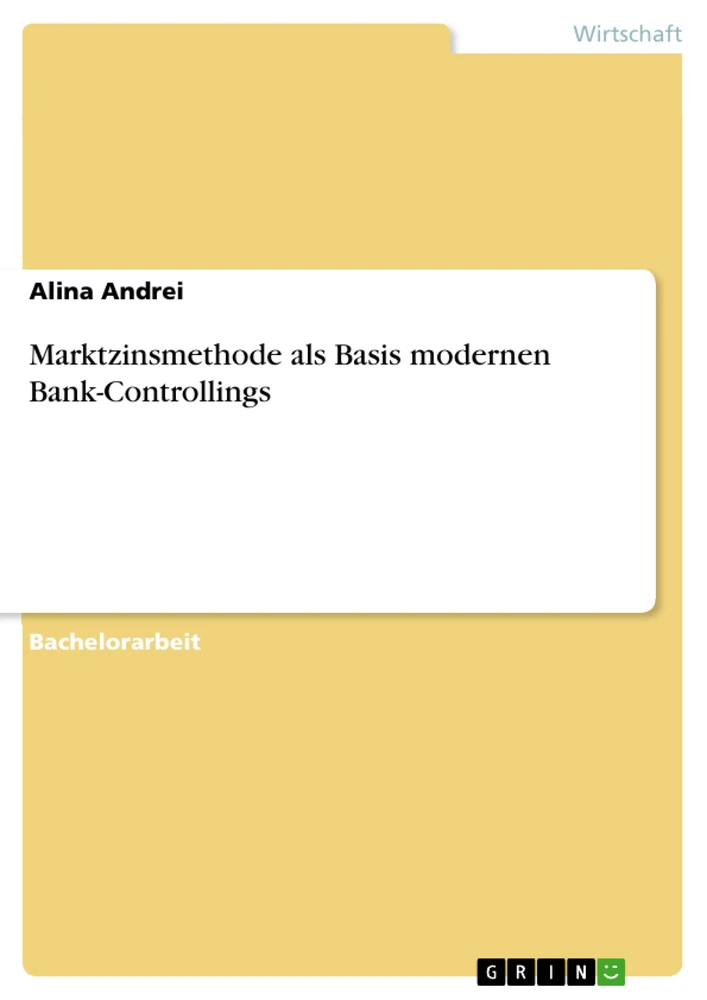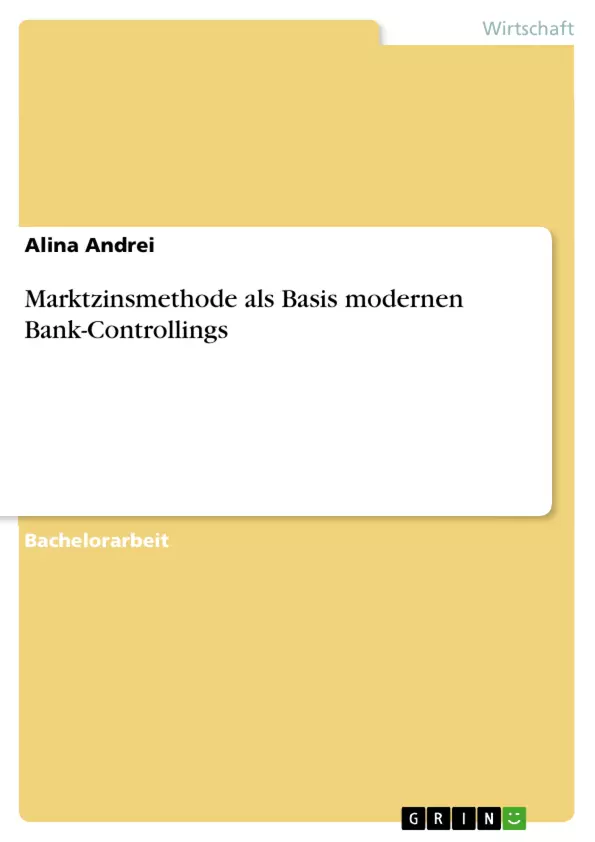Bei der Verrechnung von Ressourcen und Dienstleistungen zwischen organisatorischen Einheiten eines Unternehmens werden interne Transferpreise bedeutsam. Nach Ewert/Wagenhofer sind Transferpreise „Wertansätze für innerbetrieblich erstellte Leistungen (Produkte, Zwischenprodukte, Dienstleistungen), die von anderen, rechnerisch abgegrenzten Unternehmensbereichen bezogen werden.“
Diese abstrakte Definition soll etwas anschaulicher dargestellt werden. Kreditinstitute stellen dem Kunden traditionell Liquidität zur Verfügung, agieren hierbei einerseits als Liquiditätsversorger (Spareinlagen), andererseits als Liquiditätsverbraucher (Kreditvergabe). Diese dafür benötigten Ressourcen Liquidität und Kapital werden jedoch nicht von der kreditgebenden Abteilung eingeworben, sondern stattdessen von spezialisierten Refinanzierungs- und Kreditabteilungen. Schaut man also genauer in eine Bank hinein, so stellt man fest, dass es eine Art „Bank in der Bank“ gibt, welche intermediär zwischen den mitteleinwerbenden und den mittelausgebenden Abteilungen agiert – das sogenannte Treasury der Bank. Dieses bildet die Grundlage für eine konsistente Produktkalkulation, die jedem Produkt jenen Preis zuweise, der einen positiven Beitrag zur risikogerechten Eigenkapitalrendite leistet.
Obwohl Transferpreise schon im frühen 20. Jahrhundert diskutiert wurden, stellen Sie auch heute noch eine aktuelle Thematik dar. Die Marktzinsmethode ermittelt die Zusammensetzung eines Zinsergebnisses verursachungsgerecht. Während diese zur Verrechnung von Transferpreisen sowohl in der europäischen als auch angelsächsischen Hemisphäre weitgehend verbreitet sind, ist dies in vielen Ländern Osteuropas noch in Entwicklung. Um die Relevanz und das Konzept der Marktzinsmethode zu verdeutlichen, möchte ich dieses Thema in meiner Arbeit genauer behandeln.
Inhaltsverzeichnis
- Marktzinsmethode als Basis modernen Bank-Controllings
- Einführung - Bank
- Bedeutsamkeit der Marge
- Die Steuerungsfunktion der Marge
- Konzeptionelles Anforderungsprofil der Marge
- Basiskonzept der Marktzinsmethode
- Marktzinsmethode als Zentrale Kalkulationsmethode
- Unvollkommenheit der Geld- und Kapitalmärkte
- Opportunitätsprinzip, Engpassprinzip und Gegenseitenkonzept
- Opportunitätsprinzip
- Engpassprinzip
- Gegenseitenprinzip (Gegenpositionsprinzip)
- Grundsätze zur Marktzinsmethode
- Risiko Neutralität
- Exklusivität
- Singularität
- Grenzwertigkeit
- Unternehmensfortführung
- Marktwert
- Der Strukturbeitrag als Transformationskomponente
- Einführung
- Beispiel
- Der Konditionsbeitrag als Basis der Deckungsbeitragskalkulation
- Einführung
- Komponenten zum Konditionsbeitrag
- Beispiel
- Bedeutung des Konditionsbeitrags für die Marktbereiche
- Bedeutung des Konditionsbeitrags für den Planungsprozess
- Zusammenführung von Struktur- und Konditionsbeitrag zum Zinsüberschuss
- Produktbezogene Steuerung
- Buchhalterische Betrachtungsweise (Accounting veiw)
- Einführung
- Beispiel
- Geschäftsstellenbezogene Informationen
- Schlussfolgerung
- Gesamtbanksteuerung
- Mitarbeiterbezogene Steuerung
- Kundenbezogene Steuerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Marktzinsmethode als Grundlage für modernes Bank-Controlling. Ziel ist es, das Konzept der Marktzinsmethode zu erläutern und deren Bedeutung für die Steuerung und Kontrolle von Banken aufzuzeigen. Dabei werden die wichtigsten Prinzipien und Komponenten der Methode sowie ihre praktische Anwendung in der Bankenpraxis dargestellt.
- Die Steuerungsfunktion der Marge in Banken
- Die Marktzinsmethode als zentrale Kalkulationsmethode
- Die Prinzipien der Risiko Neutralität, Exklusivität und Singularität
- Die Bedeutung des Struktur- und Konditionsbeitrags für die Zinsüberschusskalkulation
- Die Anwendung der Marktzinsmethode in verschiedenen Steuerungsbereichen wie Produkt-, Geschäftsstellen- und Kundenbezogene Steuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise von Banken. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Marge als Steuerungsinstrument in Banken. Kapitel drei behandelt die Marktzinsmethode als Grundlage für die Kalkulation von Zinsüberschüssen und erklärt die wichtigsten Prinzipien der Methode. Kapitel vier erläutert das Konzept der Opportunitätskosten, des Engpassprinzips und des Gegenseitenkonzepts im Kontext der Marktzinsmethode. Kapitel fünf präsentiert die zentralen Prinzipien der Marktzinsmethode wie Risiko Neutralität, Exklusivität, Singularität, Grenzwertigkeit, Unternehmensfortführung und Marktwert. Die Kapitel sechs und sieben fokussieren auf den Strukturbeitrag und den Konditionsbeitrag als zentrale Komponenten der Marktzinsmethode. Kapitel acht zeigt die praktische Anwendung der Marktzinsmethode in Form einer graphischen Darstellung und anhand eines konkreten Beispiels. Kapitel neun beleuchtet die buchhalterische Betrachtungsweise der Marktzinsmethode und stellt die relevanten Informationen aus dem Bank Austria Financial Statements 2009 vor. Schließlich werden in Kapitel zehn die Möglichkeiten der Steuerung von Banken auf Produktebene, Geschäftsstellenebene, Mitarbeiterebene und Kundenebene vorgestellt.
Schlüsselwörter
Marktzinsmethode, Bank-Controlling, Marge, Zinsüberschuss, Strukturbeitrag, Konditionsbeitrag, Opportunitätsprinzip, Engpassprinzip, Gegenseitenprinzip, Risiko Neutralität, Exklusivität, Singularität, Grenzwertigkeit, Unternehmensfortführung, Marktwert, Steuerungsfunktion, Kalkulationsmethode, Produktbezogene Steuerung, Geschäftsstellenbezogene Steuerung, Mitarbeiterbezogene Steuerung, Kundenbezogene Steuerung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Marktzinsmethode im Bank-Controlling?
Es ist eine zentrale Kalkulationsmethode, die Zinsergebnisse verursachungsgerecht aufteilt, indem sie jedes Bankgeschäft mit einem alternativen Geschäft am Geld- und Kapitalmarkt vergleicht.
Was unterscheidet den Konditionsbeitrag vom Strukturbeitrag?
Der Konditionsbeitrag misst den Erfolg des Kundengeschäfts gegenüber dem Markt, während der Strukturbeitrag den Erfolg aus der Fristentransformation im Treasury der Bank darstellt.
Was bedeutet das "Opportunitätsprinzip"?
Es besagt, dass der Erfolg eines Geschäfts daran gemessen wird, welchen Ertrag oder welche Kosten eine alternative Anlage oder Aufnahme am Kapitalmarkt zum gleichen Zeitpunkt gehabt hätte.
Welche Steuerungsfunktionen hat die Marge in einer Bank?
Die Marge dient der Steuerung von Produkten, Geschäftsstellen, Mitarbeitern und Kunden, um sicherzustellen, dass jedes Geschäft einen positiven Beitrag zur Eigenkapitalrendite leistet.
Was sind die Grundsätze der Marktzinsmethode?
Wichtige Grundsätze sind Risiko-Neutralität, Exklusivität (eindeutige Zuordnung), Singularität und die Bewertung zu aktuellen Marktwerten.
- Citar trabajo
- Alina Andrei (Autor), 2010, Marktzinsmethode als Basis modernen Bank-Controllings, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215065