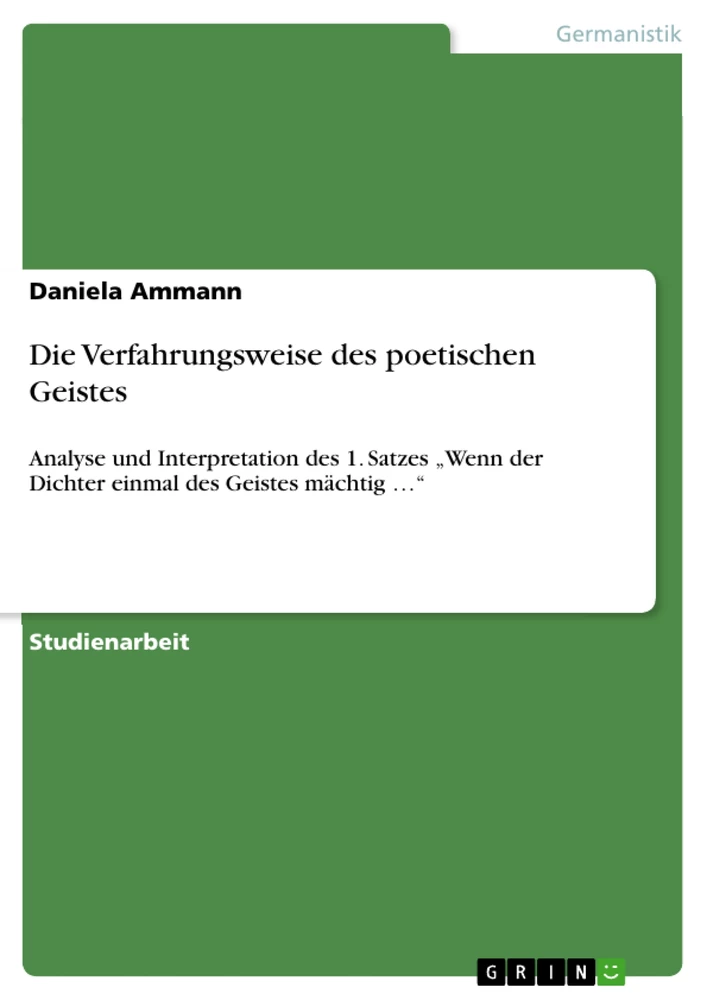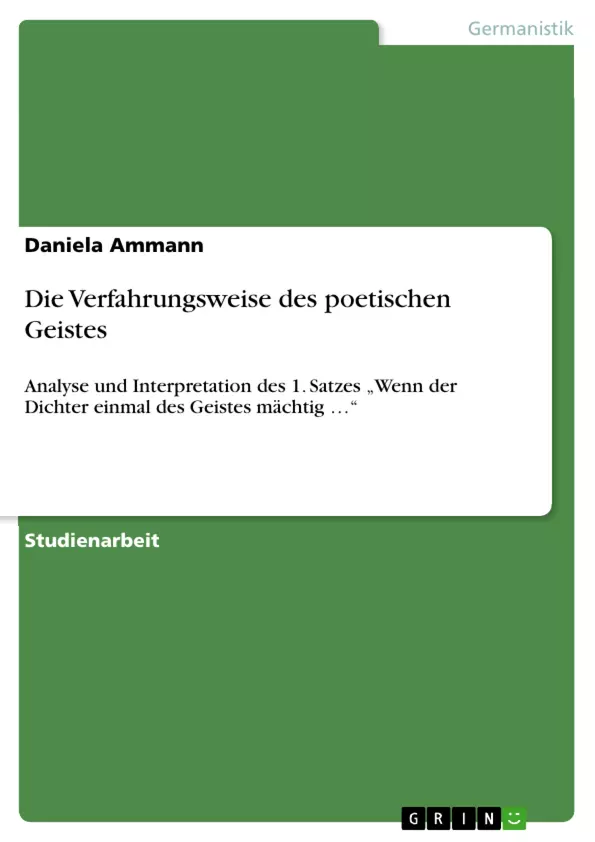Diese Arbeit wurde im Rahmen des Proseminars „Neuere Deutsche Literatur: Hölderlin“ verfasst. In der Lehrveranstaltung wurde sowohl das Leben als auch das Werk Hölderlin näher beleuchtet. In diesem Zusammenhang wird ins dieser Arbeit ein philosophisches Fragment von Hölderlin untersucht „Über die Verfahrungsweise des poetischen Geistes“. Da eine detaillierte Analyse dieses Fragments den Umfang dieser Proseminar-Arbeit sprengen würde, wird ausschließlich der erste Satz des Fragments „Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig …“ analysiert und interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hölderlins Position in der Philosophie
3. Über die Verfahrungsweise des poetischen Geistes
4. Zusammenfassung
5. Literaturverzeichnis
- Citar trabajo
- Daniela Ammann (Autor), 2013, Die Verfahrungsweise des poetischen Geistes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215104