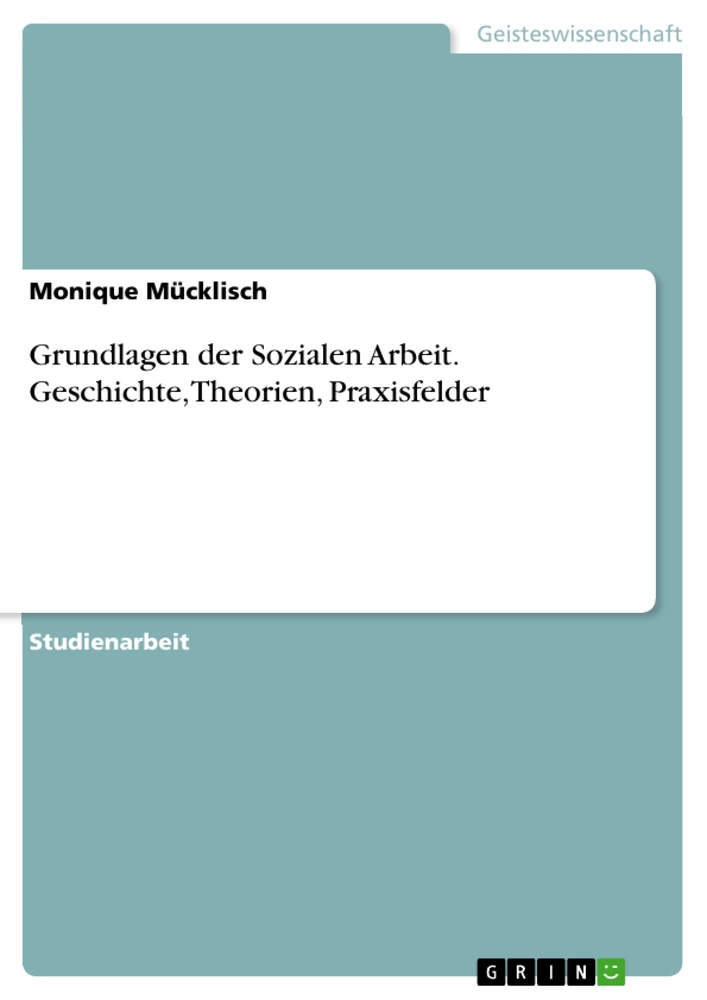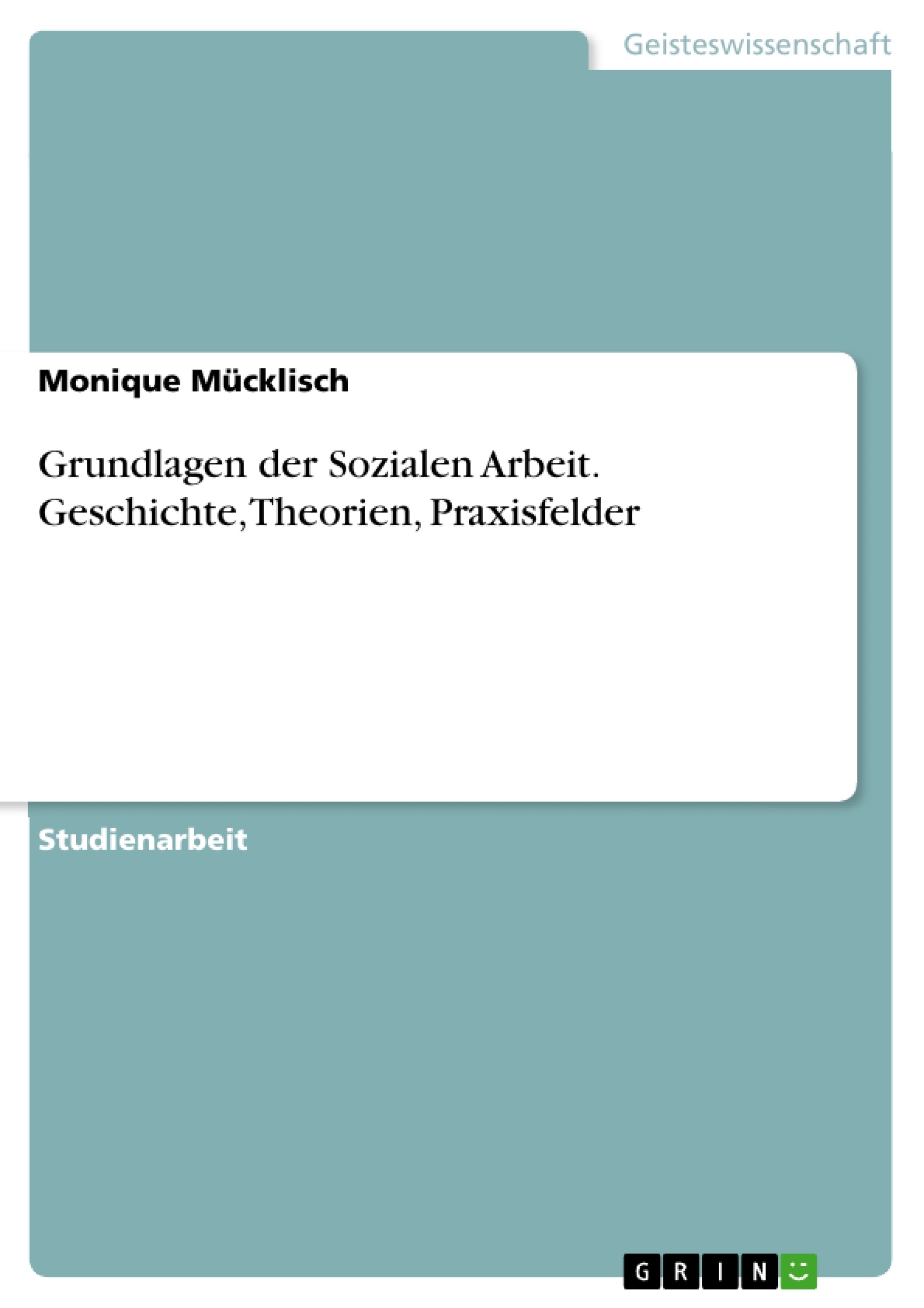Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der Sozialen Arbeit, d.h. mit der historischen Entwicklung, den Theorien der Sozialen Arbeit und den verschiedenen Praxisfeldern.
Zunächst werde ich die Entwicklung der Sozialen Arbeit in der Weimarer Republik beschreiben. Dabei gebe ich einen kurzen historischen Überblick und gehe danach über zur Entwicklung der Sozialen Arbeit in dieser Zeit. Der zweite Abschnitt der Arbeit beschäftigt sich mit einer Theorie der Sozialen Arbeit, wobei ich mich für die Hermeneutik entschieden habe und speziell auf die objektive Hermeneutik nach Ulrich Oevermann eingehen werde. Im letzten Abschnitt dieser Arbeit wird ein Praxisfeld der Sozialen Arbeit beschreiben. Ich möchte hier die Offene Kinder- und Jugendarbeit näher beschrieben. Nach einer allgemeinen Beschreibung des Praxisfeldes werde ich speziell auf das Kinder-Kultur-
Café „Camaleón“ in Görlitz eingehen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
A Soziale Arbeit in der Weimarer Republik
1. Historischer Überblick (1918/19-1933)
2. Die Entwicklung der Sozialen Arbeit
2.1 Die Situation der Bevölkerung
2.2 Die Entwicklung der Profession innerhalb der Wohlfahrtspflege
2.3 Die Verrechtlichung der sozialen Arbeit
2.4 Die Entwicklung der Familienfürsorge
3. Resümee
B Die Hermeneutik
1. Begriffsbestimmung
2. Die objektive Hermeneutik nach Ulrich Oevermann
2.1 Kurzbiografie Ulrich Oevermann
2.2 Methodologie der objektiven Hermeneutik
2.3 Zentrale Begriffe der objektiven Hermeneutik
2.3.1 Latente Sinnstrukturen und objektive Bedeutungsstrukturen
2.3.2 Text und Protokoll
2.3.3 Sequenzanalyse und Fallrekonstruktion
3. Resümee
C Offene Kinder- und Jugendarbeit
1. Begriffsbestimmung
2. Kurzbeschreibung der Tätigkeit
3. Grundprinzipien der offenen Jugendarbeit
3.1 Das Prinzip der Offenheit
3.2 Das Prinzip der Freiwilligkeit
3.3 Das Prinzip der Partizipation
4. Angewandte Methoden
4.1 Einzelfallhilfe
4.2 Gruppenarbeit
4.3 Gemeinwesenarbeit
5. Abgrenzung gegenüber angrenzenden Formen der
Sozialen Jugendarbeit
6. Das Kinder-Kultur-Café „Camaleón“ in Görlitz
6.1 Der Aufbau des Vereins
6.2 Leitbild
6.3 Handlungsprinzipien
6.4 Ziele
7. Resümee
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich die Soziale Arbeit in der Weimarer Republik?
In dieser Zeit kam es zu einer starken Verrechtlichung, Professionalisierung der Wohlfahrtspflege und dem Ausbau der Familienfürsorge.
Was ist die „objektive Hermeneutik“ nach Ulrich Oevermann?
Es handelt sich um eine Methode zur Rekonstruktion latenter Sinnstrukturen in Texten, die in der Forschung der Sozialen Arbeit zur Fallanalyse genutzt wird.
Was sind die Grundprinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit?
Die Arbeit basiert auf den Prinzipien der Offenheit (Zugang für alle), der Freiwilligkeit der Teilnahme und der Partizipation (Mitbestimmung) der Jugendlichen.
Welches konkrete Praxisprojekt wird in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt das Kinder-Kultur-Café „Camaleón“ in Görlitz als Beispiel für ein gelungenes Projekt der offenen Jugendarbeit.
Welche Methoden kommen in der Jugendarbeit zum Einsatz?
Zu den angewandten Methoden gehören die Einzelfallhilfe, die Gruppenarbeit sowie die Gemeinwesenarbeit.
- Quote paper
- Bachelor of Arts - Soziale Arbeit Monique Mücklisch (Author), 2010, Grundlagen der Sozialen Arbeit. Geschichte, Theorien, Praxisfelder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215186