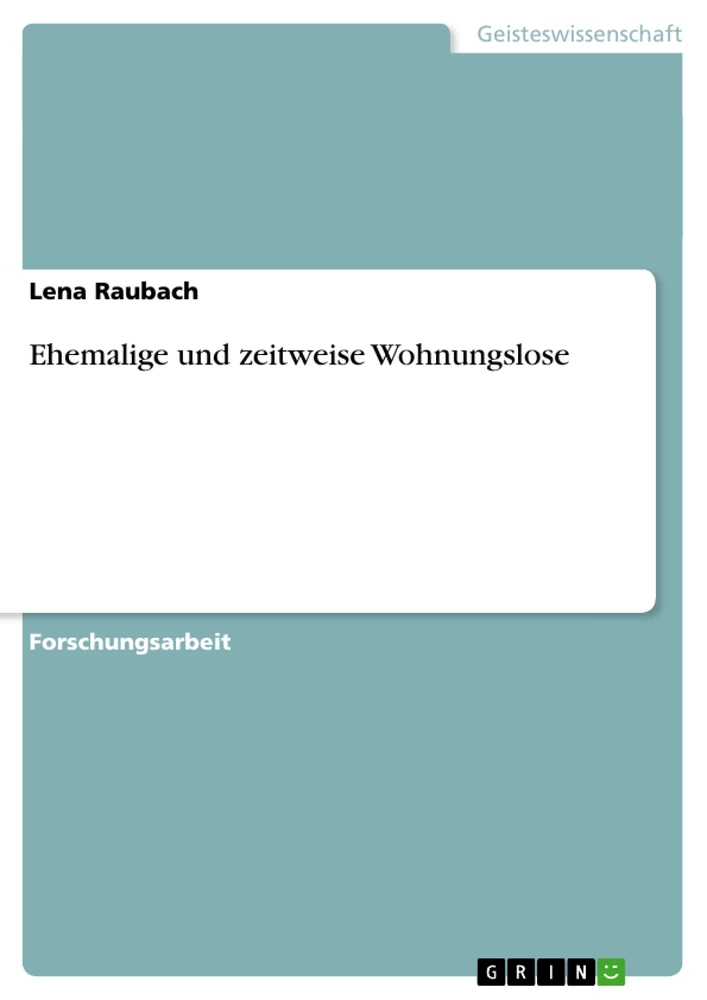1. Einleitung
Zu Beginn des Semesters besuchte ich zuerst eine andere Veranstaltung zum Thema „Forschung 2“. Ich hatte mich bei Herrn Hanesch zum Thema „Forschung 2 – Soziale Stadt“ eingetragen, erkannte aber recht schnell, dass das aus persönlichen und organisatorischen Gründen nicht mein Forschungsthema sein würde.
Also sprach ich Sie an, Herr Nölke, ob ich denn in ihren Kurs wechseln könnte, da ich von den Kommilitonen und Kommilitoninnen ihres Kurses sehr viel Positives zu hören bekam.
Das war zum Glück ja auch kein Problem und ich konnte mich der Gruppe von Tina Rüger anschließen. Dort stand die Zielgruppe schon fest. Frau Rüger wollte auf Grund ihres nebenberuflichen Hintergrundes und der daraus resultierenden Beziehungen und Vernetzungen, Interviews mit obdachlosen Menschen führen.
Für mich war das ein sehr neuer Themen- und Arbeitsbereich mit dem ich mich noch nie beschäftigt hatte und der ganze neue Inhalte für mich spiegelte. Ich war allerdings gerne bereit mich auf dieses neue Gebiet einzulassen und war auch gespannt, was mir dort so begegnen würde. Hinzu kam, dass ich gerne meine eigenen Vorstellungen von den Menschen die obdachlos sind und ihrem daraus resultierenden Alltag und den damit verbundenen Komplikationen und auch Chancen, überprüfen wollte.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Empirische Sozialforschung
2.1. Empirische Sozialforschung – eine Begriffsklärung
2.2. Ziele der empirischen Sozialforschung
2.3. Überblick über qualitative und quantitative Sozialforschung
2.4. Das narrative Interview
3. Empirische Auswertung
3.1. Aufbau des Interviews
3.2. Kontaktaufnahme
3.3. Daten zur Person
3.4. Kurze Chronologie
3.5. Erste Strukturhypothesen anhand der objektiven Daten
3.6. Transkriptionssystem nach Kallmeyer und Schütze
3.7. Transkription des Interviews
3.8. Exemplarische Interpretation der Segmente 1,2 und 3
4. Schlussbetrachtung
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Zu Beginn des Semesters besuchte ich zuerst eine andere Veranstaltung zum Thema „Forschung 2“. Ich hatte mich bei Herrn Hanesch zum Thema „Forschung 2 – Soziale Stadt“ eingetragen, erkannte aber recht schnell, dass das aus persönlichen und organisatorischen Gründen nicht mein Forschungsthema sein würde.
Also sprach ich Sie an, Herr Nölke, ob ich denn in ihren Kurs wechseln könnte, da ich von den Kommilitonen und Kommilitoninnen ihres Kurses sehr viel Positives zu hören bekam.
Das war zum Glück ja auch kein Problem und ich konnte mich der Gruppe von Tina Rüger anschließen. Dort stand die Zielgruppe schon fest. Frau Rüger wollte auf Grund ihres nebenberuflichen Hintergrundes und der daraus resultierenden Beziehungen und Vernetzungen, Interviews mit obdachlosen Menschen führen.
Für mich war das ein sehr neuer Themen- und Arbeitsbereich mit dem ich mich noch nie beschäftigt hatte und der ganze neue Inhalte für mich spiegelte. Ich war allerdings gerne bereit mich auf dieses neue Gebiet einzulassen und war auch gespannt, was mir dort so begegnen würde. Hinzu kam, dass ich gerne meine eigenen Vorstellungen von den Menschen die obdachlos sind und ihrem daraus resultierenden Alltag und den damit verbundenen Komplikationen und auch Chancen, überprüfen wollte.
2. Empirische Sozialforschung
2.1. Empirische Sozialforschung – eine Begriffsklärung
„Empirische Sozialforschung steht im Schnittpunkt und in der Anwendung verschiedener Disziplinen der Sozialwissenschaften. Außer der Soziologie bedienen sich ihrer: Sozialanthropologie, Sozialpsychologie, Ökonomie und Sozialökologie; sie findet wachsende Beachtung in Sprach- und Literaturwissenschaften und in Geschichte. Ihre Methoden werden im großen Umfang in der Marktforschung und bei politischen Meinungsumfragen verwendet.“ (Atteslander 2006, S. 5).
Die empirische Sozialforschung gilt, neben der Allgemeinen Soziologie und den speziellen Soziologien wie zum Beispiel der Familiensoziologie, als dritter Teilbereich der Soziologie. Mit dem Begriff empirische Sozialforschung wird die systematische Erhebung von Daten über soziale Tatsachen mit Hilfe von Interviews, Beobachtungen oder Experimenten und deren Auswertung bezeichnet. (vgl. Kromrey 2006, S. 36f)
„Empirisch bedeutet erfahrungsgemäß.“ (Atteslander 2006, S. 3). Da wir unsere Umwelt in erster Linie durch unsere Sinnesorgane wahrnehmen, erleben wir diese in dem wir sie immer wieder erfahren. (vgl. Atteslander 2006, S. 3f)
Da der ganze Forschungsverlauf um nachvollziehbar sein zu können nach bestimmten Regeln ablaufen muss, hat er systematisch zu geschehen. Da Erklärungen gesellschaftlicher Zusammenhänge so genannte Theorien sind, gibt es auch immer wieder Theorien die nicht in allen Teilen an der sozialen Realität überprüfbar sind. Allerdings beschäftigt sich die empirische Sozialforschung mit den Theorien die geprüft werden können. (vgl. Atteslander 2006, S. 3f)
„Zu den empirisch wahrnehmbaren sozialen Tatbeständen gehören: beobachtbares menschliches Verhalten, von Menschen geschaffene Gegenstände sowie durch Sprache vermittelte Meinungen, Informationen über Erfahrungen, Einstellungen, Werturteile und Absichten.“ (Atteslander 2006, S. 3)
Bereits im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert entwickelte sich die empirische Sozialforschung, durch verschiedene Versuche gesellschaftliche Massenerscheinungen zu erklären. Die sozialen Missstände, die sich im neunzehnten Jahrhundert durch die zunehmende Industrialisierung ergeben hatten, versuchte man auch quantitativ zu erfassen. (vgl. Atteslander 2006, S. 5) „Insbesondere wurden die Lebensverhältnisse der Arbeiter und ihrer Familien und vor allem Aspekte industrieller Verstädterung untersucht.“ (Atteslander 2006, S. 5)
2.2. Ziele der empirischen Sozialforschung
Mit der empirischen Sozialforschung kann eine Reihe von verschiedenen Zielen verfolgt werden. Es können zum Beispiel auf der Grundlage empirischer Beobachtung basierende Theorien und Hypothesen entwickelt werden, oder sozialwissenschaftliche Theorien und darauf basierende Hypothesen durch empirische Daten überprüft werden. Es können auch soziale Sachverhalte wie zum Beispiel die Suizidrate anhand systematisch gesammelter Daten beschrieben werden, woraus man dann sogenannte Arbeitshypothesen entwickeln kann. Durch die wissenschaftlichen Ergebnisse kann man dann auch sozialpolitische Planungs – und Entscheidungsprozesse unterstützen. (vgl. Kromrey 2006, S. 9 ff)
2.3. Überblick über qualitative und quantitative Sozialforschung
„Quantitative Untersuchungen legen regelhafte Strukturen in situativen Handlungen bloß und liefern im Wesentlichen Informationen über Häufigkeitsverteilungen“ (Weischer 2007, S. 90)
Quantitative Methoden werden also häufig in der empirischen Sozialforschung verwendet, wenn es um die nummerische Darstellung von Sachverhalten oder die Unterstützung der Schlussfolgerungen zum Beispiel mit Hilfe der Inferenzstatistik geht. Das betrifft häufig die Datenerhebung, -analyse oder auch Stichprobenauswahlen. Mögliche Methoden der quantitativen Sozialforschung sind unter anderem Interviews, Befragungen anhand von Fragebögen oder Experimente. (vgl. Lamnek 1995, S. 35 ff)
Quantitative Interviews haben zumeist eine ermittelnde aber keine vermittelnde Intention und sind meist standardisiert bis halb- standardisiert. Die Befragungen erfolgen entweder in Einzelinterviews, Gruppen (evtl. Gruppendiskussion) oder per paper & pencil (PAPI). Die Kommunikation kann in ihrer Form entweder schriftlich oder mündlich stattfinden; der Stil der Kommunikation sollte eher neutral gehalten werden. Die Fragen sollten geschlossen formuliert sein und mündliche Interviews kann man dass Setting entweder telefonisch oder face- to- face gestalten. Bei einer schriftlichen Befragung hingegen kann man die Versandmedien frei wählen (postalisch, Postwurfbefragung oder Beilagenbefragung). (vgl. Lamnek 1995, S. 35 f)
Ein Beispiel wäre eine Befragung durch ein standardisiertes Interview. Für Umfragen die repräsentativ sein sollen, werden die Interviewpartner meist über Stichproben ausgewählt. Solche Interviews werden häufig face- to- face und mit Hilfe von PAPI durchgeführt. In der Regel bekommt jeder Befragte die gleichen Fragen gestellt. Für die Fragen wurden im Voraus schon verschiedene Antwortkategorien definiert und mit einem Codeschema versehen wurden. Da hier meist die Antworten vordefiniert sind, spricht man also von geschlossenen Fragen. (vgl. Lamnek 1995, S. 35)
Kritisiert wird in der der quantitativen Sozialforschung häufig, dass sie nicht ausreichend auf die Individualitäten der Interviewpartner eingeht. Außerdem stellt die Tatsache, dass jeder Interviewpartner die gleichen Fragen bekommt nicht sicher, dass auch jeder Interviewpartner die Fragen auf dieselbe Art und Weise versteht. (vgl. Lamnek 1995, S. 64 ff)
„Beim qualitativen Forschungsansatz hat man davon Abstand genommen, den Mensch und seine Umwelt mit standardisierten, an die Naturwissenschaft und ihre Gütekriterien angelehnten Methoden erforschen zu wollen. Stattdessen wird versucht, das Subjekt und seine subjektiv konstruierte Welt in aller Komplexität zu erfassen. Was zählt, ist die Sicht des Subjekts und dessen Sinnzuweisungen, die sich aus Erfahrungen, Ereignissen und Interaktionen ergeben.“ (Freie Universität Berlin, Internet). Die Forschenden sollten also nach diesem Ansatz versuchen die Welt aus Sicht der von ihnen zu erforschenden Menschen zu sehen um ihr Handeln verstehen zu können. Der erforschte Mensch sollte mittels natürlicher Kommunikationsprozesse und in seiner natürlichen Welt untersucht werden. (vgl. Freie Universität Berlin, Internet)
„Qualitative Untersuchungen beleuchten konkrete soziale Vorgänge, die bestimmte Strukturen situativer Handlungen hervorbringen.“ (Weischer 2007, S. 90)
Was die qualitativen Interviews betrifft, so ist ihre Intention eher eine vermittelnde als eine ermittelnde und die Befragungen finden in nicht- standardisierter Form statt. Die Form des paper & pencil kommt hier nicht zum Einsatz, stattdessen ist die Struktur auf Einzelinterviews oder Gruppen (evtl. Gruppendiskussion) ausgelegt. Die Form der Kommunikation ist immer eine mündliche mit einem weichen Stil. Die Fragen in den Interviews sind offen formuliert. Als Kommunikationsmedium wird nie die telefonische Variante gewählt, sondern immer face- to- face interviewt. Versandmedien werden auch nicht genutzt, um die persönliche und vertrauensvolle Ebene besser halten zu können. (vgl. Lamnek 1995, S. 64)
Qualitative Interviews lassen den Interviewpartner zu Wort kommen, was Zurückhaltung von Seiten des Interviewers fordert, sowie ein großes Maß an Flexibilität. Diese ist von Nöten um variabel auf die Bedürfnisse des Interviewpartners eingehen zu können. (vgl. Freie Universität Berlin, Internet). Ein normales Alltagsgespräch sollte für den Interviewpartner realisiert werden, in einer Atmosphäre von Offenheit und auf einer Vertrauensebene. Es geht um die Wirklichkeitsdefinition des Interviewpartners, wie oben schon erwähnt, nicht um die des Interviewers. Da das qualitative Interview bevorzugt Handlungs- und Deutungsmuster der Interviewpartner ermittelt die sich im Laufe des Interviews entwickeln, muss der Interviewer auf diese Prozeßhaftigkeit ein besonderes Augenmerk legen. (vgl. Lamnek 1995, S. 64)
Kritiker werfen der qualitativen Sozialforschung häufig Unwissenschaftlichkeit vor anhand der Subjektivität und der Willkürlichkeit der erhobenen Daten. Hinzu kommt, dass qualitative Sozialforschung auf Grund ihres großen Aufwandes für die Durchführung qualitativer Interviews nur mit kleinen Fallzahlen arbeitet und deswegen nach Meinung der Kritiker keine repräsentativen Ergebnisse bringen könnte. (vgl. Lamnek 1995, S.64 ff)
Nach Weischer entwerfen qualitative und quantitative Sozialforschung jeweils spezifische Modelle der sozialen Welt, die zueinander in komplementärem Verhältnis stehen. Sie ersetzen sich also nicht gegenseitig, wodurch die Konkurrenz aufgehoben wird, sondern sie ergänzen sich. Jede der beiden Arten liefert eine Art von Information die sich nicht nur von der Anderen unterscheidet sondern auch wesentlich ist um sie zu verstehen. Somit erklärt sich auch, dass es immer mehr Mischformen zwischen qualitativen und quantitativen Methoden in der Sozialforschung gibt. (vgl. Weischer 2007, S. 90 f)
2.4. Das narrative Interview
Das narrative Interview ist eine weniger standardisierte Form des qualitativ orientierten Interviews. Es wird auch das erzählende Interview genannt. Diese Methode wurde von Fritz Schütze in die Sozialforschung eingeführt und vor allem in der biografischen Forschung verwendet. (vgl. Mayring 2002, S. 72 ff)
„Es gibt – so die Grundidee – subjektive Bedeutungsstrukturen, die sich im freien Erzählen über bestimmte Ereignisse herausschälen, sich einem systematischen Abfragen aber verschließen würden.“ (Mayring 2002, S.72) Der Interviewpartner wird von dem Interviewer zum ganz freien Erzählen aufgefordert, da durch Erzählungen, ein natürlich in der Sozialisation eingeübtes Diskursverfahren, Handlungszusammenhänge und die entsprechenden Verkettungen verschiedener Handlungen sichtbar werden. (vgl. Mayring 2002, S. 72 ff)
Laut Mayring gibt es vier Schritte im Ablaufmodell des narrativen Interviews. Da sich diese Technik nur dann sinnvoll einsetzen lässt, wenn der Interviewpartner auch etwas zu berichten hat, ist also der erste Schritt „die Definition des Erzählgegenstandes“ (Mayring 2002, S. 75), in der man sich einen Interviewpartner sucht, bei dem man vermeintlich sicher sein kann, dass er zu diesem Thema etwas zu berichten hat. (Mayring 2002, S. 74 f)
Schritt zwei erfolgt, in dem man durch eine Einstiegsfrage dem Interviewpartner das Thema angibt und die Richtung weißt, in die man ungefähr mit ihm gehen möchte. Man versucht eine Basis des Vertrauens herzustellen, in der der Interviewpartner sich frei genug fühlt erzählen zu können. Dadurch motiviert man ihn auch gezielt dazu, etwas von sich zu berichten. Dieser Schritt nennt sich laut Mayring „Stimulierung der Erzählung“ (Mayring 2002, S. 75).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der empirischen Sozialforschung in diesem Projekt?
Ziel ist es, Vorstellungen über Obdachlosigkeit zu überprüfen und den Alltag sowie die Chancen und Komplikationen betroffener Menschen durch systematische Datenerhebung zu verstehen.
Was versteht man unter einem narrativen Interview?
Es ist eine qualitative Methode, bei der der Interviewpartner frei aus seiner Lebensgeschichte erzählt, um subjektive Sinnzuweisungen und Erfahrungen im Detail zu erfassen.
Was unterscheidet qualitative von quantitativer Sozialforschung?
Quantitative Forschung nutzt standardisierte Methoden für Häufigkeitsverteilungen, während qualitative Forschung das Subjekt und seine komplexe Welt durch offene Kommunikation verstehen will.
Welches Transkriptionssystem wurde verwendet?
Die Arbeit nutzt das Transkriptionssystem nach Kallmeyer und Schütze zur Verschriftlichung der geführten Interviews.
Was sind Strukturhypothesen in der empirischen Auswertung?
Dies sind erste Annahmen, die auf Basis objektiver Daten zur Person und der Chronologie des Lebenslaufs gebildet werden, bevor die tiefergehende Interpretation erfolgt.
- Quote paper
- Lena Raubach (Author), 2010, Ehemalige und zeitweise Wohnungslose, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215202