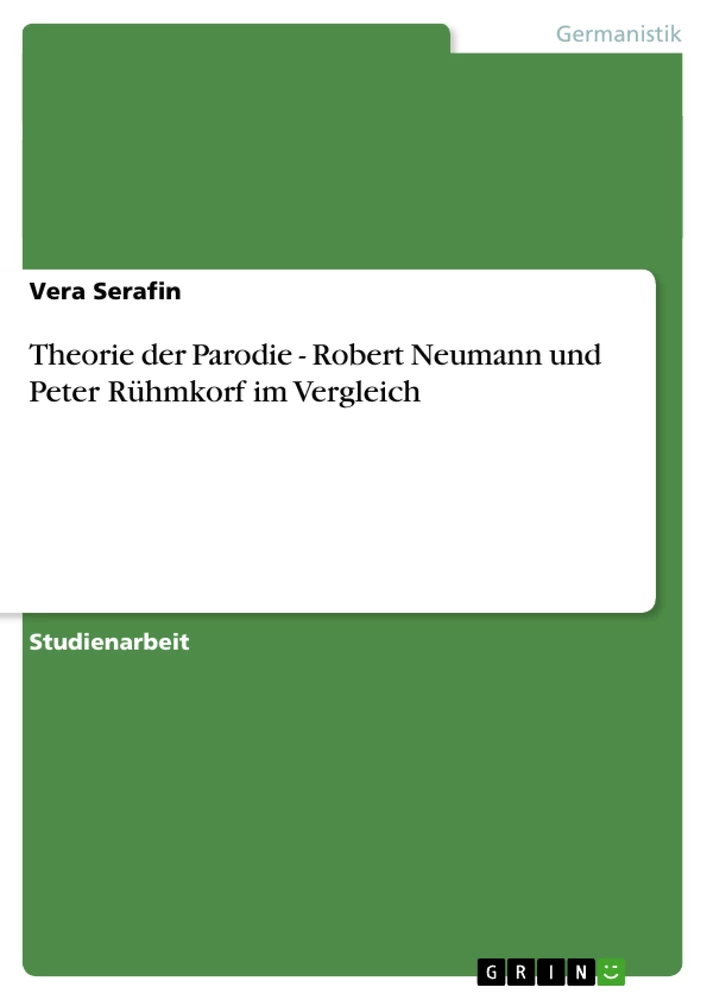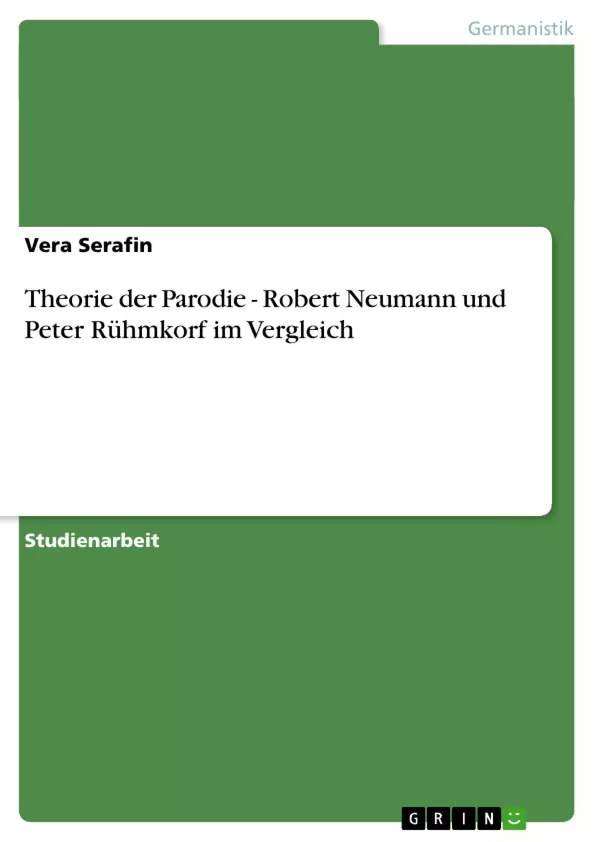Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Theorie der Parodie – Robert Neumann und
Peter Rühmkorf im Vergleich“ stellt den Anspruch, die Parodiekonzeptionen der
beiden Autoren miteinander zu vergleichen, ohne deren unterschiedliche literarische
sowie soziokulturelle Voraussetzungen außer acht zu lassen, welche formend die
Theorien beider auffallend durchdringen. Die ästhetische Konzeption der kritischen
Parodie Robert Neumanns (1897 – 1975) sowie die in kritischem Gegenwartsbezug
(den gesellschaftlichen Bedingungen beobachtend zugewandte) „ideologiefixierende“
und adversativ agierende Theorie der Parodie Rühmkorfs (geb. 1929) stellen den
Schwerpunkt dieser Arbeit dar.
Zunächst muss jedoch der Begriff der Parodie, d.h. seine gängigen Merkmale und
Funktionen, erläutert werden. Es existieren allzu viele Versuche einer Defintion
dieses Begriffes, von denen an dieser Stelle nur einige erwähnt werden sollen.
Wichtig ist hierbei die Abgrenzung von der Parodie ähnlichen literarischen
Phänomenen, deren Begriffe oft synonym mit der Bezeichnung „Parodie“ gebraucht
werden, in ihrer Bedeutung allerdings nicht völlig deckungsgleich mit dieser
fungieren. Es folgt eine Beschreibung der Theorie der Parodie Neumanns, wobei
Hanns von Gumppenberg als „Vor-Denker“ Robert Neumanns vorgestellt wird, bevor
die kritische Parodie Neumanns und ihre von ihm bestimmten sowie auch ihre
notwendigen Grenzen dargestellt werden. Anhand des Beispiels „Mutteranruf“ von
Robert Neumann als Parodie Hugo von Hofmannsthals „Ballade des äusseren
Lebens“ soll diese Konzeption an Deutlichkeit gewinnen.
Anschließend befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Theorie der Parodie Peter
Rühmkorfs, wobei zunächst die Bedeutung der Sprache in Literatur und Welt bzw. in
Peter Rühmkorfs Parodiekonzeption erläutert wird. Im Anschluss daran soll auf eben
diese Konzeption der Parodie sowie auf deren literarische Mittel näher eingegangen
werden. Auch an dieser Stelle folgt zum Zwecke der bereits erwähnten Deutlichkeit
ein Beispiel: Peter Rühmkorfs „Auf eine Weise des Joseph Freiherrn v. Eichendorff“
als Parodie Eichendorffs „In einem kühlen Grunde“.
Hieran soll sich ein Vergleich beider Parodiekonzeptionen anschließen, bevor zum
Schluss einige weiterführende Gedanken zum Thema erläutert werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Robert Neumann und Peter Rühmkorf – Ästhetik und Bedingung
- Der Begriff der Parodie. Merkmale und Funktionen
- Versuche einer Definition
- Abgrenzung von ähnlichen literarischen Phänomenen
- Die Theorie der Parodie Robert Neumanns
- Hanns von Gumppenberg als „Vorläufer\" Robert Neumanns
- Robert Neumanns kritische Parodie und ihre Grenzen
- Robert Neumanns „Mutteranruf“ als Parodie Hugo von Hofmannsthals „Ballade des äusseren Lebens“
- Die Theorie der Parodie Peter Rühmkorfs
- Die Bedeutung des Wortes in Literatur und Welt
- Peter Rühmkorfs Konzeption der Parodie und ihre Mittel
- Peter Rühmkorfs „Auf eine Weise des Joseph Freiherrn v. Eichendorff“ als Parodie Eichendorffs „In einem kühlen Grunde“
- Vergleich beider Parodiekonzeptionen
- Schluss
- Weiterführende Gedanken
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich der Parodiekonzeptionen von Robert Neumann und Peter Rühmkorf, wobei die unterschiedlichen literarischen und soziokulturellen Voraussetzungen der beiden Autoren berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt stehen die kritische Parodie Robert Neumanns und die ideologiefixierende, adversativ agierende Theorie der Parodie Rühmkorfs.
- Die Definition und Charakterisierung des Begriffs Parodie
- Die Analyse der Parodietheorie Robert Neumanns
- Die Darstellung der Parodietheorie Peter Rühmkorfs
- Der Vergleich der beiden Parodiekonzeptionen
- Die Erörterung weiterführender Gedanken zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema und den Aufbau der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung des Vergleichs der Parodiekonzeptionen von Neumann und Rühmkorf. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Parodie, definiert ihn anhand verschiedener Versuche und grenzt ihn von ähnlichen literarischen Phänomenen ab.
Das dritte Kapitel behandelt die Parodietheorie Robert Neumanns. Es werden Hanns von Gumppenberg als „Vor-Denker“ Neumanns vorgestellt und die kritische Parodie Neumanns sowie ihre Grenzen erläutert. Anhand von Neumanns „Mutteranruf“ als Parodie auf Hofmannsthals „Ballade des äusseren Lebens“ wird die Konzeption verdeutlicht.
Das vierte Kapitel analysiert die Parodietheorie Peter Rühmkorfs. Die Bedeutung der Sprache in Literatur und Welt sowie in Rühmkorfs Parodiekonzeption werden erläutert. Es folgt eine detaillierte Betrachtung von Rühmkorfs Konzeption der Parodie und ihren literarischen Mitteln, die anhand seines Beispiels „Auf eine Weise des Joseph Freiherrn v. Eichendorff“ als Parodie auf Eichendorffs „In einem kühlen Grunde“ veranschaulicht wird.
Das fünfte Kapitel setzt sich mit einem Vergleich der beiden Parodiekonzeptionen auseinander. Im Schluss sollen weitere Gedanken zum Thema erörtert werden.
Schlüsselwörter
Parodie, Robert Neumann, Peter Rühmkorf, Kritik, Literatur, Ästhetik, Sprache, Stil, Form, Inhalt, Komik, Gesellschaft, Ideologie.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Parodie in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit erläutert gängige Merkmale und Funktionen der Parodie und grenzt sie von ähnlichen literarischen Phänomenen wie Travestie oder Persiflage ab.
Was charakterisiert die Parodietheorie von Robert Neumann?
Neumanns Ansatz wird als "kritische Parodie" bezeichnet, die stark von seinem Vorläufer Hanns von Gumppenberg beeinflusst wurde.
Was ist das Besondere an Peter Rühmkorfs Parodiekonzeption?
Rühmkorf verfolgt eine "ideologiefixierende" und adversative Theorie, die gesellschaftliche Bedingungen kritisch beobachtet und sprachlich umsetzt.
Welche Beispiele werden zum Vergleich herangezogen?
Verglichen werden Neumanns "Mutteranruf" (nach Hofmannsthal) und Rühmkorfs Parodie auf Eichendorffs "In einem kühlen Grunde".
Welche Rolle spielt die Sprache in der Parodie nach Rühmkorf?
Für Rühmkorf ist die Sprache das zentrale Mittel, um die Verbindung zwischen Literatur und der realen Welt bzw. Ideologien aufzuzeigen.
- Quote paper
- Vera Serafin (Author), 2003, Theorie der Parodie - Robert Neumann und Peter Rühmkorf im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21532