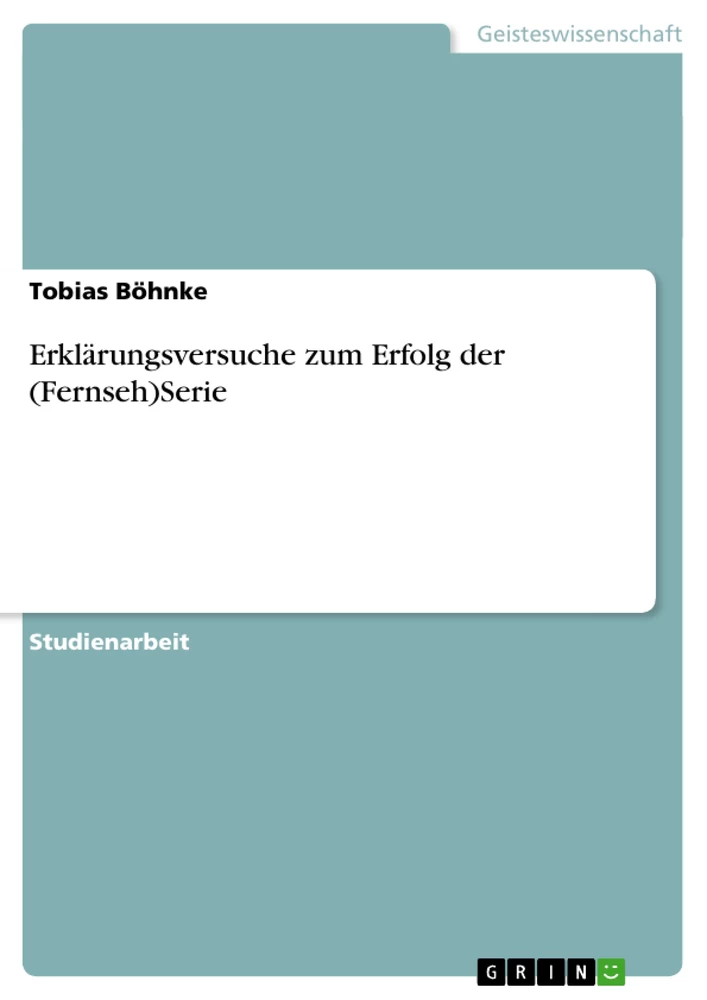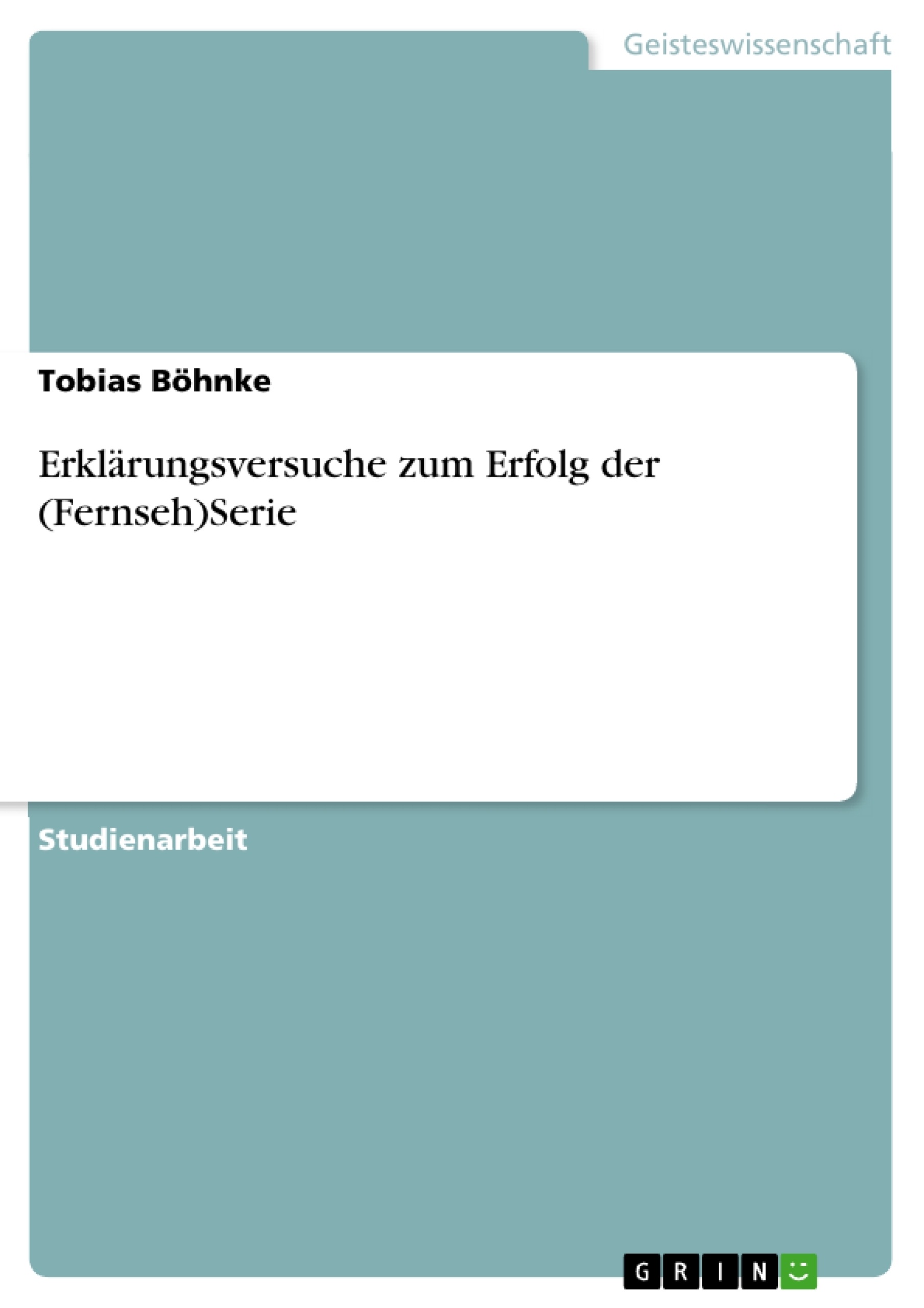Am 28.02.1983 schauten ca. 50150000 Haushalte das Serienfinale von M.A.S.H., das türkische Parlament schloss am 20. November 1980 früher, damit die Beamten mit 300 Millionen anderen Zuschauern die Auflösung des Rätsels, wer auf J. R. Ewing geschossen hatte, verfolgen konnten; das Guinessbuch der Rekorde verzeichnet für Baywatch eine Zuschauerzahl von 1.1 Milliarden Zuschauern aus 142 Ländern jede Woche. Diese Zahlen zeigen wie erfolgreich Fernsehserien sind und wie sich an dem Beispiel des türkischen Parlaments sehen lässt, wie groß die Auswirkung auf den Tagesablauf der Zuschauer ist. Trotz dieser überwältigenden Zahlen wird die Fernsehserie in der Wissenschaft oft als trivial und leicht durchschaubar tituliert, die Fernsehserie verliere durch die Serienherstellung an Qualität, sie provoziere sogar negative Veraltensmuster. Diese vernichtenden Statements in Verbindung mit den hohen Zuschauerzahlen legen nah, die Fernsehserie als ein Medium der ungebildeten Masse abzutun oder wenn man die Türkischen Parlamentsbeamten hinzuzieht, vielleicht noch als Zerstreuungsmedium für die studierten, als Flucht vor dem Alltag. Die vorliegende Arbeit soll die Fragen klären, was es ist das so viele Menschen an Fernsehserien begeistert und ob die Vorwürfe aus der Wissenschaft sich bewahrheiten. Dazu soll zuerst geklärt werden, was unter dem Begriff Serie zu verstehen ist, um im Anschluss daran zu ergründen, was die Ursprünge der Serie sind, um einen Versuch zu wagen, zu ergründen, was die Faszination des Seriellen ausmacht. Daraufhin sollen mögliche Auswirkungen der modernen Fernsehserie auf den Rezipienten untersucht werden anhand der bereitsgenannten Vorurteile und aus der Sicht der Produzenten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 3. Geschichte der Serie
- 4. Erfolgsrezept Serie
- a. Faszination des Banalen und Alltäglichen
- b. Banales und Alltägliches im Fremden
- c. Serien erleben
- d. Kult
- e. Serie aus Produzentensicht
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Erfolg von Fernsehserien. Sie hinterfragt die oft wissenschaftlich geäußerte Kritik an Serien als trivial und oberflächlich im Kontext ihrer immensen Popularität. Die Arbeit klärt den Begriff "Serie", beleuchtet die Geschichte des Serienformats und analysiert Faktoren, die zur Faszination und zum Erfolg von Serien beitragen.
- Begriffsbestimmung und Typologie von Fernsehserien
- Analyse des Erfolgs von Fernsehserien anhand von Zuschauerzahlen und kulturellen Phänomenen
- Untersuchung der Faszination des Banalen und Alltäglichen in Serien
- Die Rolle der Serien im kulturellen Kontext und ihre Rezeption
- Die Perspektive der Produzenten auf den Erfolg von Serien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung veranschaulicht den überwältigenden Erfolg von Fernsehserien anhand von Beispielen wie dem Finale von M*A*S*H oder dem Einfluss der Serie Dallas auf den türkischen Parlamentsbetrieb. Sie stellt den scheinbaren Widerspruch zwischen dem immensen Erfolg und der oft negativen wissenschaftlichen Bewertung von Serien als trivial und qualitätsmindernd heraus. Die Arbeit kündigt die Klärung der Frage an, was die Faszination der Serie ausmacht und ob die wissenschaftliche Kritik gerechtfertigt ist. Die methodische Vorgehensweise – Begriffsklärung, historische Einordnung und Analyse der Faszination – wird skizziert.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel analysiert den Begriff „Serie“. Die gängige Definition im Duden, die sich auf industrielle Serienproduktion bezieht, wird als unzureichend für die Fernsehserie betrachtet. Es wird auf die Definition in Medienlexika zurückgegriffen, die Serien als mehr oder weniger eng zusammenhängende Erzählungen beschreiben, die in einzelne Episoden aufgeteilt sind und durch Hauptpersonen verbunden werden. Die Problematik dieser Definition wird anhand von Serien mit Cliffhangern und der Unterscheidung zwischen zyklischen und linearen Serien (Series und Serial) diskutiert. Der Unterschied zwischen Episodenformaten (wie The Simpsons) und Serien mit fortlaufender Handlung (wie Dallas) wird erläutert und an Beispielen veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Fernsehserien, Serientypen, Serienproduktion, Erfolg, Rezeption, Alltägliches, Banalität, Kultur, Zuschauer, Medienwissenschaft, Narrativität, Episoden, Serialität, lineare Serie, zyklische Serie.
Häufig gestellte Fragen: Analyse des Erfolgs von Fernsehserien
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Erfolg von Fernsehserien und hinterfragt die oft geäußerte Kritik an Serien als trivial und oberflächlich. Sie analysiert die Faszination von Serien im Kontext ihrer immensen Popularität.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Begriffsklärung des Begriffs "Serie", beleuchtet die Geschichte des Serienformats und analysiert Faktoren, die zum Erfolg von Serien beitragen. Konkret werden die Faszination des Banalen und Alltäglichen, die Rolle der Serien im kulturellen Kontext, die Rezeption und die Produzentensicht untersucht. Die Arbeit analysiert auch verschiedene Serientypen (z.B. lineare vs. zyklische Serien).
Welche Kapitel enthält die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 (Einleitung) stellt den Widerspruch zwischen dem immensen Erfolg und der negativen Bewertung von Serien dar und skizziert die methodische Vorgehensweise. Kapitel 2 (Begriffsklärung) analysiert den Begriff "Serie" und die verschiedenen Serientypen. Die weiteren Kapitel befassen sich mit der Geschichte der Serien, den Erfolgsfaktoren (inkl. der Faszination des Banalen und Alltäglichen) und einem Fazit.
Welche konkreten Aspekte des Erfolgs von Fernsehserien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Erfolg anhand von Zuschauerzahlen und kulturellen Phänomenen. Sie untersucht die Faszination des Banalen und Alltäglichen in Serien und die Rolle der Serien im kulturellen Kontext. Die Perspektive der Produzenten auf den Erfolg wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fernsehserien, Serientypen, Serienproduktion, Erfolg, Rezeption, Alltägliches, Banalität, Kultur, Zuschauer, Medienwissenschaft, Narrativität, Episoden, Serialität, lineare Serie, zyklische Serie.
Wie wird der Begriff „Serie“ in der Arbeit definiert?
Die Arbeit kritisiert die gängige Definition im Duden als unzureichend. Sie greift auf Medienlexika zurück, die Serien als mehr oder weniger eng zusammenhängende Erzählungen beschreiben, die in einzelne Episoden aufgeteilt sind und durch Hauptpersonen verbunden werden. Die Problematik dieser Definition wird anhand von Serien mit Cliffhangern und der Unterscheidung zwischen zyklischen und linearen Serien diskutiert.
Welche Beispiele werden in der Arbeit verwendet?
Es werden Beispiele wie das Finale von M*A*S*H und der Einfluss der Serie Dallas auf den türkischen Parlamentsbetrieb genannt, um den überwältigenden Erfolg von Fernsehserien zu veranschaulichen. Weitere Beispiele illustrieren den Unterschied zwischen Episodenformaten und Serien mit fortlaufender Handlung.
- Arbeit zitieren
- Tobias Böhnke (Autor:in), 2011, Erklärungsversuche zum Erfolg der (Fernseh)Serie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215386