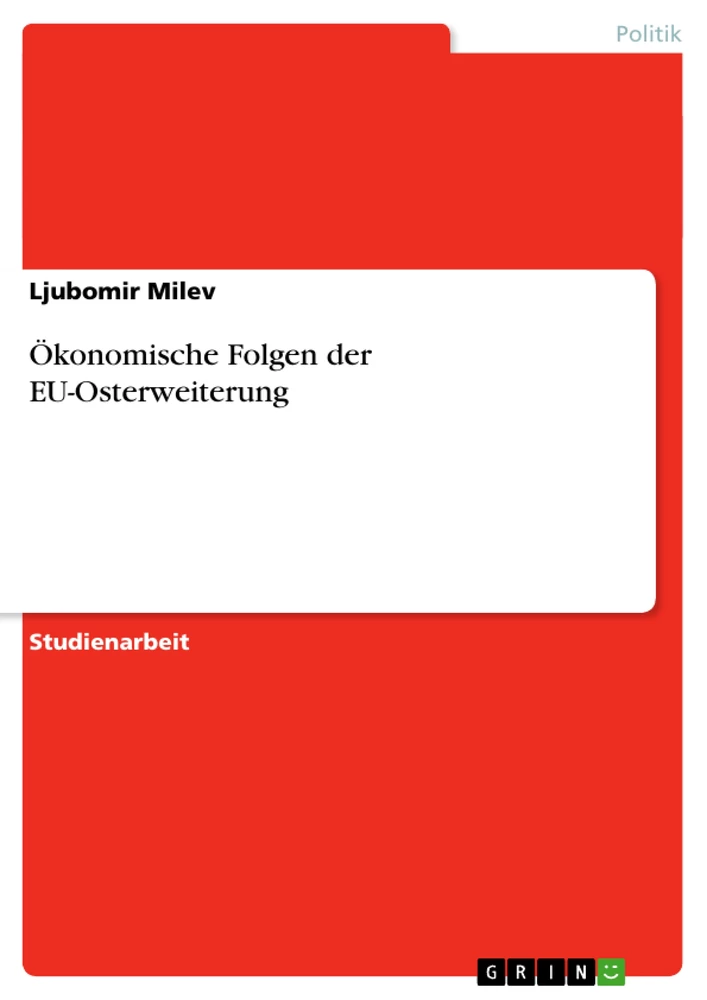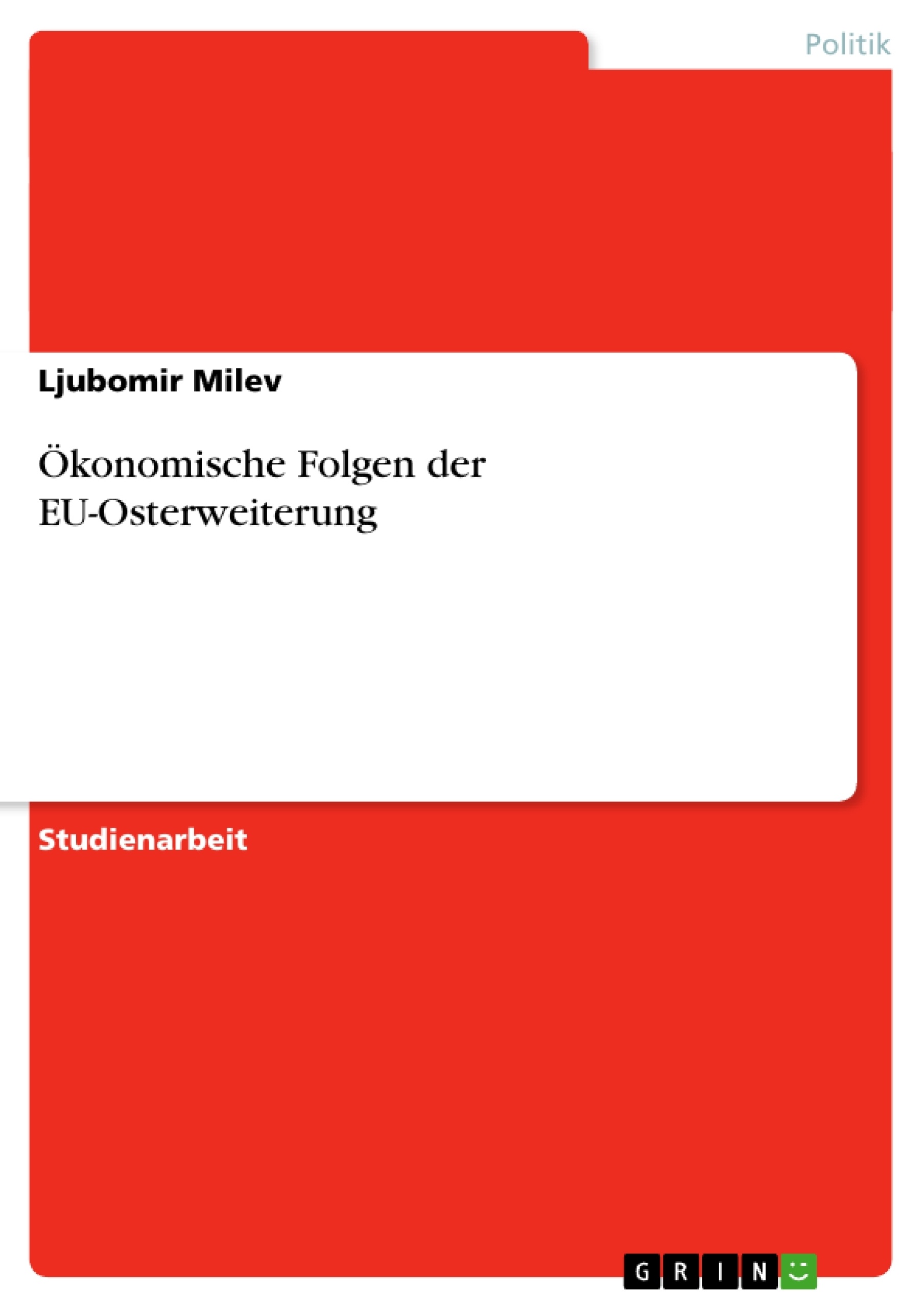Mit dem endgültigen Kollaps der kommunistischen Systeme in den osteuropäischen Ländern Anfang der 1990er Jahre setzten in diesen Staaten auch gleichzeitig tief greifende ökonomische und gesellschaftliche Transformationsprozesse ein, die die Umstrukturierung der politischen und wirtschaftlichen Ordnungen von Planwirtschaft hin zu funktionierender Marktwirtschaft und den Übergang zur parlamentarischen Demokratie zum Ziel hatten, um dadurch politische und ökonomische Stabilität aufzubauen, diese längerfristig zu sichern und den Anspruch auf Frieden, Sicherheit und Wohlstand auf nationaler und transnationaler Ebene zu gewährleisten. Nach dem Zusammenbruch der Organisationsstrukturen des Warschauer Pakts und dem damit einhergehenden Ende des Rats für Gegenseitige Wirtschaftshilfe zielten die osteuropäischen Regierungen auf die Integration in westeuropäische Stabilitäts-, Sicherheits- und Wirtschaftsstrukturen hin. In diesem Sinne auch auf den Zutritt zum Europäischen Binnenmarkt und den Beitritt zur EU. Im Jahr 2004 steht der Europäischen Union die fünfte Integrationsetappe nach ihrer Gründung bevor. Die Erweiterung der EU auf 25 Mitglieder durch den Beitritt von zehn Staaten Ost-, Ostmittel- und Südeuropas – Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern – wird mit hohen Anpassungs- und Reformerfordernissen verbunden sein.
Die Aufgabe dieser Seminararbeit wird es sein, mögliche ökonomische Folgen sowohl für die Alt-, als auch für die Neumitglieder der Europäischen Union nach der EU-Osterweiterung zu filtern und grob zu skizzieren, ohne dabei diese Auswirkungen analytisch zu diskutieren. Hierbei gilt es in Ansätzen die Fragen zu erörtern, welche eventuelle Vor- und Nachteile für die Ökonomien der EU bzw. der neuen Mitglieder nach der Erweiterung bestehen könnten. Was sind mögliche wirtschaftliche Perspektiven nach der EU-Osterweiterung? Sind die ökonomischen Folgen für die EU bzw. für die Beitrittsländer voneinander abhängig oder kann man diese separat voneinander betrachten?
Es sei darauf hingewiesen, dass diese Hausarbeit primär ein Grundriss möglicher Folgen der EU-Osterweiterung darstellt und nicht dem Anspruch nachgeht, ganzheitlich erschöpfend zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mögliche ökonomische Vorteile für die Beitrittsländer
- Garantierter Zugang zu EU-Märkten
- Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen und Strukturfonds
- Mögliche ökonomische Vorteile für die EU
- Wachsende Absatzpotentiale und regionalökonomische Auswirkungen
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
- Einsparpotential
- Mögliche ökonomische Nachteile für die Beitrittsländer
- Mögliche ökonomische Folgen für die EU
- Güter-, Kapital- und Arbeitsmarkt, Ressourcentransfer
- Migration
- Zusammenfassende Schlussbetrachtungen
- Quellen und Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den möglichen ökonomischen Folgen der EU-Osterweiterung, sowohl für die bereits bestehenden Mitglieder als auch für die neu beitretenden Staaten. Die Arbeit untersucht die potenziellen Vor- und Nachteile für die Ökonomien beider Gruppen und skizziert die wirtschaftlichen Perspektiven nach der Erweiterung. Dabei wird die Frage erörtert, ob die Folgen für die EU und die Beitrittsländer voneinander abhängig sind oder separat betrachtet werden können.
- Mögliche wirtschaftliche Vorteile für die Beitrittsländer durch den Zugang zu EU-Märkten und erhöhte ausländische Direktinvestitionen
- Potenzielle ökonomische Vorteile für die EU durch wachsende Absatzmärkte und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
- Mögliche ökonomische Nachteile für die Beitrittsländer durch die Anpassung an die EU-Strukturen
- Mögliche ökonomische Folgen für die EU durch den Güter-, Kapital- und Arbeitsmarkttransfer
- Die Bedeutung der Migration im Kontext der EU-Osterweiterung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der EU-Osterweiterung und die damit verbundenen ökonomischen Folgen ein. Es beleuchtet die historischen Hintergründe und den Transformationsprozess der osteuropäischen Länder von Planwirtschaft zu Marktwirtschaft.
Mögliche ökonomische Vorteile für die Beitrittsländer: Dieses Kapitel analysiert die potenziellen Vorteile für die Beitrittsländer, darunter der garantierte Zugang zu EU-Märkten und die Steigerung der ausländischen Direktinvestitionen.
Mögliche ökonomische Vorteile für die EU: Dieses Kapitel befasst sich mit den möglichen ökonomischen Vorteilen für die EU, einschließlich wachsender Absatzmärkte, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Einsparpotenzial.
Mögliche ökonomische Nachteile für die Beitrittsländer: Dieses Kapitel beleuchtet die potenziellen Nachteile für die Beitrittsländer im Zuge der Integration in die EU, z. B. Anpassungsprobleme an die EU-Strukturen.
Mögliche ökonomische Folgen für die EU: Dieses Kapitel untersucht die möglichen ökonomischen Folgen der Erweiterung für die EU, darunter Auswirkungen auf den Güter-, Kapital- und Arbeitsmarkt sowie den Ressourcentransfer.
Migration: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung der Migration im Kontext der EU-Osterweiterung.
Schlüsselwörter
EU-Osterweiterung, ökonomische Folgen, Beitrittsländer, Europäischer Binnenmarkt, ausländische Direktinvestitionen, Strukturfonds, Wettbewerbsfähigkeit, Migration, Ressourcentransfer, Marktwirtschaft, Planwirtschaft, Transformationsprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Hauptziele der EU-Osterweiterung 2004?
Die Erweiterung zielte auf die politische und ökonomische Stabilität in Europa, den Übergang zur Marktwirtschaft in Osteuropa und die Sicherung von Frieden und Wohlstand ab.
Welche ökonomischen Vorteile ergaben sich für die neuen Beitrittsländer?
Zu den Vorteilen gehörten der garantierte Zugang zum EU-Binnenmarkt, ein Anstieg ausländischer Direktinvestitionen sowie finanzielle Unterstützung durch EU-Strukturfonds.
Welche Vorteile bot die Osterweiterung für die alten EU-Mitgliedstaaten?
Die bestehenden Mitglieder profitierten von wachsenden Absatzmärkten, einer Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit und potenziellen Einsparungen durch regionalökonomische Synergien.
Welche Nachteile oder Herausforderungen gab es für die Beitrittsländer?
Herausforderungen lagen vor allem in den hohen Anpassungs- und Reformerfordernissen, um die Standards des Europäischen Binnenmarktes zu erfüllen.
Welche Rolle spielt das Thema Migration in der EU-Osterweiterung?
Migration ist ein zentraler Aspekt, der Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte sowohl der Alt- als auch der Neumitglieder hat und oft kontrovers diskutiert wurde.
Welche Länder traten der EU im Zuge der fünften Integrationsetappe bei?
Es traten zehn Staaten bei: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakische Republik, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.
- Quote paper
- Ljubomir Milev (Author), 2003, Ökonomische Folgen der EU-Osterweiterung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21540