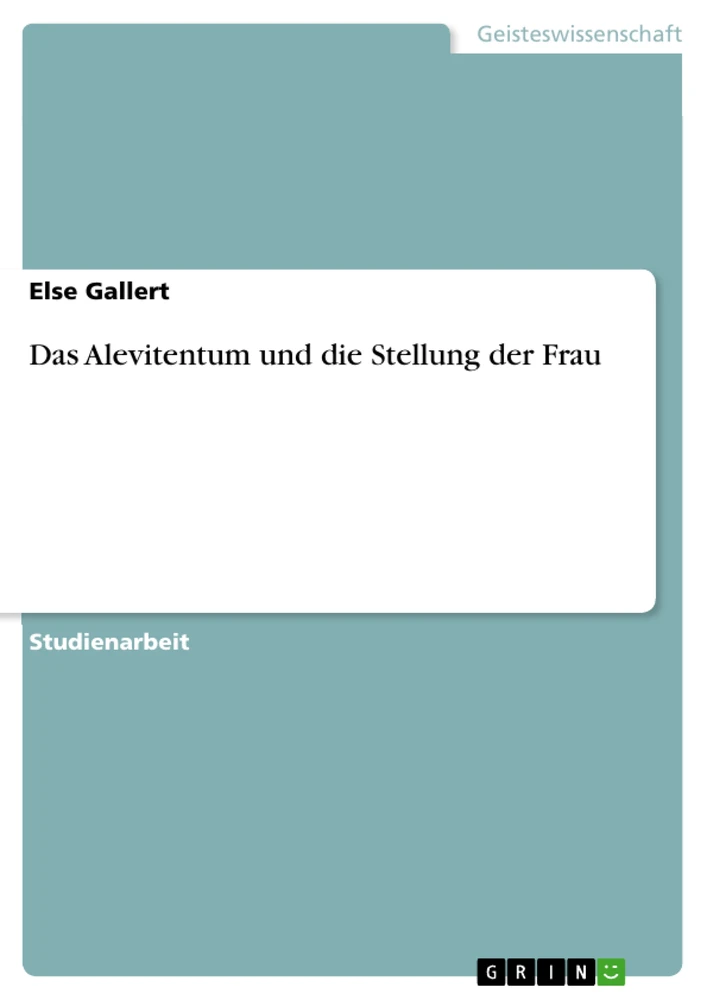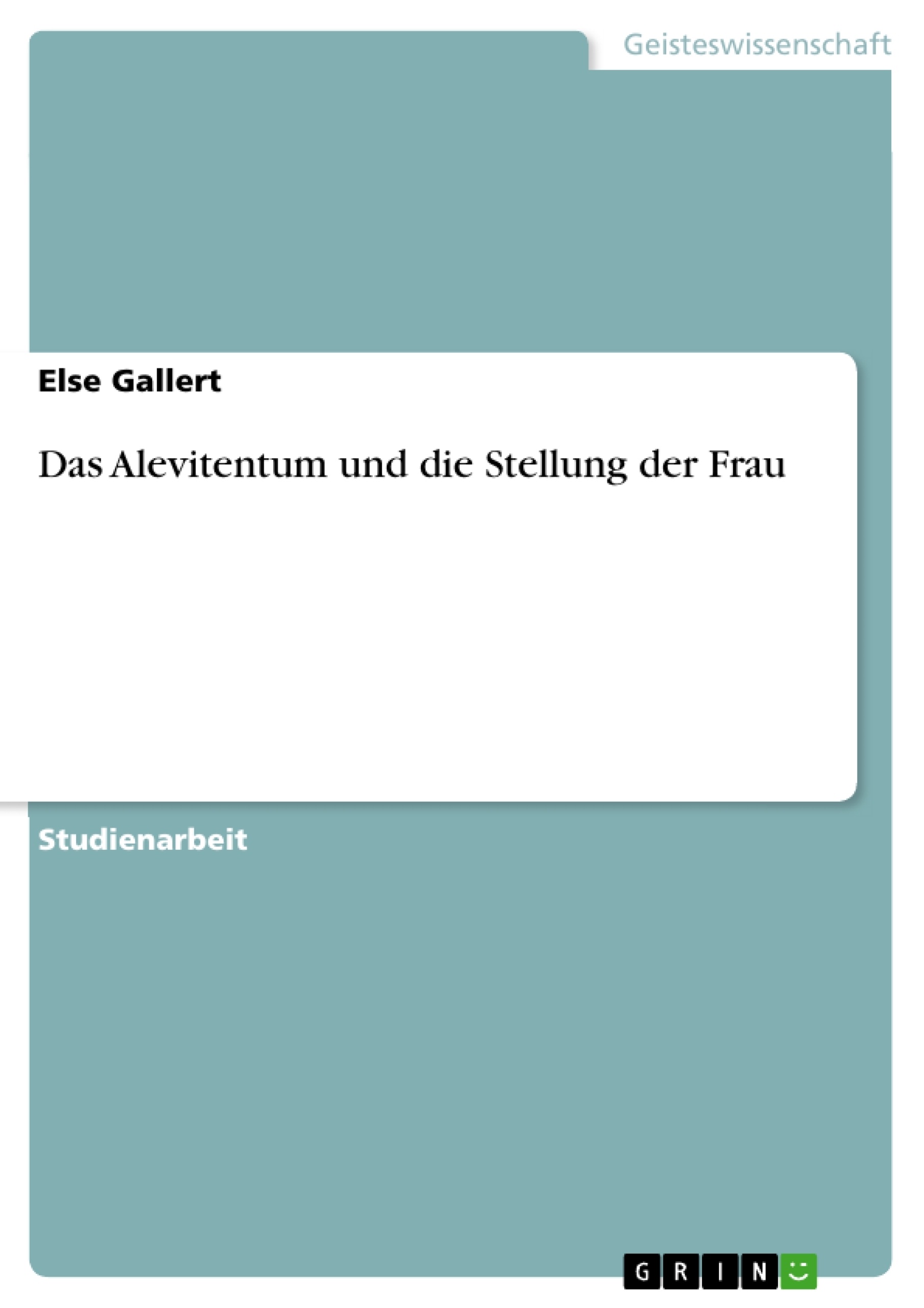Das Thema meiner Hausarbeit ist „Das Alevitentum und die Stellung der Frau“.
Die Aleviten sind neben den Sunniten die zweitgrößte Glaubensgruppe in der Türkei. Sunniten sind Angehörige der größeren der beiden Hauptgruppen des Islams in der Türkei, deren Glaubens- und Pflichtenlehre neben dem Koran auf der Gesamtheit der von Mohammed überlieferten Aussprüche und Verhaltensweise beruht. Aleviten sind jedoch Angehörige einer konfessionellen Gemeinschaft, die das Alevitentum als Glaubenswelt haben. Dieses ist die Verschmelzung vor allem urpersischer, urtürkischer, persischer, islamisch-heterodoxer und schiitischer Glaubenselemente.
Die Anzahl der Aleviten in der Türkei wird heute auf circa zwanzig Millionen geschätzt, doch dabei wird jedoch nicht zwischen türkischen und kurdischen Aleviten unterschieden.
Der Autor Gümüs meint jedoch, dass ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung zwanzig bis dreißig Prozent beträgt. Dies wären seiner Meinung nach circa dreizehn bis sechzehn Millionen Menschen, wobei unterstrichen werden muss, dass es sich mangels offizieller Statistiken, und aufgrund der Tatsache, dass die Aleviten in ihrer Heimat nicht als eigenständige Religionsgemeinschaft anerkannt werden, hierbei um Schätzungen handelt.
Im ersten Teil meiner Hausarbeit werde ich zunächst auf die Begriffsdefinition „Aleviten“ eingehen, um anschließend kurz die Entwicklung des Alevitentums zu erläutern.
Des weiteren werde ich im dritten Teil meiner Arbeit auf die spezifischen alevitischen Glaubensinhalte eingehen und sie näher beschreiben.
Den Abschluss meiner Arbeit bildet ein weiterer Schwerpunkt. Es handelt sich um die Stellung die Frau im Alevitentum.
Die Literatur, die ich verwendet habe, bezieht sich auf türkische und kurdische Aleviten. Das Werk von Frau Firat beschreibt vor allem die Aleviten der kurdisch-alevitischen Region Dersim. „Das Gebot“ von Bozkurt geht auf keine spezielle Region in der Türkei ein, sondern behandelt das Thema eher allgemein. Der Autor Gümüs bezieht in seinem Werk sowohl die türkischen, als auch die kurdisch- oder zazastämmigen Aleviten ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition „Aleviten“
- Entwicklung des Alevitentums
- Ausübung der Religion
- Exkurs: Bektaschi- Orden
- Die Lehre von den Vier Pforten
- Ablauf eines Cem bei kurdischen Aleviten
- Die Praxis der Rechtssprechung
- Pseudoverwandtschaftsverhältnisse
- Caexovane
- Exkurs: Der zeremonielle Ablauf der Caexovane bei kurdischen Aleviten
- Die Verpflichtungen der MusaivpartnerInnen und ihrer Familien zueinander
- „Kewra“
- Caexovane
- Fasten
- Almosengeben
- Pilgerfahrt
- Pflichtgebet
- Bedeutung der Naturelemente
- Kurdische und türkische Aleviten im Vergleich
- Die Stellung der Frau im Alevitentum
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Alevitentum und der Stellung der Frau innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft. Die Zielsetzung ist es, die Entwicklung und die spezifischen Glaubensinhalte des Alevitentums zu beleuchten, wobei ein besonderer Fokus auf die Rolle der Frau gelegt wird. Dabei werden sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede zwischen türkischen und kurdischen Aleviten berücksichtigt.
- Begriffsdefinition und Entwicklung des Alevitentums
- Spezifische Glaubensinhalte und Rituale des Alevitentums
- Der Einfluss des Bektaschi-Ordens auf die alevitische Tradition
- Die Rolle und Bedeutung der Frau im Alevitentum
- Vergleich der alevitischen Traditionen in der Türkei und in Kurdistan
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und führt in die Thematik des Alevitentums ein. Sie beleuchtet die Position der Aleviten als zweitgrößte Glaubensgruppe in der Türkei und beschreibt die Besonderheit des Alevitentums als eine Verschmelzung verschiedener Glaubenstraditionen.
Im zweiten Kapitel wird der Begriff „Aleviten“ definiert und die historische Entwicklung des Alevitentums skizziert. Dabei wird die Bedeutung Alis als Schlüsselfigur für die Entstehung des Alevitentums erläutert und die Spaltung innerhalb des Islam im Kontext der Nachfolgefrage Mohammeds beleuchtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Ausübung der Religion im Alevitentum. Hier werden die vier Tore der alevitischen Lehre sowie der Einfluss des Bektaschi-Ordens auf die alevitische Tradition behandelt. Der Fokus liegt auf dem Cem-Ritual und den spezifischen alevitischen Glaubensvorstellungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Alevitentum, einer heterodoxen Form des Islams, die in der Türkei und in Kurdistan verbreitet ist. Wichtige Schlüsselwörter sind: Ali, Bektaschi-Orden, Cem-Ritual, vier Tore, Caexovane, Frauenstellung, Mystik, Synkretismus, schiitischer Islam, kurdische Aleviten, türkische Aleviten.
- Quote paper
- Else Gallert (Author), 2007, Das Alevitentum und die Stellung der Frau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215429