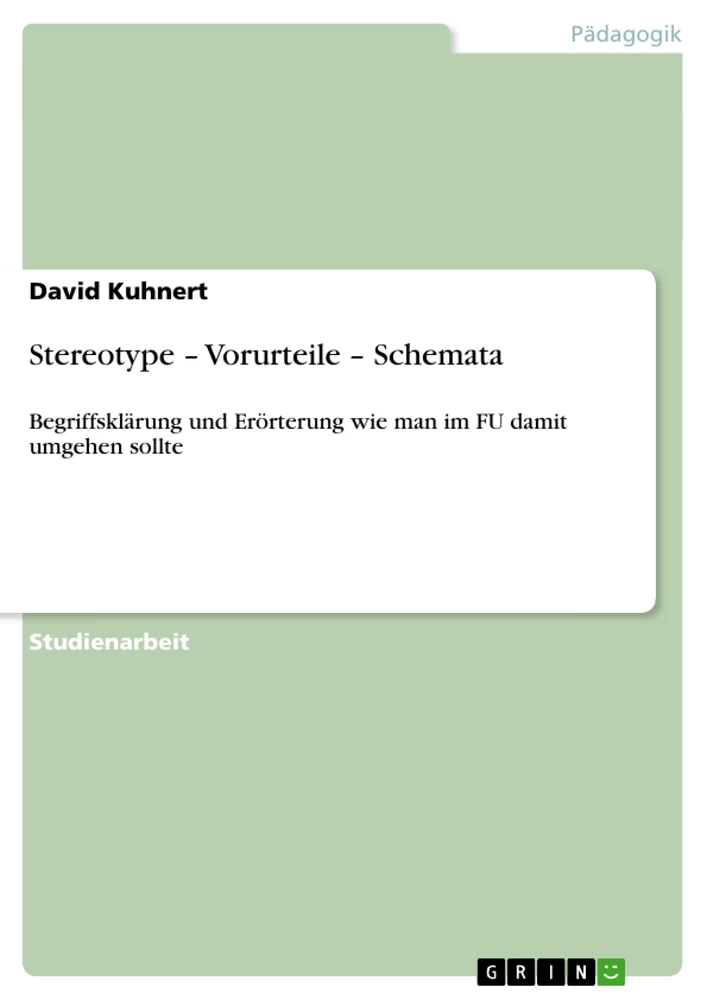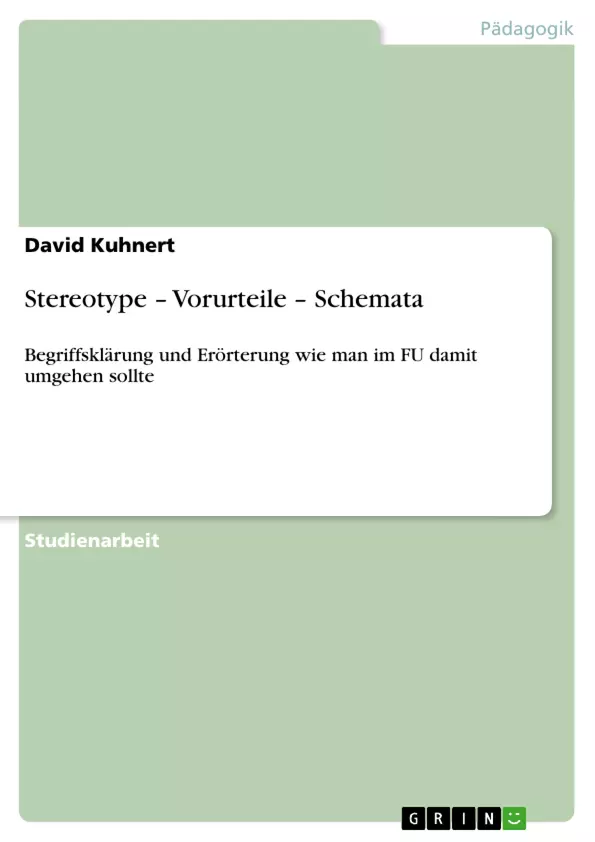In dieser kleineren Arbeit wird untersucht, wie Stereotypen im englischen Fremdsprachenunterricht versendet werden sollten
Gliederung
1. Einleitung
2. Auto- und Heterostereotypen – eine Begriffsklärung
3. Komparative Imagologie
3.1. Das Kulturelle Gedächtnis
3.2. Bedeutung des Kulturellen Gedächtnis für die Nutzung von Stereotypen
4. Verwendung von Stereotypen im Fremdsprachenunterricht
5. Fazit
Literatur
1. Einleitung
Die Bedeutung von Interkulturellem Lernen im Fremdsprachenunterricht ist schon seit langem bekannt und wird – wie man heute sagen kann- selbstverständlich in den schulischen Bildungsprozess mit einbezogen. Differenzierungsfähigkeit und das Einfühlungsvermögen in die zu erlernende Kultur sind wichtiger Bestandteil (nicht nur) des Fremdsprachenunterrichts geworden und werden dementsprechend in den betreffenden Curriculae eingebunden. Umso erstaunlicher mutet es daher an, das der Bedeutung von Stereotypen für die Eigen- und Fremdwahrnehmung von Kultur im Unterricht bis jetzt wenig Aufmerksamkeit zuteilwurde, zumal die wissenschaftlichen Grundlagen dafür bereits in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts gelegt wurden. Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, die Entstehung und Bedeutung von Stereotypen zu erklären und untersucht, wie Stereotype im Fremdsprachenunterricht behandelt werden sollten. Dazu gilt es zunächst zu klären, wie der Begriff Stereotypen definiert ist und worin er sich von Vorurteilen unterscheidet. Anschließend wird mit der „Komparativen Imagologie“ eine wissenschaftliche Disziplin vorgestellt, die sich mit der Entstehung und Wirkung von Stereotypen beschäftigt und die Bedeutung von Selbst- und Fremdbildern für deren Entstehung untersucht.
Darauf folgt eine Einführung in das Konzept des „Kulturellen Gedächtnisses“ nach Assmann, welches die Grundlage für das Verstehen um die Entstehung und Bedeutung von Stereotypen bildet. In dem Abschnitt wird zudem geklärt, in wieweit das „Kulturelle Gedächtnis“ und die Herausbildung von Stereotypen korrelieren.
Im letzten Teil schließlich werden Wege aufgezeigt, welche Bedeutung Stereotype im Unterricht haben und welche Möglichkeiten sich daraus hinsichtlich des interkulturellen Lernens ergeben.
2. Auto- und Heterostereotypen – eine Begriffsklärung
Stereotype sind „…stark vereinfachte und über lange Zeit gleichbleibende spezifische Wahrnehmungs- und Urteilsmuster von Personen und Gruppen von Personengruppen. Stereotype sind kulturell geprägt und stellen gesellschaftliche Konstrukte dar“ (Nünning 1999:325). Ihr Ursprung ist also Gesellschaftlich verankert und beruht nicht etwa auf persönlicher Erfahrung mit der fremden Kultur. Aus diesem Grunde sind Stereotype immer verallgemeinernd und weisen eine große Beständigkeit auf. Stanzel führt diese Verankerung auf ein zentrales psychisches Grundmuster zurück, nämlich „die Unsicherheit über die eigene Identität“, welches sich in Xenophobie (Furcht vor dem Fremden) und in der Ethnozentrik (Überzeugung von der eigenen moralischen Überlegenheit) manifestiert (vgl. Stanzel 1998:33). Eine wichtige Rolle bei deren Entstehen spielt dabei das Kulturelle Gedächtnis, auf das später in dieser Arbeit ebenfalls eingegangen wird.
Es können zwei Arten von Stereotypen unterschieden werden: Auto- und Heterostereotypen. Mit Autostereotypen bezeichnet man die Bilder, die von der eigenen Kultur gezeichnet werden (bzw. wie man glaubt dass diese von anderen Kulturen wahrgenommen werden), während der Begriff Heterostereotypen das eigene Bild über fremde Kulturen bezeichnet.
Eng verwandt mit dem Begriff Stereotyp ist das Vorurteil: Umgangssprachlich (und lange Zeit auch in der Wissenschaft) werden beide Begriffe synonym verwendet, wenngleich es eine eindeutige Unterscheidung gibt: Stereotype repräsentieren einen kognitiven Aspekt, Vorurteile hingegen einen affektiven Aspekt des menschlichen Verhaltens gegenüber einer Gruppe von Menschen (vgl. Doye 1999).
Anders gesagt: Stereotype reduzieren Komplexität und sind nicht per se wertend – sie haben ihren Ursprung in tatsächlichen Eigenschaften und können sogar Identifikationsmöglichkeiten bieten (Autostereotypen). Vorurteile indes werden niemals im positiven Sinne genannt: Sie bündeln negative Gefühlsurteile, sind abstrakter und haben mit der Wirklichkeit nichts gemein.
Eine weitere Begrifflichkeit sind in diesem Zusammenhang die „Images“ (Bilder). Ein Image lässt sich ähnlich definieren wie Stereotypen, es ist jedoch historisch variabel und leichter aufbaubar als diese: So kann es sich viel schneller wandeln und gezielt verändert werden. Man unterscheidet auch hier in Selbstbildern (Auto-Images) und Fremdbildern (Hetero-Images). Die methodisch fundierte Auseinandersetzung mit diesen Images liefert der Forschungsansatz der Komparativen Imagologie.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Stereotypen und Vorurteilen?
Stereotype sind kognitive Schemata, die Komplexität reduzieren, während Vorurteile eine starke affektive (meist negative) Bewertung beinhalten.
Was sind Auto- und Heterostereotypen?
Autostereotypen sind Bilder über die eigene Kultur; Heterostereotypen sind Bilder, die man über fremde Kulturen hat.
Welche Rolle spielt das „Kulturelle Gedächtnis“ nach Assmann?
Es bildet die Grundlage für die Entstehung von Stereotypen, da Bilder über das „Eigene“ und „Fremde“ über Generationen hinweg gespeichert und tradiert werden.
Wie sollten Stereotype im Fremdsprachenunterricht genutzt werden?
Sie sollten nicht ignoriert, sondern bewusst thematisiert werden, um interkulturelles Lernen, Differenzierungsfähigkeit und Empathie zu fördern.
Was ist „Komparative Imagologie“?
Eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Entstehung und Wirkung von Selbst- und Fremdbildern (Images) in der Literatur und Kultur beschäftigt.
- Quote paper
- David Kuhnert (Author), 2010, Stereotype – Vorurteile – Schemata, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215543