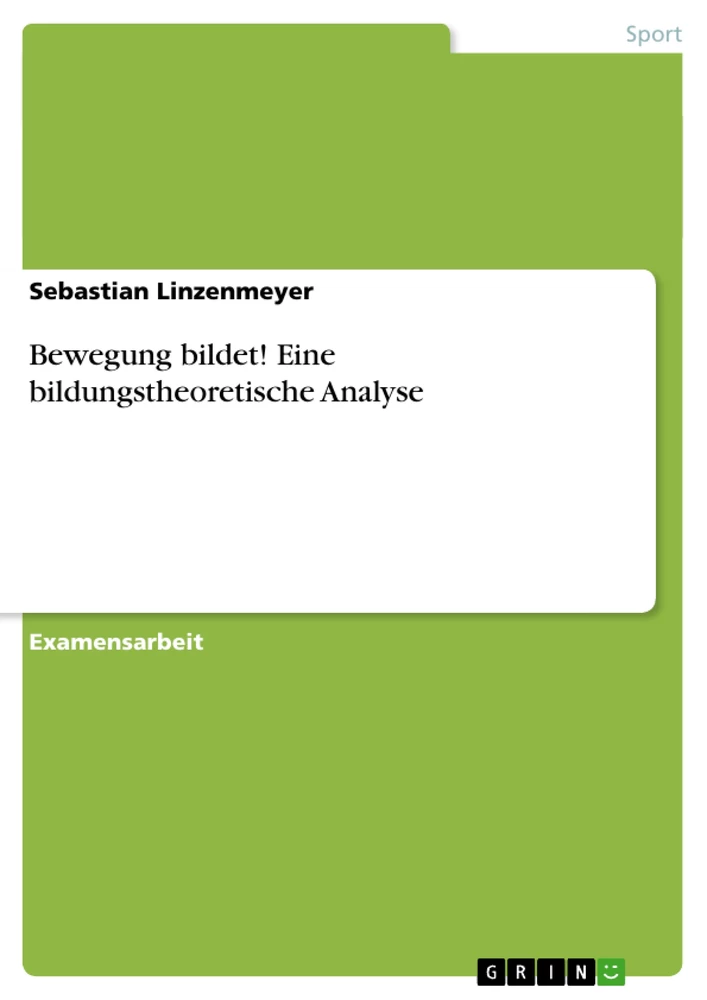Bewegungs- und Sportangebote stehen in direkter Konkurrenz mit den
Neuen Medien und kämpfen um das Interesse der Kinder. Doch die Phantasiewelten
der Computerspiele und Fernsehsendungen sind nur ein Teil
der sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Die Veränderung
der Lebensbedingungen hat direkte Auswirkungen auf das Bewegungs- und
Körpererleben und damit auch auf (persönlichkeits-)bildende Prozesse. Die
Gründe dieser Veränderung sind nicht nur in familiären Strukturen zu suchen,
sondern insbesondere auf den gesellschaftlichen und sozioökologischen
Wandel zurückzuführen. Die moderne Lebenswelt wirkt sich
auf das gesamte Körperkonzept der Kinder, insbesondere auf das Raumund
Zeiterleben, aus. Ein zentraler Aspekt der veränderten Lebensbedingungen
ist der Rückgang an Gelegenheiten für eine aktive Weltaneignung
und damit der Entzug von unmittelbaren Sinneserfahrungen durch den Körper.
Denn das bewusste Erschweren von Bewegungen ermöglicht viele
Sinne anzusprechen und dabei sich und die Umwelt möglichst reizvoll zu
erleben. Erwachsene betrachten dieses bewusste Erschweren von Handlungen
außerhalb des Sports als unnötig und sinnlos. Es verwundert also
nicht, wenn die Umwelt den Vorstellungen der Mehrheit der Erwachsenen
entspricht und eine bequeme und komfortable, aber für die kindliche Sinnesentwicklung
feindliche Umgebung einen Großteil der Lebenswelt der Kinder
ausmacht. Doch die „Sinnessysteme“ müssen täglich eingesetzt und trainiert werden, damit sie aktiv bleiben und sich weiterentwickeln können
(Zimmer, 1997, S. 20 f.).
Schon vor fünfzehn Jahren wurden die Probleme einer bewegungsfeindlichen
Lebenswelt von Zimmer (ebd.) thematisiert und sind bis heute noch
allgegenwärtig. Diese Umstände machen einmal mehr deutlich, wie wichtig
es ist, nach einer bildungstheoretischen Begründung von Bewegung zu suchen,
um auf diesem Weg ein gewisses Umdenken weiter voranzutreiben.
Denn nach Zimmer (1995, S. 8 f.) ist insbesondere bei Kindern in den ersten
Lebensjahren vielfältige Bewegungserfahrung dafür verantwortlich, in welcher
Weise Eindrücke aus der Umwelt aufgenommen und verarbeitet werden.
Die „Bewegung ist der Motor und der Mittler des Lernens, sie ist eine
Form der Weltaneignung, die dem Kind die Möglichkeit gibt, sich mit all seinen
Sinnen mit der Umwelt auseinanderzusetzen“ (Zimmer, 2009, S. 10).
[...]
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Einführung in die Problemstellung
1.2 Ziel und Gang der Untersuchung
2 Sportpädagogische Definition und Abgrenzung von Bewegung und Bildung
2.1 Bildung - Ein Definitionsversuch
2.2 Abgrenzung des Begriffs Bildung vom Begriff Erziehung
2.3 Bewegung - Ein Definitionsversuch
2.4 Abgrenzung des Begriffs Sport vom Begriff Bewegungshandeln
3 Bildungstheorien
3.1 Entwicklungsgeschichte in Deutschland nach 1945
3.2 Merkmale einer klassisch pädagogischen Bildungstheorie
3.3 Der kategoriale Bildungsbegriff nach Klafki
4 Bewegung aus bildungstheoretischer Perspektive
4.1 Bewegung als Bildungskategorie
4.2 Erfahrung als Bildungskategorie
4.2.1 Erfahrung durch Bewegung
4.2.2 Ästhetische Erfahrungen aus bildungstheoretischer Sicht
4.2.3 Die Erfahrung des Scheiterns - Voraussetzung von Bildung
4.2.4 Erfahrung als Motivation - Motor für lebenslange Bildung
4.2.5 Erfahrung als Voraussetzung für die Persönlichkeitsentwicklung
5 Anspruch und Wirklichkeit des Sportunterrichts
5.1 Kompetenzbildung durch Bewegung
5.2 Kompetenzbildung als Legitimationsstrategie?
5.3 Das Problem der doppelten Paradoxie
5.4 Didaktisch-methodische Umsetzung
5.4.1 Die Überwindung der systembedingten Grenzen
5.4.2 Didaktische Transformation - Ästhetik-Bildung im Turnunterricht
5.4.3 Le Parkour - Eine erweiterte Perspektive von Turnunterricht
6 Bewegung bildet!
6.1 Fazit
6.2 Ausblick auf die Arbeit in der Schule
Literatur
1 Einleitung
Im Folgenden soll ein Überblick darüber gegeben werden, aufgrund welcher Intention die Erörterung der bildungstheoretischen Grundlagen von Bewegung gewählt wurde, welches Ziel die Arbeit verfolgt und wie diese Untersuchung aufgebaut ist.
1.1 Einführung in die Problemstellung
Bewegungs- und Sportangebote stehen in direkter Konkurrenz mit den Neuen Medien und kämpfen um das Interesse der Kinder. Doch die Phantasiewelten der Computerspiele und Fernsehsendungen sind nur ein Teil der sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Die Veränderung der Lebensbedingungen hat direkte Auswirkungen auf das Bewegungs- und Körpererleben und damit auch auf (persönlichkeits-)bildende Prozesse. Die Gründe dieser Veränderung sind nicht nur in familiären Strukturen zu suchen, sondern insbesondere auf den gesellschaftlichen und sozio- ökologischen Wandel zurückzuführen. Die moderne Lebenswelt wirkt sich auf das gesamte Körperkonzept der Kinder, insbesondere auf das Raumund Zeiterleben, aus. Ein zentraler Aspekt der veränderten Lebensbedingungen ist der Rückgang an Gelegenheiten für eine aktive Weltaneignung und damit der Entzug von unmittelbaren Sinneserfahrungen durch den Körper. Denn das bewusste Erschweren von Bewegungen ermöglicht viele Sinne anzusprechen und dabei sich und die Umwelt möglichst reizvoll zu erleben. Erwachsene betrachten dieses bewusste Erschweren von Handlungen außerhalb des Sports als unnötig und sinnlos. Es verwundert also nicht, wenn die Umwelt den Vorstellungen der Mehrheit der Erwachsenen entspricht und eine bequeme und komfortable, aber für die kindliche Sinnesentwicklung feindliche Umgebung einen Großteil der Lebenswelt der Kinder ausmacht. Doch die „Sinnessysteme“ müssen täglich eingesetzt und trainiert werden, damit sie aktiv bleiben und sich weiterentwickeln können (Zimmer, 1997, S. 20 f.).
Schon vor fünfzehn Jahren wurden die Probleme einer bewegungsfeindlichen Lebenswelt von Zimmer (ebd.) thematisiert und sind bis heute noch allgegenwärtig. Diese Umstände machen einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, nach einer bildungstheoretischen Begründung von Bewegung zu suchen, um auf diesem Weg ein gewisses Umdenken weiter voranzutreiben. Denn nach Zimmer (1995, S. 8 f.) ist insbesondere bei Kindern in den ersten Lebensjahren vielfältige Bewegungserfahrung dafür verantwortlich, in welcher Weise Eindrücke aus der Umwelt aufgenommen und verarbeitet werden. Die „Bewegung ist der Motor und der Mittler des Lernens, sie ist eine Form der Weltaneignung, die dem Kind die Möglichkeit gibt, sich mit all seinen Sinnen mit der Umwelt auseinanderzusetzen“ (Zimmer, 2009, S. 10). Auch aus der Perspektive von Hildebrandt-Stramann (2009b, S. 100) ist der Drang nach Bewegung jedem angeboren und besonders in den ersten drei Lebensjahren eng mit dem Denken und Fühlen verknüpft. Die Erkundung der Welt mit den Sinnen ist von besonderer Wichtigkeit, denn bevor die Umwelt nicht in ihrer Vielfältigkeit erkannt und aufmerksam wahrgenommen wurde, können auch keine differenzierte und sinnvolle Fragen entwickelt werden. Das Denken und letztlich der Bildungsprozess hängt also sehr eng mit dem Wahrnehmen zusammen. Die „sinnlich-ästhetische Erfahrung“ wird zum Instrument der Weltaneignung und „das leibliche Erfassen von Welt ist von Geburt an Grundlage für Bildungsprozesse und bleibt es ein Leben lang“ (ebd.).
Dem gegenüber stehen allerdings wissenschaftliche Untersuchungen, die gegen eine Korrelation von Bewegung und kognitiver Entwicklung sprechen (vgl. dazu Gage, 1996, S. 116 f.; Fessler, 2007, S. 233 f.). Sie werden von Fleig (2008, S. 15) folgendermaßen zusammengefasst:
„In korrelationsanalytischen Studien wird mehrheitlich berichtet, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem aktuell koordinativen und kognitiven Status bei jüngeren Kindern ermittelt wurde, die Ergebnisse unterscheiden sich allerdings hinsichtlich der Stärke. Eine Abnahme der Korrelationskoeffizienten mit fortschreitendem Alter der Probanden wird zum überwiegenden Teil berichtet. Zudem werden häufiger stärkere Zusammenhänge zwischen koordinativen und kognitiven Fähigkeiten als zwischen konditionellen und kognitiven Fähigkeiten berichtet.“
Diese Ergebnisse beziehen sich jedoch in erster Linie auf kognitive Fähigkeiten weniger auf eine sportpädagogisch bildungstheoretische Begründung. Kognitive Prozesse sind zwar wesentlicher Bestandteil für Bildungsprozesse, sie sind allerdings auf dem Gebiet der allgemeinen Psychologie und Hirnforschung anzusiedeln und würden bei einer weiteren Vertiefung den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
1.2 Ziel und Gang der Untersuchung
Nach Prohl steht Bildung und Bewegung in einem „inhärenten, unauflöslichen Sinnzusammenhang” (2001, S. 14). Den wohl bekanntesten Satz, der diesen „Sinnzusammenhang“ unterstreicht, hat Rousseau (1789) formuliert: „Willst du die geistige Kraft eines Zöglings pflegen, so pflege die Kräfte, welche durch sie regiert werden sollen. Übe unablässig den Leib, mache ihn kräftig und gesund, um ihn weise und vernünftig zu machen.“ (zitiert nach: Diem, 1971, S. 750). Doch nicht nur im Kindesalter scheint Bewegung für bildende Prozesse von Bedeutung. Eine möglichst lebenslange Auseinandersetzung mit jeder Art von Bewegung sollte das Ziel eines bildungsorientierten Lebens sein.
Es gilt somit, folgende These zu prüfen:
„Bewegung bildet!“,
oder wie Zimmer (2004, S. 9) es formuliert hat:
„Toben macht schlau!“
Sind das alles nur kühne Behauptungen oder gibt es wirklich einen direkten Zusammenhang zwischen Bildung und Bewegung? Die These soll anhand einer bildungstheoretischen Grundlegung von Bewegung überprüft werden. Der wissenschaftliche Zugang zur Klärung dieser Frage ist allerdings nicht nur einer Disziplin zuzuordnen. Denn das Thema der Arbeit steht im Spannungsfeld von Philosophie, Sportwissenschaften, der allgemeinen Pädagogik und Sportdidaktik. Die Sportpädagogik könnte dabei als Integrationsdisziplin verstanden werden,
„(...) die sich im philosophischen Denken begründet, an pädagogischen Begriffen und Theorien orientiert, durch den Einsatz des human- und sozialwissenschaftlichen Methodeninventars der Sportwissenschaften zu prüfbaren Tatsachenerkenntnissen über die Bewegungskultur gelangt und auf dieser Grundlage schließlich gegenüber der Sportdidaktik praxeologische Beratungsleistungen erbringen soll“ (Prohl, 2001, S. 12).
Sie hat die Aufgabe, absichtsvolle Erziehungsprozesse in Verbindung von Spiel und Sport zu untersuchen sowie dadurch entstehende „erzieherische Transfereffekte“ aufzuzeigen (Grupe, 1997, S. 22). Dadurch entsteht allerdings ein Abhängigkeitsverhältnis zu anderen Wissenschaften wie der Psychologie oder Philosophie, das Prohl (1999, S. 211) als eine wissenschaftstheoretisch konturschwache Sportpädagogik beschreibt, die sich „zwischen alle Stühle gesetzt“ hat. Dies klingt auf den ersten Blick nach einer negativen Konnotation. Vielleicht ist aber gerade dieser interdisziplinäre Status der Vorteil einer Sport- und Bewegungspädagogik.
In Kapitel 2 werden zunächst die Begriffe Bildung und Bewegung aus sportpädagogischer Perspektive definiert und differenziert. Bei der Erörterung des Bildungsbegriffs ist eine Abgrenzung zum Erziehungsbegriff wichtig, um eine Überprägung durch den Begriff der Erziehung zu vermeiden und gleichzeitig den Bildungsbegriff stärker zu präzisieren. Daran anschließend werden, vor dem Hintergrund einer bildungstheoretischen Begründung, die Unterschiede zwischen Bewegung und Sport herausgearbeitet und der für diese Arbeit essenzielle Bewegungsbegriff noch präziser definiert.
In Kapitel 3 wird die bildungstheoretische Entwicklungsgeschichte skizziert und die Merkmale einer klassischen pädagogischen Bildungstheorie herausgestellt. Als Weiterentwicklung dieser klassischen Bildungstheorie wird der kategoriale Bildungsbegriff nach Klafki erläutert, um darauf aufbauend in Kapitel 4 Bewegung in bildungstheoretische Perspektive zu setzen und die
Merkmale von prozessualem und strukturellem Bildungsaspekt aufzuzeigen. Denn bezogen auf die Institution Schule ist Bildung schließlich der legitimierende Anspruch eines erziehenden (Sport-)Unterrichts (Laging, 2005, S. 271).
Anschließend wird der bildungstheoretische Fokus auf die (ästhetische) Erfahrung und die (sinnliche) Wahrnehmung gerichtet, die unter anderen Grupe als Grundlage für Bildungsprozesse anführt und die daher eingehend erörtert werden.
In Kapitel 5 wird der bildungstheoretische Anspruch von Bewegung in seiner praktischen Anwendbarkeit überprüft und es werden didaktischmethodische Möglichkeiten, aber auch Grenzen aufgezeigt. Die mögliche Überwindung dieser Grenzen durch eine didaktische Transformation wird anhand des Praxisbeispiels Le Parkour konkretisiert.
Das zusammenfassende Fazit in Kapitel 6 soll eine Antwort darauf geben, ob auf der integrativen Grundlage einer sportpädagogischen Perspektive ein, wie Prohl (2001, S. 14) es beschreibt, „unauflöslicher Sinnzusammenhang“ von Bewegung und Bildung zu begründen ist, um die eingangs formulierte These zu prüfen, ob Bewegung bildet und eine Argumentationsgrundlage zu schaffen, die der immer noch aktuellen Legitimationsproblematik[1] des Sportunterrichts unterstützend begegnet.
2 Sportpädagogische Definition und Abgrenzung von Bewegung und Bildung
Bevor nach einer bildungstheoretischen Begründung von Bewegung gesucht werden kann, werden in diesem Kapitel zunächst die Begriffe Bewegung und Bildung aus sportpädagogischer Perspektive definiert. Außerdem wird sowohl der Bildungsbegriff vom Erziehungsbegriff abgegrenzt als auch Bewegung und Sport differenziert erläutert, um beide Begriffe in ihrer Bedeutung besser zu strukturieren.
2.1 Bildung - Ein Definitionsversuch
Eine ständige Aktualisierung des Bildungsbegriffs bezogen auf momentane lebensweltliche Bedürfnisse ist nach Beckers (2001, S. 38 f.) unerlässlich für alle bildungstheoretischen Überlegungen. Ein modernes und aktuelles Bildungsverständnis sieht den Menschen nicht als einen „hohen Speicherplatz von Wissen“, sondern als kompetentes Individuum, das sein Wissen adäquat anwendet, „(...) um sich in der Welt zurechtzufinden“ (Probst, 2006, S. 11). Eng damit verbunden ist die Definition von kognitiven Prozessen, die das Aufnehmen, erkennen und Verarbeiten des ständigen Informationsflusses unserer Umwelt, sowie das Verknüpfen mit schon aufgenommener Information beschreibt. Diese Prozesse unterscheidet Trimmel (2003, S. 64 f.) in die Teilbereiche Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Denken, Gedächtnis und Sprache. Jeder dieser Teilbereiche ist individuell stärker oder auch schwächer ausgeprägt. Man kann daher nur schwer beurteilen, in wie weit sich Bewegung auf die einzelnen kognitiven Prozesse auswirkt. Betrachtet man sich allein den Teilbereich Denken, scheint eine einheitliche Definition fast unmöglich, da Denkprozesse in vielen verschiedenen Hirnarealen und darüber hinaus sehr komplex ablaufen (ebd.).
Schäfer beschreibt Bildung als eine „individuelle Verbindung von Erfahrung und Wissen” (2006, S. 302). Er unterscheidet zwischen Wissen, das durch Erfahrung entstanden ist, und „überliefertem Wissen“, das noch mit keiner Erfahrung verknüpft werden konnte. Um von der Erfahrung zum Wissen oder durch Vorwissen zur Erfahrung zu gelangen, sind Prozesse der „inneren Verarbeitung“ notwendig. Prohl (2006, S. 163) bezeichnet diesen Vorgang als „qualitativ strukturierten“ Erfahrungsprozess und beschreibt damit die Bewegungsbildung im Sinne von „Sachaneignung“. Ein sportpädagogisch definierter Bildungsbegriff beinhaltet somit sowohl die Allgemeinbildung im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung als auch bewegungsbildende Erfahrungsprozesse (ebd., S. 182). Eine bildungstheoretische Verknüpfung zum kategorialen Bildungsbegriff nach Klafki könnte durch eine Verbindung von formalem Bildungsaspekt und der Persönlichkeitsbildung sowie dem materialen Aspekt und der Bewegungsbildung (Sachaneignung) gelingen. Auch Beckers (2001, S. 34) vertritt diesen formalen Aspekt der Bildung und beruft sich dabei auf Pestalozzi (1806, S. 571), der die Entfaltung der menschlichen Kräfte und Anlagen als höchstes Ziel der Erziehung ansah. Erziehung und Bildung dürfen also nicht als Gegensätze behandelt werden, sondern als kohärente Bestandteile pädagogischen Handelns (Beckers, 2001, S. 34). Denn „Bildung ereignet sich auch ohne Erziehung, aber Erziehung ist auf bildungstheoretische Reflexion angewiesen“ (Laging, 2005, S. 277). Schließlich ermöglicht der reflexive Umgang mit den eigenen Erfahrungen und der dabei zunehmende Grad an Selbstverantwortlichkeit, ein selbstständiges und selbstbewusstes Leben zu führen - das letztlich Bildung im eigentlichen Sinn bedeutet (Kolb, 2010, S. 121).
Bildung entsteht folglich durch die ständige aktive und persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt. Durch diesen reflexiven Umgang können die individuellen Perspektiven des „Ich-Welt-Bezugs“ erweitert und ein Bildungsprozess initiiert werden. Die Erziehung ist nach Beckers (2001, S. 34) lediglich die sachbezogene Grundlage dafür.
Die entwicklungstheoretische Definition des Intelligenzbegriffs nach Piaget (vgl. ausführlich Furth, 1972; Scherler, 1975) kann bei einer bildungstheoretisch-sportpädagogischen Diskussion auch herangezogen werden: Piaget sieht als frühste Form der Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt, die gleichzeitig die Grundlage kognitiver Entwicklung und die Voraussetzung logischen Denkens darstellt, das sensomotorische Handeln und aktive Sammeln von Erfahrungen. Die aktive Suche nach Wissen und das Erkennen von Zusammenhängen sowie das Strukturieren von Neuem und bereits Bekanntem, das den Austausch und die aktive Anpassung zwischen Individuum und Umwelt voraussetzt, kann als Intelligenz beschrieben werden. Dieser Anpassungsvorgang wird von Piaget als „Assimilation“ und „Akkommodation“ bezeichnet und definiert zwei gegenläufige Prozesse, die einander ergänzen. Die Assimilation beschreibt den Versuch, jede neue Erfahrung in bereits bestehende kognitive Strukturen einzugliedern und generalisierbare Merkmale einer Handlung zu konstruieren. Diese Abstraktionen helfen, neue Umwelteindrücke in bereits vorhandene Erfahrungen einzuordnen. Es findet demnach eine Anpassung der Umwelt an das Individuum statt (Zimmer, 1981, S. 10 f.).
Unter dem Begriff der Akkommodation versteht man hingegen den Versuch des Individuums, sich selbst an die Bedingungen seiner Umwelt anzupassen, indem es unterschiedliche „Handlungspläne“ testet, um herauszufinden, welches kognitive Schema am besten dem neuen Objekt entspricht (ebd.).
„Ein Kind, das z. B. die Erfahrung gemacht hat, daß ein Ball auf dem Boden prellt, wird dies mit jeder Art von Bällen, die es neu kennenlernt, ausprobieren. So wird es sein ganzes Repertoire an Handlungsplänen auch auf einen Medizinball anwenden und ihn zu prellen, zu werfen oder zu fangen versuchen, obwohl er durch sein Gewicht und seine spezifischen Eigenschaften eine ganz andere Art des Umgangs erfordert“
(ebd., S. 13).
Wird das bisherige Handlungsschema als ungeeignet erkannt, muss es den neuen Bedingungen angepasst werden. Bereits vorhandene kognitive Denkstrukturen werden aufgrund neuer Erfahrungen verändert und an die Forderungen der Umwelt angepasst (ebd., S. 13). Assimilation und Akkommodation sind teilweise nur schwer zu unterscheiden und treten zu dem simultan auf (Gage, 1996, S. 115).
Bei diesen Überlegungen sollte berücksichtigt werden, dass Intelligenz nicht mit Bildung gleichgesetzt werden kann. Gage (1996, S. 115) ist außerdem der Auffassung, dass Piaget die Komplexität der kognitiven Leistungen von Kindern in einer bestimmten Entwicklungsstufe unterschätzt. Denn auch Spitzer (2002, S. 230 f.) bestätigt, dass aus verschiedenen Erkenntnissen der Lernforschung und der Entwicklungspsychologie hervorgeht, dass die Abfolge von Lern- und Entwicklungsstadien und das gezielte Aktivieren der jeweiligen Sinnes- bzw. Lernkanäle nicht unbedingt eingehalten werden müssen, da Kinder bei scheinbar zu komplexen Aufgaben nur das aufnehmen, was sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend verarbeiten können. Alle Informationen durchlaufen eine Art „automatischen Filter“, der dem momentanen Entwicklungsstand des Kindes angepasst ist.
Auch wird Piagets Theorie über den Zusammenhang von körperlicher Erfahrung und kognitiver Entwicklung durch Untersuchungen von Gage (1996, S. 116) widerlegt, die keine frühen motorischen Fähigkeiten als Voraussetzung für eine kognitive Entwicklung nachweisen konnten.
Doch eben nicht nur die kognitive Entwicklung ist von Bedeutung, sondern besonders sinnliche, emotionale, soziale, ästhetische und körperliche Bildungspotentiale bedürfen einer speziellen Aufmerksamkeit im Kontext eines umfassenden Bildungsverständnisses (Heim, 2008, S. 25). Denn auffallend häufig wurde von den bisher angeführten Autoren die Erfahrung als ein wesentliches Merkmal von Bildungsprozessen beschrieben. Besonders die ästhetische Erfahrung soll daher in Abschnitt 4.2.2 näher erläutert werden. Nach Schäfer ist Bildung „(...) das Können und Wissen, das wir tatsächlich als Werkzeug benutzen, um die Aufgaben zu lösen, die sich in unserem Alltag stellen oder die wir suchen” (2006, S. 291). Noch allgemeiner ausgedrückt kann man Bildung als Instrument sehen, mit dem wir unsere Lebenserfahrungen deuten und zu erklären versuchen. Folglich ist „(...) jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt seines Lebens auf bestimmte Weise gebildet” (Beckers, 2001, S. 34). Auch Lehnerer (1988, S. 42) sieht Bildung im Sinne von bilden als Prozess, der zielgerichtet etwas von einem unvollkommenen und unentwickelten in einen strukturierten und entwickelten Zustand überführt. Bildung bezeichnet folglich sowohl den Prozess als auch das Produkt (Ziel). Doch ein Ziel bzw. Produkt bedeutet gleichzeitig auch das Ende eines Prozesses. Dadurch entsteht ein Widerspruch zu der Vorstellung eines lebenslang gültigen und nie abgeschlossenen Bildungsprozesses (Stern, 2012, S. 229 f.). Der scheinbare Widerspruch könnte mit dem allgemein kohärenten Verhältnis von Ziel und Prozess erklärt werden. Mit anderen Worten: ohne Ziel kein Prozess und ohne Prozess kein Ziel. Folglich entsteht Bildung durch eine reflexive Lebensgestaltung und ist gleichzeitig auch die Voraussetzung dafür.
Doch ohne die Ausbildung der Persönlichkeit ist eine selbstständige und sinnvolle Bewältigung der Herausforderungen einer modernen Lebenswelt kaum möglich (Beckers, 2001, S. 34). Übersetzt man Beckers Argumentation, die den von Pestalozzi geprägten Begriff der „Menschenbildung“ als Grundpfeiler von Bildung beschreibt, in die hier verwendete Begrifflichkeit, ist die Persönlichkeit das zentrale Merkmal von Bildung. Somit gilt es bei einer bildungstheoretischen Begründung zu erörtern, inwieweit Bewegung eine persönlichkeitsbildende Funktion aufweist. Doch zunächst sollen die Unterschiede von Bildung und Erziehung herausgestellt werden um einem teilweise synonymen Verständnis zu begegnen.
2.2 Abgrenzung des Begriffs Bildung vom Begriff Erziehung
Der Bildungsbegriff wird überwiegend dem Erziehungsauftrag untergeordnet, teilweise sogar synonym mit dem Erziehungsbegriff verwendet, ohne dabei eine eigenständige Position einnehmen zu können (Laging, 2005, S. 271). Vor dem Horizont einer bildungstheoretischen Begründung von Bewegung entsteht jedoch ein Bild des Erziehungsbegriffs, das sogar im Widerspruch zu Bildungsprozessen zu stehen scheint. Denn die Begriffe Bildung und Erziehung unterscheiden sich besonders in der Auffassung über die
Ziele, Inhalte und Methoden pädagogischer Intention. Besonders in der Perspektive von Herbart wird dieser Widerspruch deutlich, der Bildung als das „(...) vielseitige Interesse und die auf selbst gewonnenen Urteile gründende kritische Sicht der Welt (...)“ sieht (Herbart, 1902 zitiert nach: Laging & Prohl, 2005, S. 176).
Der Begriff der Erziehung impliziert die Einwirkung von außen, die sowohl den Prozess als auch das Produkt bestimmt. Es wird teilweise nur wenig Rücksicht auf die Meinung und Bedürfnisse des zu Erziehenden genommen, um möglichst schnell und ohne Umwege die vordefinierten Ziele zu erreichen (Brandstätter, 2004, S. 45). Erziehende Strukturen können dabei durch Institutionen entstehen, aber auch unbewusst durch unterschiedlichste mediale, familiäre und soziale Einflüsse (Grupe, 2007, S. 91 f.).
Im Falle der Bildung kommt der „reflexive Charakter“ des Begriffs zum Tragen und der Lernende bestimmt den Prozess und letztlich das Produkt selbst. Der Pädagoge - hier wurde bewusst auf die Bezeichnung „Erzieher“ verzichtet - kann diesen Prozess initiieren, begleiten und unterstützen und dadurch im Idealfall Bildungsprozesse mitgestalten, allerdings keine Lernprozesse bestimmen (Brandstätter, 2004, S. 46).
Der Bildungsgedanke dient vielmehr als Orientierungsfunktion für Erziehung und dazu, erzieherisches Handeln sinnvoll zu machen. Doch die Vorstellung, dass der Mensch zum „selbstbestimmten Gestalter von Welt“ wird, lässt einen scheinbar paradoxen Bildungsauftrag entstehen, der gerade in der erziehenden Institution Schule als bewegungsbezogene „bildende Selbsttätigkeit“ realisiert werden soll (Laging & Prohl, 2005, S. 181). Ein bildungstheoretisch begründeter Sportunterricht hat die Aufgabe, diese scheinbar paradoxen Strukturen in der Praxis zu verbinden. Doch (Selbst-) Bildung kann nicht angeordnet werden und ist somit auch nicht durch Erziehung zu erreichen. Brandstätter (2004, S. 46) sieht Bildung als den universelleren Begriff im Vergleich zum Erziehungsbegriff, der sich allerdings ständig verändert und daher immer wieder neu angepasst werden muss.
2.3 Bewegung - Ein Definitionsversuch
Nach Tamboer (1994, S. 14) existiert auch für den Bewegungsbegriff keine einheitliche und allgemeingültige Definition. Der physikalische Ansatz beschreibt Bewegung als eine Ortsveränderung oder, wie Schäfer (2006, S. 293) es bezeichnet, als eine „Veränderung des Körpers im Raum”. Der Raum ist dabei die Umwelt, die einen umgibt. Bewegung und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig und lassen ein Bedeutungsgefüge entstehen, das den Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen bildet (Scherer, 2005, S. 125). Doch wird dieses rein physikalische Verständnis von Bewegung unter philosophischer Perspektive nach Tamboer (1994, S. 14) betrachtet, so wäre der Mensch immer in Bewegung.2 In diesem Zusammenhang eher provozierend könnte das Beispiel der Ortsveränderung durch einen Lift angeführt werden, in dem man sich offensichtlich nicht bewegt und dennoch eine Veränderung des Ortes erfährt. Aus diesem Grund ist eine philosophische Definition des Bewegungsbegriffs eher ungeeignet für eine bildungstheoretische Begründung von Bewegung. Es bliebe lediglich die Möglichkeit, den Begriff Bewegung in bewusstes und unbewusstes Bewegen zu unterscheiden und Bildungssituationen dem bewussten Bewegungshandeln zuzuordnen.
Weitaus besser eignet sich der sportpädagogische Erklärungsansatz von Prohl (1999, S. 226), der das menschliche Bewegen vom reinen physikalischen Bewegungsbegriff abgrenzt. Er sieht Bewegung als eine bedeutungsvolle Beziehung zwischen Mensch und Umwelt und bezeichnet dies als „Sich-Bewegen“. Die Beziehung zwischen Mensch und seiner Umwelt steht nun im Fokus der Betrachtungkerung im „relationalen Körperbild“, wie es Schmidt-Millard (2001, S. 71) beschreibt, könnte auch als Erweiterung des Bewegungsbegriffs gedeutet werden. Denn Bewegung entsteht in relationalem Bezug von Mensch und Welt. Sie ist aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit in ihrem Ausgang offen und nie von absoluter Verlässlichkeit (Scherer, 2005, S. 127). „Die absichtsvolle Handlung des Sportlers verwandelt sich in den absichtslosen Schwung seines Leibes“, formuliert Seel (1995, S. 97) und vielleicht ist gerade dieser offene Ausgang das Faszinierende an Bewegung.
Die Erweiterung bzw. Präzisierung des Bewegungsbegriffs mit dem Fokus des Verhältnisbezugs von Mensch und Welt ist relational begründet und lässt sich als „Bewegungshandeln“ bezeichnen. Es beschreibt das lösungsorientierte Handeln von bewegungsthematisch gebundenen Aufgaben und die Bewältigung und Gestaltung von Bewegungssituationen. Die Bewegung ist dabei von zentraler Bedeutung und ist sowohl Mittel als auch Zweck (Scherer, 2005, S. 126). Der Begriff des Bewegungshandelns ist wesentlich konkreter und stellt eine sinnvolle Erweiterung des teilweise beliebig interpretierbaren Bewegungsbegriffs dar. Dass diese Definition aber auch den Sportbegriff zu ersetzen versucht, wäre eine falsche Schlussfolgerung. Lediglich die Integration sportlichen Handelns „als eine kulturelle Form der Körper- und Bewegungsthematisierung“ ist beabsichtigt. Doch auch weitere kulturelle Bewegungsarten, etwa tänzerische oder akrobatische Bewegungen, aber auch Bewegungsspiele von Kindern werden integriert. Ebenso sind fitness- und gesundheitsorientierte, funktionale Bewegungen und pädagogisch zweckgebundenes Bewegen unter dem Begriff Bewegungshandeln einzuordnen (ebd.), der in diesem Zusammenhang allerdings nicht isoliert, sondern als „Erkenntnis-, Ausdrucks- und Gestaltungsorgan“ betrachtet werden sollte (Hildebrandt-Stramann, 2009b, S. 101).
2.4 Abgrenzung des Begriffs Sport vom Begriff Bewegungshandeln
Die Begriffe Sport und Bewegung und somit die Unterscheidung von kulturellem und funktionellem Bewegungshandeln werden in der Literatur, wie z. B. bei Grupe (2007), und besonders im allgemeinen Sprachgebrauch teilweise synonym verstanden. Doch ähnlich zu den Begriffen Bildung und Erziehung ist auch hier eine Abgrenzung nötig, um eine Überprägung und einen beliebigen Gebrauch der Begriffe zu verhindern.
Die Institution Sport, die einen kulturbildenden Charakter besitzt, bedeutet eine „freiwillige Selbsterschwernis unseres Lebens“ (Grupe, 1982, S. 107) oder nach Prohl (2006, S. 189) „die Erschwerung der selbstverständlichen Bewegungsfähigkeit“.
In neueren sportphilosophischen Ansätzen wird Sport als „Luxus“ oder „Selbstgenuss“ beschrieben, bei dem der Mensch seine individuellen psychischen und körperlichen Möglichkeiten genießt und es „nicht um die Existenzerhaltung, sondern um die Freude an der unmittelbaren Auslassung der eigenen Kräfte geht“ (Schmidt-Millard, 2001, S. 74; Gerhardt, 1991, S. 133). Der entscheidende Unterschied liegt also im Zweck des Bewegungshandelns und dem daraus resultierenden Erfolg oder Misserfolg.
Laging (2001, S. 99) sieht einen wesentlichen Unterschied zwischen Sport und Bewegungshandeln darin, dass Sport „ein hohes Maß (...) instrumenteller körperlicher Bewegungsmöglichkeiten“ verlangt. Das Gewinnen in direktem Wettbewerb hat dabei zentrale Bedeutung und führt zu einer ständigen Optimierung von speziellen Bewegungsfertigkeiten und einer Körperdisziplinierung, die den Fokus der Selbstwahrnehmung auf das Produkt legt - weniger auf den Prozess. Doch genau dieser Prozess steht im Fokus von freiem Bewegungshandeln. Folglich könnte man als wesentliche Unterschiede zusammenfassend festhalten, dass Sport produktorientiert und Bewegungshandeln prozessorientiert ist.
[...]
[1] Ein Beitrag zur aktuellen Legitimationsproblematik des Sportunterrichts liefert die DSB-Sprint-Studie (vgl. Becker & Brettschneider, 2006, S. 96 f.).
[2] „Weiterhin kann man an die neuromuskulären Prozesse denken, die beim Atemholen und beim regelmäßigen Steigen und Absinken des Brustkorbs während des Schlafs eine Rolle spielen. Fügt man hierbei noch den makrophysischen und den mikrophysischen Gesichtspunkt - Ortsveränderung im Hinblick (zum Beispiel) der Sonne beziehungsweise Ortsveränderung von Elektronen, Atomen, Molekülen oder von Vergleichbarem im Körper -, dann kann man sogar aufrechterhalten, dass Menschen sich nicht nicht-bewegen können” (Tamboer, 1994, S. 14).
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Bewegung für die Bildung so wichtig?
Bewegung ist ein „Motor des Lernens“. Durch körperliche Aktivität eignen sich Kinder die Welt mit allen Sinnen an und fördern so ihre kognitive und persönliche Entwicklung.
Was versteht man unter „kategorialer Bildung“ nach Klafki?
Es ist die Verbindung von objektiver Erschließung der Welt und subjektiver Entfaltung des Individuums, die auch durch Bewegungserfahrungen stattfindet.
Wie wirkt sich eine „bewegungsfeindliche Lebenswelt“ aus?
Sie entzieht Kindern unmittelbare Sinneserfahrungen, was die Entwicklung der Sinnessysteme und des Körperkonzepts beeinträchtigen kann.
Was bedeutet „ästhetische Erfahrung“ im Sport?
Es meint das sinnliche Wahrnehmen und Erleben des eigenen Körpers in Bewegung, was eine Grundlage für lebenslange Bildungsprozesse darstellt.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Toben und Intelligenz?
Untersuchungen zeigen Korrelationen zwischen koordinativen Fähigkeiten und kognitiver Leistung, besonders im frühen Kindesalter.
- Quote paper
- Sebastian Linzenmeyer (Author), 2012, Bewegung bildet! Eine bildungstheoretische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215576