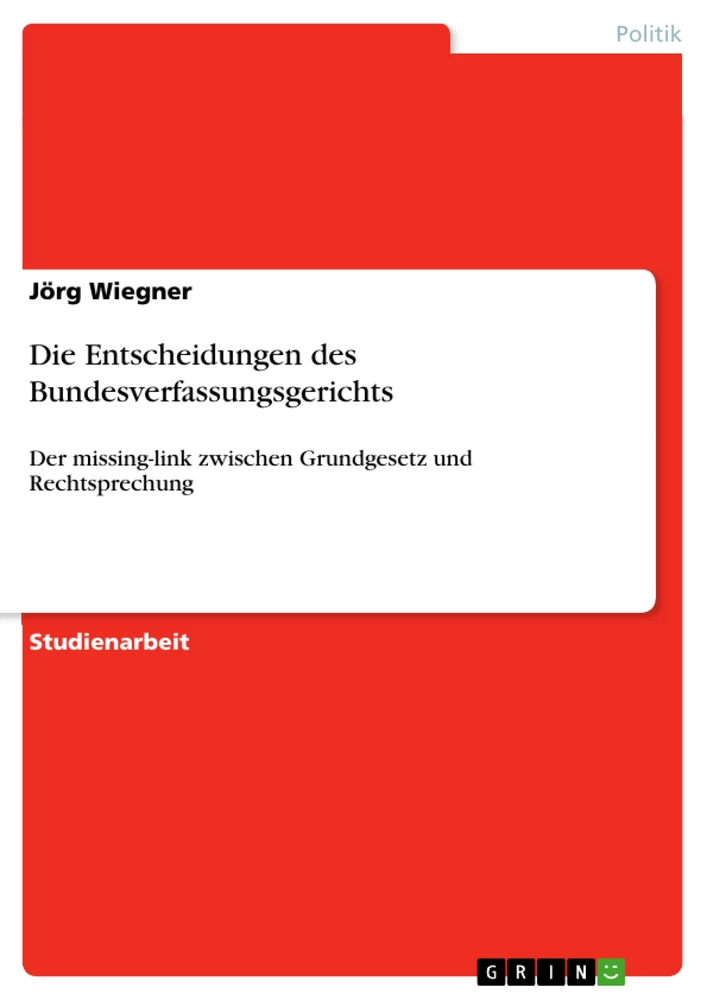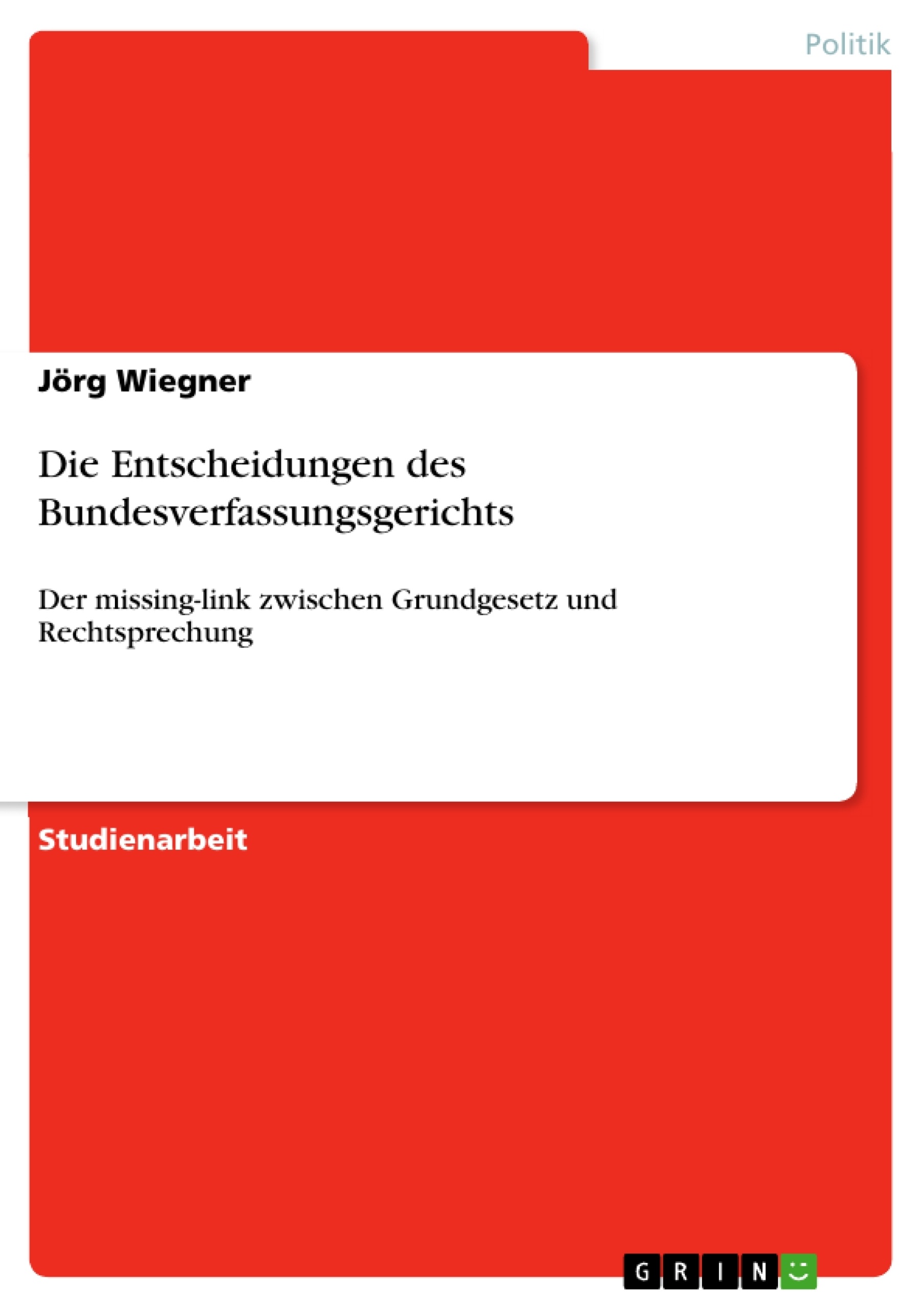1. Einleitung
Das Spannungsverhältnis zwischen Konstitutionalismus und Demokratie, Recht und Politik, zieht sich als roter Faden durch die Geschichte. Der inhärente Konflikt besteht in der Auseinandersetzung um die Souveränität und Suprematie in der Verfassungsauslegung. Die beteiligten Akteure sind auf der einen Seite die genuin politischen wie Regierung und Parlament und auf der anderen Seite die Verfassungsgerichtsbarkeit, in Deutschland das Bundesverfassungsgericht.
Bereits bei dem Verfassungskonvent am Herrenchiemsee äußerte Carlo Schmid seine Bedenken hinsichtlich eines starken Verfassungsgerichts und der Konflikthaftigkeit, die sich daraus für den politischen Prozess ergeben könnte. Bis heute ist die Rolle des Bundesverfassungsgerichts als ‚Hüter der Verfassung‘ theoretisch nicht gelöst worden.
Unter Verfassung wird die Grundordnung eines Staates verstanden, welche die Regeln für das gemeinschaftliche Zusammenleben inhaltlich und formal strukturiert, dem staatlichen Handeln Grenzen auferlegt, der politischen Auseinandersetzung einen Rahmen vorgibt und als kulturelles Gedächtnis Werte und Grundüberzeugungen feststellt, die der politischen Verwirklichung bedürfen.
Verfassungen sind keine creatio ex nihilo, sondern „Resultat politischer Entscheidungen und Prozesse“. Dies impliziert ein dynamisches Verständnis von Verfassungen, die, anstatt einmal festgeschrieben zu werden und dann ‚ewige Gültigkeit‘ zu beanspruchen, immer einem Wandel unterworfen sind, der abhängig ist von den Interessen der beteiligten Akteure und den jeweils gegebenen Machtverhältnissen. Zwei Formen des Verfassungswandels lassen sich unterscheiden. Erstens der explizite Wandel, der durch eine formale Änderung einer Verfassungsnorm zustande kommt, wobei die Formalien in der Verfassung geregelt sind, so beispielsweise die in Deutschland notwendige Zweidrittel-Mehrheit. Zweitens der implizite Wandel, der informell über eine inhaltliche Neuinterpretation unter Beibehaltung des Wortlautes vollzogen wird, wobei die Interpretation der Verfassungsgerichtsbarkeit obliegt.
Damit sind Verfassungsfragen Machtfragen und bedürfen der politikwissenschaftlichen Analyse. Geradezu als Initialzündung für die Forschung diente die These der zunehmenden ‚Justizialisierung‘, die am prominentesten von Alec Stone Sweet für die europäische Verfassungsgerichtsbarkeit seit Mitte der 90er Jahre vertreten wurde...
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Handlungsorientierungen und Akteurskonstellationen die zur Kompetenzerweiterung führen
2.1 Legale Handlungsmotivation - judicial activism
2.2 Politische Handlungsmotivation - policy maker
2.3 Sonstige Handlungsmotivationen - Wahl, Karriere, Reputation
2.4 Zwischenergebnis
3. Handlungsorientierungen und Akteurskonstellationen die nicht zur Kompetenzerweiterung führen
3.1 Legale Handlungsorientierung - judicial restraint
3.2 Sonstige Handlungsmotivationen - Wahl, Karriere, Reputation
3.3 Zwischenergebnis
4. Systematisierung/Synthese
5. Schluss
6. Literaturverzeichnis
7. Abbildungsverzeichnis
- Quote paper
- Jörg Wiegner (Author), 2013, Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215594