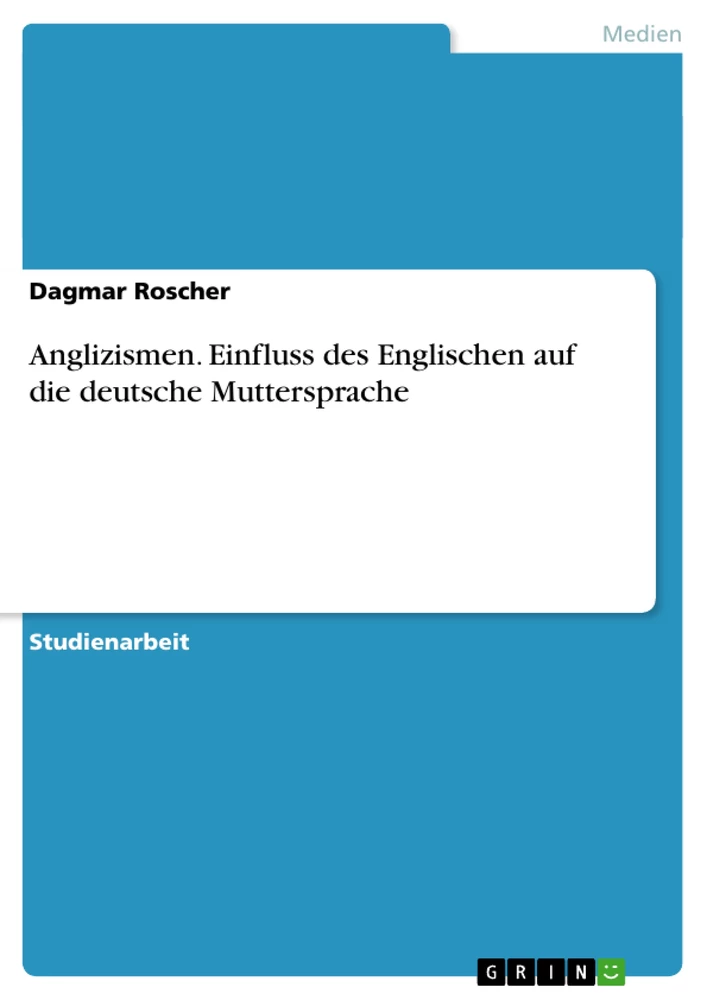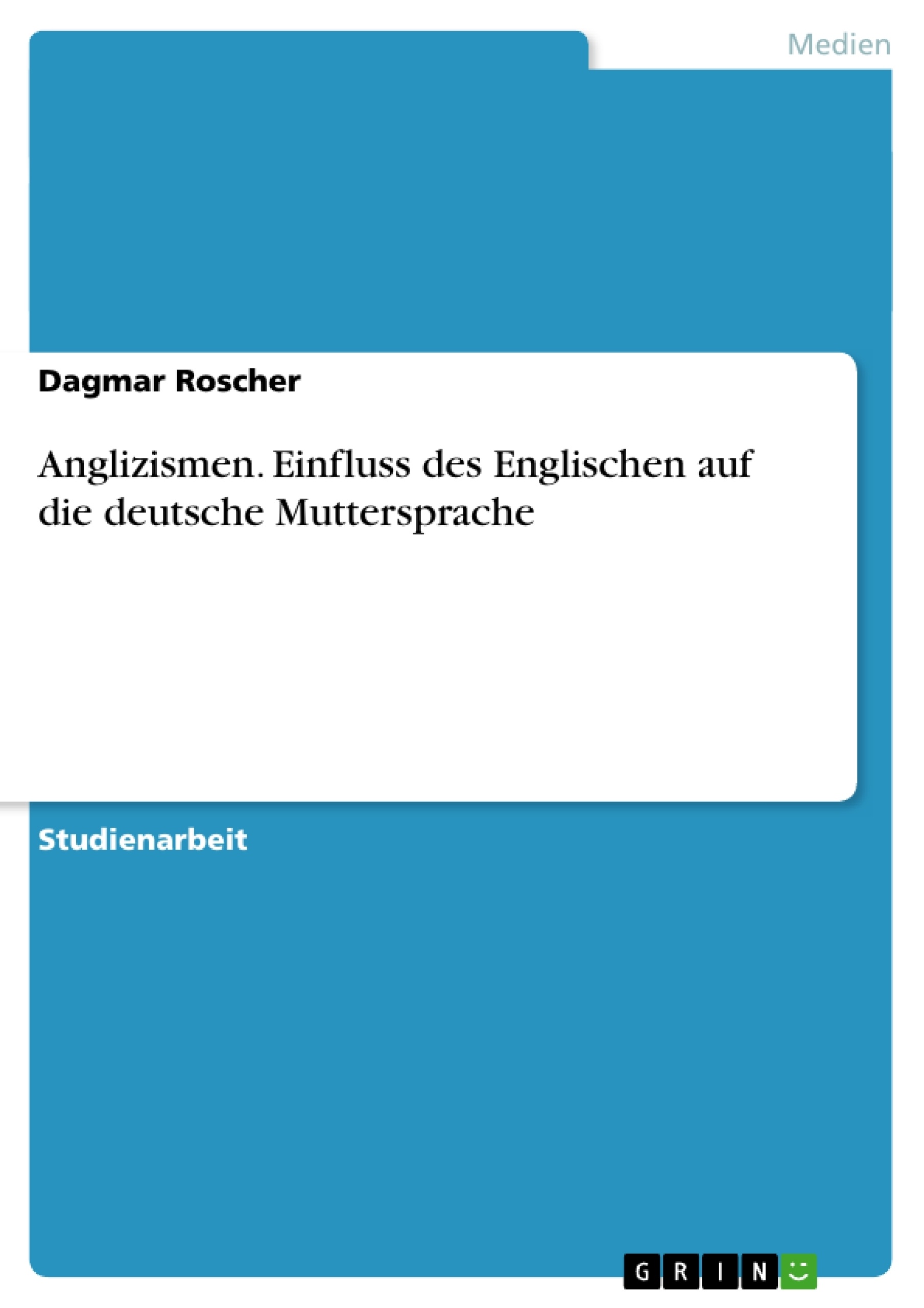Geht man heutzutage mit offenen Augen und Ohren durch die Welt, muss man feststellen, dass man um die englische Sprache nicht mehr herum kommt. In den Stellenanzeigen der Tageszeitung ist ein Platz für einen Key Account Manager ausgeschrieben, im Reisebüro bucht man noch schnell Last Minute, anschließend schaut man bei einer Beauty Farm vorbei. Andere halten vom neuen Wellness Trend überhaupt nichts, sonder relaxen lieber und gönnen sich einen Cocktail, bevor sie am Computer noch schnell ihre emails checken. Im Laden um die Ecke gibt es die neueste Sportswear und am Counter vom Bahnhof holt man sich das Ticket für den nächsten Trip. Abends läuft dann noch eine Live-Übertragung vom Tennis-Match im TV.
Englisch, die Weltsprache, hat immer mehr Einfluss auf die deutsche Sprache genommen. Viele Begriffe - Anglizismen beziehungsweise Amerikanismen genannt - sind schon alltäglich und werden ständig von uns benutzt. Sie sind schon so sehr eingedeutscht, dass man sich ihrer Herkunft überhaupt nicht mehr bewusst ist. Andere scheinen nur einem kurzen Modetrend zu unterliegen, werden für einen bestimmten Sachverhalt konzipiert und verschwinden ganz schnell wieder. Hier stellt sich nun die Frage, warum gerade das Englische einen so hohen Stellenwert besitzt und weshalb besonders amerikanische Begriffe den deutschen Wortschatz bereichern sowie welche Auswirkungen mit diesem Phänomen einhergehen. Wie viele Leute beherrschen diese Weltsprache so gut, um die erwähnten Sachverhalte richtig zu verstehen? Gibt es auch Menschen, die ein Problem damit haben, dass jedes dritte Wort in der Zeitung oder einer Fernsehsendung einen englischen Ursprung hat?
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Grund dieser Entwicklung sowie den Auswirkungen des Gebrauchs solcher Ausdrücke im Alltag sowie im Bereich der Medien- und Pressesprache. Es wird auch geklärt, warum insbesondere die Zeitschrift DER SPIEGEL ein beliebtes Analyseobjekt im Hinblick auf die Nutzung von Anglizismen darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffserklärungen: Anglizismus, Fremdwort, Lehnwort
- 1.1 Anglizismus
- 1.2 Fremdwort - Lehnwort
- 2. Gründe für die Ausweitung des Englischen in der deutschen Sprache
- 2.1 Weltsprache Englisch
- 2.2 Entwicklung nach 1945
- 3. Ebenen der Verwendung von Anglizismen
- 3.1 Im Alltag
- 3.2 Medien- und Pressesprache
- 4. DER SPIEGEL
- 4.1 Die Untersuchung von Wenliang Yang
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die zunehmende Verwendung von Anglizismen in der deutschen Sprache. Ziel ist es, die Gründe für diese Entwicklung zu beleuchten und die Auswirkungen auf den alltäglichen Sprachgebrauch sowie die Medien- und Pressesprache zu analysieren. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Zeitschrift DER SPIEGEL gewidmet.
- Begriffserklärung und Differenzierung von Anglizismen, Fremdwörtern und Lehnwörtern
- Analyse der historischen und soziokulturellen Faktoren, die zur Verbreitung von Anglizismen geführt haben
- Untersuchung der Verwendung von Anglizismen in verschiedenen Kontexten (Alltag, Medien)
- Erläuterung der Rolle der USA und des Englischen als Weltsprache
- Diskussion der unterschiedlichen Reaktionen auf die Anglizismen in der deutschen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die omnipräsente Nutzung englischer Wörter im heutigen deutschen Sprachgebrauch fest und benennt die Forschungsfrage nach den Ursachen und Auswirkungen dieses Phänomens. Sie skizziert den thematischen Fokus der Arbeit, der die Gründe für die Verbreitung von Anglizismen, deren Verwendung im Alltag und in den Medien sowie die Rolle von DER SPIEGEL als Analyseobjekt umfasst.
1. Begriffserklärungen: Anglizismus, Fremdwort, Lehnwort: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Anglizismus, Fremdwort und Lehnwort. Es differenziert zwischen den verschiedenen Arten von Anglizismen (konventionalisierte, im Konventionalisierungsprozess befindliche und Zitatwörter) und erläutert die Unterschiede zwischen Fremdwörtern und Lehnwörtern anhand ihrer morphologischen, orthographischen und phonologischen Anpassung an die deutsche Sprache. Es werden Beispiele für alle drei Kategorien angeführt und die Schwierigkeiten bei der Bestimmung der genauen Herkunft von Wörtern diskutiert.
2. Gründe für die Ausweitung des Englischen in der deutschen Sprache: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen für die zunehmende Verbreitung von Anglizismen. Es analysiert den Status des Englischen als Weltsprache und seine Bedeutung in verschiedenen Bereichen wie Technologie, Medien und Kultur. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Entwicklung nach 1945, einschließlich des Einflusses der amerikanischen Besatzung und der kulturellen Faszination für die USA, die die Verbreitung amerikanischer Anglizismen deutlich vorangetrieben hat.
Schlüsselwörter
Anglizismen, Amerikanismen, Fremdwörter, Lehnwörter, Weltsprache Englisch, Mediensprache, Sprachwandel, Sprachkontakt, DER SPIEGEL, post-1945 Entwicklung, Kulturtransfer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Verwendung von Anglizismen in der deutschen Sprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die zunehmende Verwendung von Anglizismen in der deutschen Sprache. Sie untersucht die Gründe für diese Entwicklung und deren Auswirkungen auf den alltäglichen Sprachgebrauch sowie die Medien- und Pressesprache. Ein besonderer Fokus liegt auf der Zeitschrift DER SPIEGEL.
Welche Begriffe werden definiert und unterschieden?
Die Arbeit definiert und differenziert zwischen Anglizismen, Fremdwörtern und Lehnwörtern. Es werden verschiedene Arten von Anglizismen (konventionalisierte, im Konventionalisierungsprozess befindliche und Zitatwörter) erläutert und die Unterschiede anhand morphologischer, orthographischer und phonologischer Anpassungen an die deutsche Sprache dargestellt.
Welche Gründe für die Ausbreitung von Anglizismen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Status des Englischen als Weltsprache und dessen Bedeutung in Technologie, Medien und Kultur als Hauptgründe für die Ausbreitung von Anglizismen. Die Entwicklung nach 1945, inklusive des Einflusses der amerikanischen Besatzung und der kulturellen Faszination für die USA, wird ebenfalls analysiert.
Welche Ebenen der Anglizismenverwendung werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Verwendung von Anglizismen im Alltag und in der Medien- und Pressesprache. Die Analyse der Zeitschrift DER SPIEGEL dient als Fallbeispiel für die Mediensprache.
Welche Rolle spielt DER SPIEGEL in der Analyse?
DER SPIEGEL dient als Fallstudie, um die Verwendung von Anglizismen in der deutschen Medienlandschaft zu analysieren. Die Arbeit bezieht sich dabei auf eine Untersuchung von Wenliang Yang.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Begriffserklärungen (Anglizismus, Fremdwort, Lehnwort), den Gründen für die Ausbreitung des Englischen in der deutschen Sprache, den Ebenen der Anglizismenverwendung und Schlussbemerkungen. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Anglizismen, Amerikanismen, Fremdwörter, Lehnwörter, Weltsprache Englisch, Mediensprache, Sprachwandel, Sprachkontakt, DER SPIEGEL, post-1945 Entwicklung, Kulturtransfer.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die Gründe für die zunehmende Verwendung von Anglizismen in der deutschen Sprache zu beleuchten und die Auswirkungen auf den alltäglichen Sprachgebrauch sowie die Medien- und Pressesprache zu analysieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffserklärung und Differenzierung von Anglizismen, Fremdwörtern und Lehnwörtern; die Analyse historischer und soziokultureller Faktoren der Anglizismenverbreitung; die Untersuchung der Anglizismenverwendung in verschiedenen Kontexten (Alltag, Medien); die Erläuterung der Rolle der USA und des Englischen als Weltsprache; und die Diskussion unterschiedlicher Reaktionen auf Anglizismen in der deutschen Sprache.
- Quote paper
- Dagmar Roscher (Author), 2003, Anglizismen. Einfluss des Englischen auf die deutsche Muttersprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21581