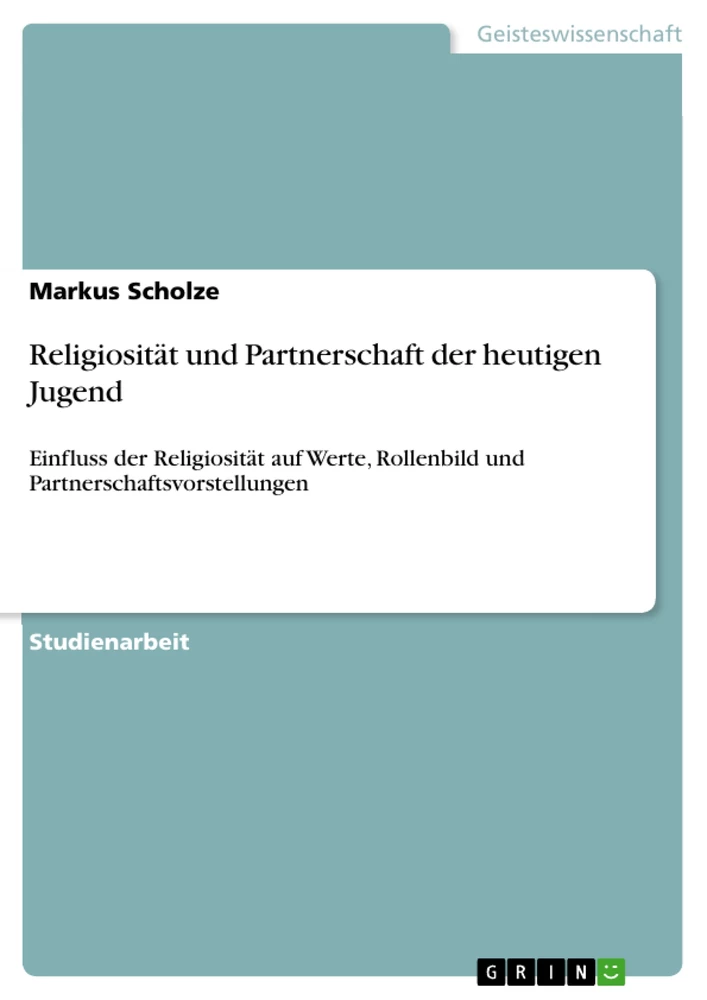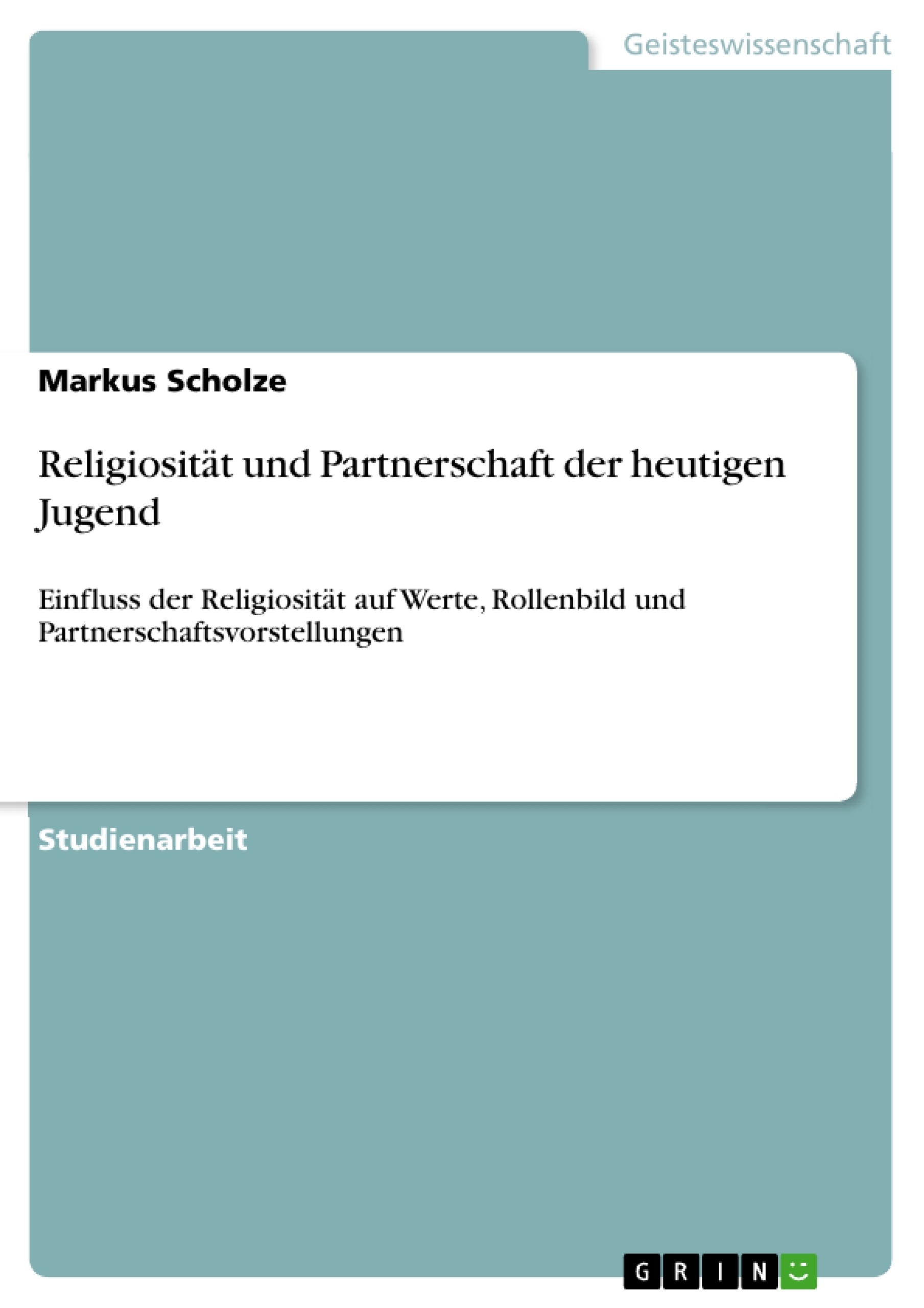Ist es nicht der Werteverfall, den uns die Öffentlichkeit als Grund für Beziehungsunfähigkeit und mangelnde Bereitschaft für langfristige Partnerschaften der heutigen Jugend suggerieren möchte?
Kennen wir nicht alle die oberflächlichen Aussagen unserer Gesellschaft, die Jugend möchte keine Verantwortung auf sich nehmen und sich nicht durch Beziehungen langfristig binden?
Welche Faktoren sind es aber, die einen Einfluss auf die Wertvorstellungen und zukünftigen Familien- und Partnerschaftsvorstellungen der Jugendlichen haben?
In der 15. Shell Jugendstudie 2006 (Deutschland) wurde unter anderem diese Thematik eingehend behandelt und im Bezug auf das Wertesystem und Religiosität der Jugend eine zentrale Feststellung hervorgehoben.
„Religiosität spielt im Wertesystem der Jugend weiterhin nur eine mäßige Rolle, besonders bei den männlichen Jugendlichen. An diesem Befund hat sich seit den 80ern und 90ern auch in den 2000er Jahren nichts geändert.“ (Albert Mathias, Hurrelmann Klaus, u.a.: Jugend 2006. 15.Shell Jugendstudie. Frankfurt am Main. 2006. S.24)
Dennoch soll in dieser vorliegenden Arbeit dieses Thema behandelt werden und Ergebnisse für Österreich liefern, die wahrscheinlich den Deutschen sehr ähnlich sind.
Die vorliegende Seminararbeit präsentiert Ergebnisse aus der Österreichischen Jugend- Wertestudie 2000. Befragt wurden 998 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 24 Jahren.
Ziel und Inhalt dieser Seminararbeit ist die Untersuchung, von welchen Faktoren Partnerschaftsvorstellungen und Werte innerhalb einer Beziehung bzw. Lebensgemeinschaft möglicherweise abhängig sind und welche Vorstellungen Jugendliche von der Aufteilung der alltäglichen Tätigkeiten in einer Partnerschaft haben.
1. Inhaltsverzeichnis
2. Einleitung
3. Hypothesen
4. Dimensionen
5. Präsentation der Ergebnisse
5.1. Intrinsische Werte in einer Partnerschaft
5.2. Zukunftsperspektive Partnerschaft
5.3. Traditionelles vs. egalitäres Rollenbild
6. Zusammenfassung
7. Anhang
- Quote paper
- MA Markus Scholze (Author), 2008, Religiosität und Partnerschaft der heutigen Jugend, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215860