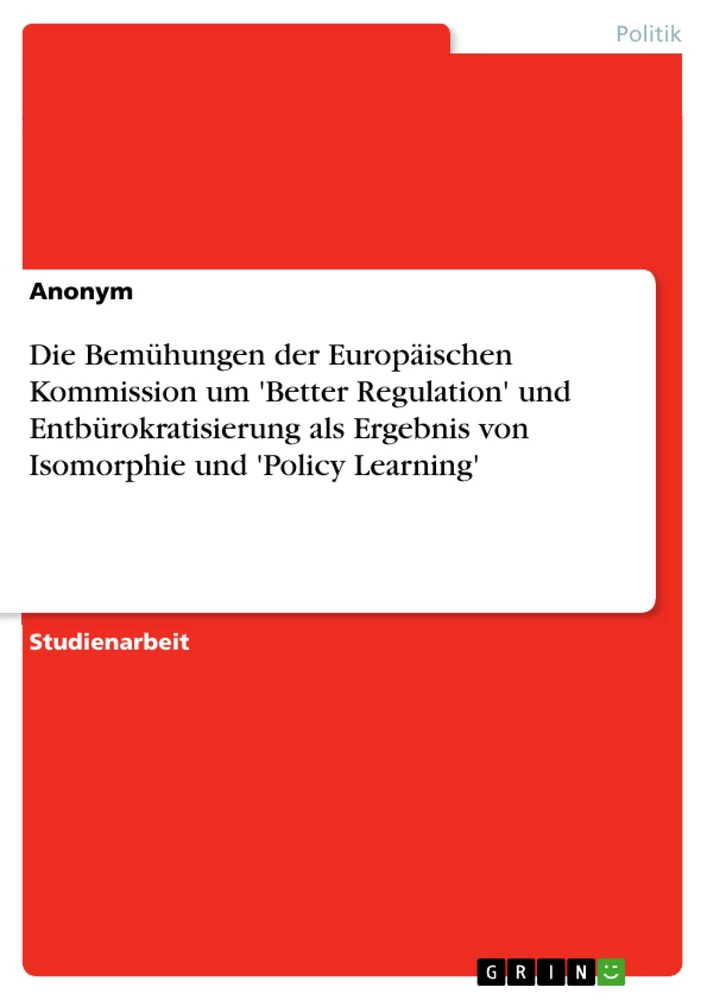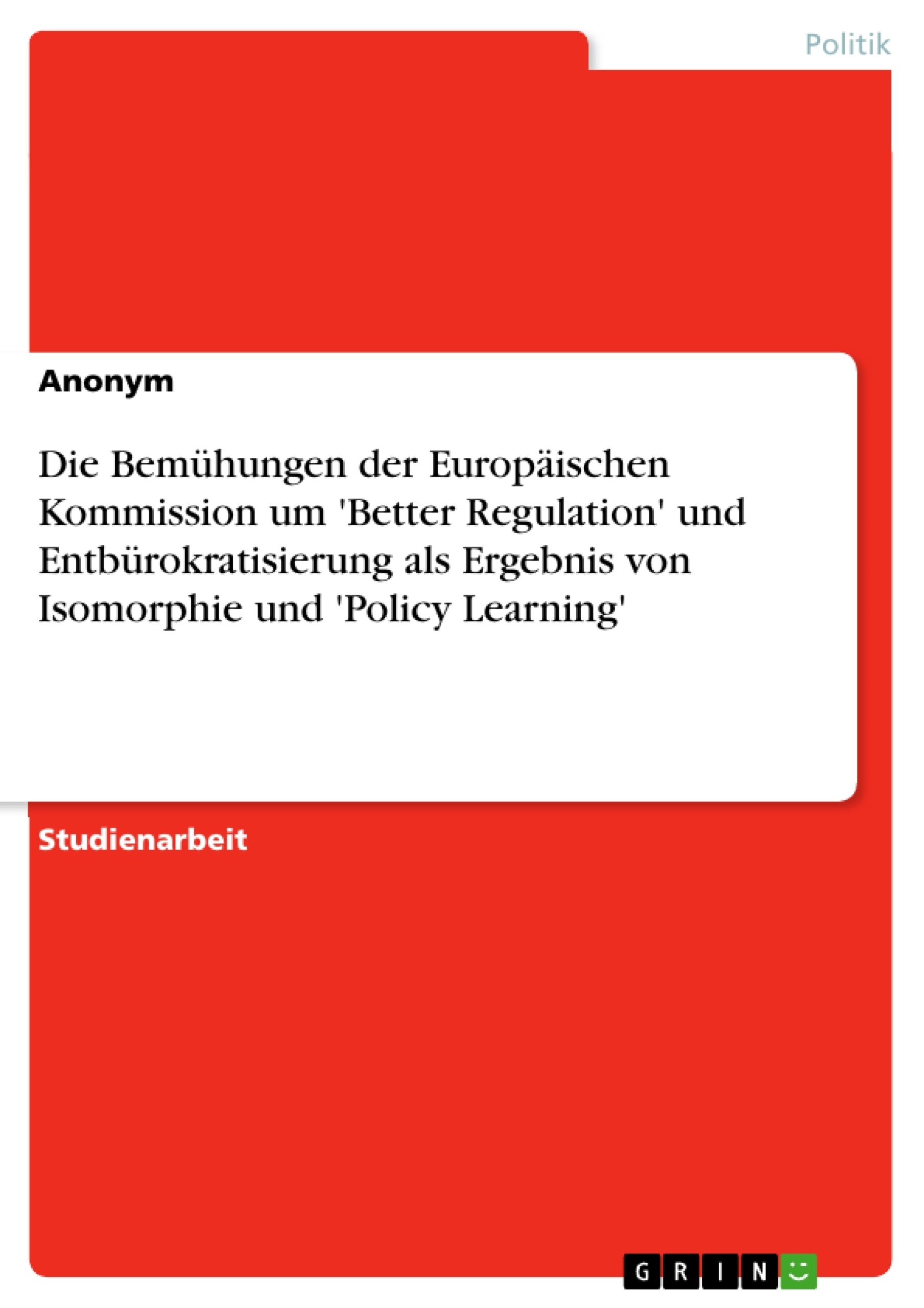Die politik- bzw. verwaltungswissenschaftliche Arbeit fokussiert den Einfluss der niederländischen Behörde ACTAL und der britischen Better Regulation Task Force auf die europäische Kommission. Hierbei wird insbesondere die Wiederbelebung der Lissabon-Strategie betrachtet. Die Arbeit steht unter der Annahme des Policy Learning durch die EU, bzw. isomorpher Entwicklung in der EU-Kommission. Die Argumentation wird durch eine Vielzahl von Originaldokumenten gestützt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Europäische Bemühungen um bessere Rechtsetzung und Entbürokratisierung - ein Überblick
- Von den Anfängen bis zur Barroso-Kommission
- Bessere Rechtsetzung im Kontext der wiederbelebten Lissabon-Strategie
- Das Vereinigte Königreich und die Niederlande als Vorreiter
- Britische Initiativen zur Beeinflussung der europäischen Agenda
- ACTAL und die Beeinflussung der europäischen Agenda
- Bewertung - unter den Gesichtspunkten der Isomorphie und des Policy Leaming
- Schlussbetrachtung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Quellen
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Bemühungen der Europäischen Union im Bereich der Entbürokratisierung und besseren Rechtsetzung seit 2004. Sie untersucht, wie diese Entwicklungen als Ergebnis von Isomorphie und Policy Learning betrachtet werden können, wobei der Fokus insbesondere auf dem Einfluss von Großbritannien und den Niederlanden liegt.
- Die Rolle von Isomorphie und Policy Learning in der europäischen Politikgestaltung
- Die Entwicklung der Entbürokratisierungs- und Better Regulation-Agenda in der EU
- Die Einflussnahme von Großbritannien und den Niederlanden auf die europäische Agenda
- Der Wandel der europäischen Gesetzgebung hin zu einer stärker wirtschaftsorientierten Herangehensweise
- Die Bedeutung von Institutionen und Akteuren in der internationalen Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Themenbereich der Arbeit vor und erläutert die Forschungsfrage. Sie skizziert die Entwicklungen in der europäischen Gesetzgebung seit 1992 und beleuchtet die Rolle von Großbritannien und den Niederlanden als Vorreiter in diesem Bereich.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über die europäischen Bemühungen um bessere Rechtsetzung und Entbürokratisierung. Es betrachtet die Anfänge dieser Entwicklungen, die Bedeutung der Lissabon-Strategie und den Paradigmenwechsel unter der Kommissionspräsidentschaft von José Manuel Barroso.
Kapitel 3 beschreibt die Bemühungen von Großbritannien und den Niederlanden, den Themenkomplex bessere Rechtsetzung und Entbürokratisierung auf die europäische Agenda zu setzen. Es analysiert die Aktivitäten der Better Regulation Commission (BRC) im Vereinigten Königreich und des Adviescollege Toestsing Administratieve Lasten (ACTAL) in den Niederlanden.
Kapitel 4 bewertet die Entwicklung der europäischen Agenda unter den Gesichtspunkten der Isomorphie und des Policy Learning. Es untersucht die Rolle verschiedener Institutionen und Akteure in diesem Prozess und analysiert die Mechanismen des Wissenstransfers und der institutionellen Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Entbürokratisierung, bessere Rechtsetzung, Isomorphie, Policy Learning, Europäische Union, Großbritannien, Niederlande, Lissabon-Strategie, Verwaltungslasten, Impact Assessment, Better Regulation, Regulatory Policy Committee, Adviescollege Toestsing Administratieve Lasten, High Level Group on Administrative Burdens, European Standard Cost Model, Folgenabschätzung, Gesetzesfolgenabschätzung, Wissenstransfer, institutionelle Entwicklung, internationale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet 'Better Regulation' im Kontext der Europäischen Union?
'Better Regulation' (Bessere Rechtsetzung) bezeichnet die Bemühungen der EU-Kommission, Gesetzgebungsverfahren effizienter zu gestalten, Verwaltungslasten abzubauen und die Qualität der Gesetzgebung zu erhöhen.
Welchen Einfluss hatten die Niederlande auf die EU-Entbürokratisierung?
Die niederländische Behörde ACTAL fungierte als Vorreiter und beeinflusste die europäische Agenda maßgeblich durch den Transfer von Wissen und bewährten Methoden zur Verringerung von Verwaltungslasten.
Was versteht man unter 'Policy Learning' in dieser Arbeit?
Policy Learning beschreibt den Prozess, bei dem die EU-Kommission von den Erfahrungen und Modellen einzelner Mitgliedstaaten (wie Großbritannien und den Niederlanden) lernt und diese auf europäischer Ebene implementiert.
Welche Rolle spielt die Lissabon-Strategie für die EU-Gesetzgebung?
Die Wiederbelebung der Lissabon-Strategie unter der Barroso-Kommission führte zu einem Paradigmenwechsel hin zu einer stärker wirtschaftsorientierten Herangehensweise und forcierte die Better-Regulation-Agenda.
Was ist 'Isomorphie' im politikwissenschaftlichen Sinne?
Isomorphie bezeichnet die Angleichung von Institutionen oder Prozessen an bestehende Vorbilder, in diesem Fall die Übernahme nationaler Regulierungsstandards durch die EU-Kommission.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Die Bemühungen der Europäischen Kommission um 'Better Regulation' und Entbürokratisierung als Ergebnis von Isomorphie und 'Policy Learning', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215886