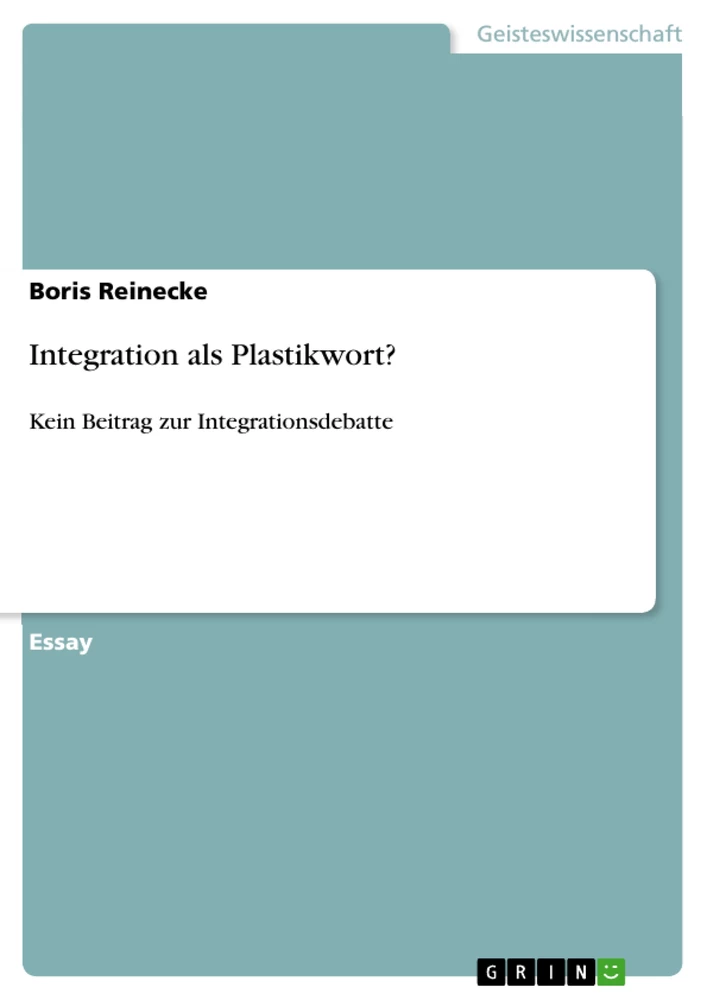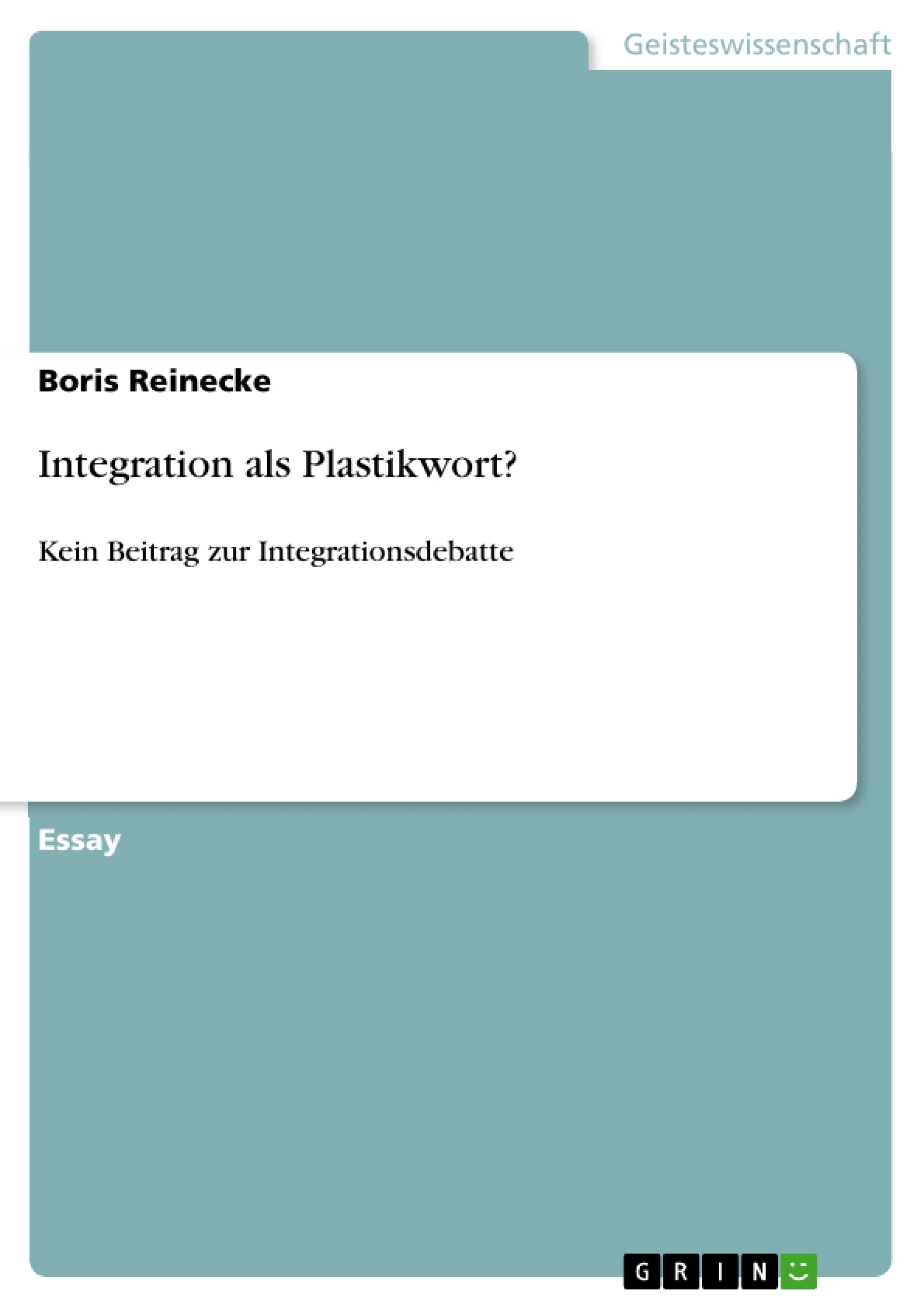Ob beim Fachsimpeln über das neue Mannschaftsmitglied der Lieblingsmannschaft, beim Gespräch über das neue Kind in der Schulklasse, oder bei spontansoziologischen Stammtischgesprächen über "die Moslems" in der BRD: Gern und oft wird im Alltag von Integration gesprochen und davon, dass sie im besprochenen Fall gelungen, missglückt, verweigert worden, notwendig, unmöglich oder anderes sei.
Ein Begriff der Wissenschaft wird hier verwendet als Wort der Alltagssprache. Sprechen Fachkundige der Politikwissenschaft oder Soziologie von Integration, so tun sie das im Idealfall unter wissenschaftlichen Bedingungen: Integration wird als definierter
Begriff behandelt, in einen theoretischen Kontext eingebettet, Extension und Intension sind mehr oder minder deutlich abgegrenzt, sodass dieses Wort als Fachbegriff
brauchbar ist.
In Äußerungen zu Integration innerhalb der Alltagssphäre hingegen bleibt unklar was mit Integration gemeint sein könnte, ob soetwas wie theoretische Grundannahmen hinter der Verwendung des Wortes stehen und falls ja, welche das sein könnten. Kurz gesagt: Extension und Intension scheinen stets unterschiedlich
und sind meist unbekannt oder diffus. Statt Begriff drängt sich hier schon eher die Bezeichnung Plastikwort auf, die Uwe Pörksen für Wörter wie Entwicklung, Sexualität oder Kommunikation prägte.
Ob das Wort "Integration" nun tatsächlich auch als Plastikwort zu begreifen ist, wird nachfolgend zu beweisen sein.
Inhaltsverzeichnis
- Integration als Plastikwort?
- Einleitung
- Integration - Ein Wort der Wissenschaft?
- Integration als Plastikwort?
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert den Begriff „Integration" und untersucht, ob er als „Plastikwort" im Sinne von Uwe Pörksen zu betrachten ist. Der Essay befasst sich mit der Verwendung des Begriffs in der Wissenschaft und im Alltag und untersucht die semantische Leere und die manipulative Funktion des Wortes.
- Analyse des Begriffs „Integration" im Kontext der Alltagssprache und der wissenschaftlichen Verwendung
- Untersuchung der semantischen Eigenschaften des Begriffs „Integration" im Vergleich zu den Kriterien von Pörksens „Plastikwörtern"
- Bewertung der gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen des Begriffs „Integration" im Kontext der Integrationsdebatte
- Kritische Betrachtung der Verwendung von „Integration" als adressierter Imperativ und die damit verbundene Übertragung von Verantwortung auf Migrantinnen und Migranten
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die die allgegenwärtige Verwendung des Begriffs „Integration" im Alltag und in wissenschaftlichen Diskursen beleuchtet. Es wird festgestellt, dass die Bedeutung des Begriffs oft diffus und unklar bleibt.
Im zweiten Kapitel wird die wissenschaftliche Verwendung von „Integration" untersucht und die Einbettung des Begriffs in theoretische Kontexte der Soziologie und Politikwissenschaft dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Integration als Fachbegriff in wissenschaftlichen Kontexten eine präzisere Definition und Abgrenzung erfährt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse von „Integration" als Plastikwort im Sinne von Uwe Pörksen. Es werden die Kriterien von Pörksens „Plastikwörtern" auf den Begriff „Integration" angewendet und die Übereinstimmungen und Unterschiede untersucht.
Der Text schließt mit einer Zusammenfassung der Analyse und betont die problematische Verwendung von „Integration" als adressiertem Imperativ in der Integrationsdebatte. Es wird festgestellt, dass der Begriff zur Ideologisierung der Debatte beitragen kann und die Verantwortung für Integration auf Migrantinnen und Migranten überträgt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Begriff „Integration", „Plastikwörter", „Uwe Pörksen", „Integrationsdebatte", „Migration", „gesellschaftliche Eingliederung", „semantische Leere", „manipulative Funktion", „adressierter Imperativ", „Ideologisierung", „Verantwortung", „Migrantinnen und Migranten".
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "Plastikwort" nach Uwe Pörksen?
Ein Plastikwort ist ein Begriff, der in vielen Kontexten verwendet wird, aber eine diffuse Bedeutung hat. Es wirkt fachmännisch, ist aber semantisch leer und wird oft manipulativ eingesetzt.
Wird der Begriff "Integration" als Plastikwort betrachtet?
Ja, die Analyse zeigt, dass "Integration" im Alltag oft unklar bleibt. Während die Wissenschaft den Begriff definiert, wird er in der Alltagssprache oft als vage Forderung ohne klare Kriterien genutzt.
Was ist die manipulative Funktion des Wortes "Integration"?
Durch seine Unbestimmtheit kann das Wort zur Ideologisierung von Debatten beitragen. Es suggeriert eine Lösung, ohne den Weg dorthin oder die genauen Ziele klar zu benennen.
Warum wird Integration als "adressierter Imperativ" bezeichnet?
Oft wird Integration als einseitige Forderung an Migranten gerichtet. Dadurch wird die alleinige Verantwortung für das Gelingen des Zusammenlebens auf die Minderheit übertragen.
Wie unterscheidet sich die wissenschaftliche Verwendung von der Alltagssprache?
In der Wissenschaft (Soziologie/Politik) wird Integration in theoretische Kontexte eingebettet und präzise abgegrenzt, während sie im Alltag oft als diffuser Sammelbegriff fungiert.
- Quote paper
- Boris Reinecke (Author), 2011, Integration als Plastikwort?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215915